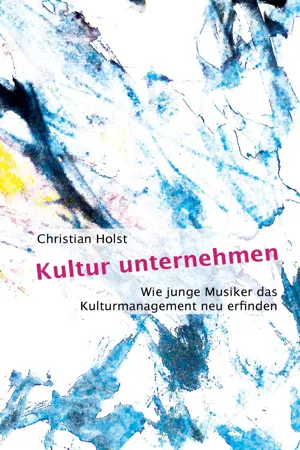
- 88 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Traditionelle Kultureinrichtungen stehen vor zahlreichen Herausforderungen: Überalterung des Publikums, schwindende gesellschaftliche Relevanz, chronische Unterfinanzierung, festgefahrene Strukturen und andere mehr. Von Seiten der Kulturmanagementlehre wird daher verstärkt Unternehmertum gefordert. Dieses Buch wirft einen Blick in die Praxis junger Ensembles und Musiker und beleuchtet in kurzen Fallstudien und Interviews deren unternehmerischen Erfolgsrezepte. Es zeigt sich, dass Kunst und Unternehmertum keinesfalls Gegensätze sind, wie oftmals postuliert wird. Im Gegenteil: Im Idealfall beflügeln sich beide gegenseitig.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kultur unternehmen von Christian Holst im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medien & darstellende Kunst & Musik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Interview mit Louis Dupras, Camerata Bern
«Wer nicht motiviert ist, hat keinen Platz hier»
Die Camerata Bern ist ein freies Kammerorchester, bestehend aus 14 festen Mitgliedern. In welcher Rechtsform ist es organisiert?
Die Camerata Bern ist 1962 als Verein gegründet worden. Als ich 2007 die Geschäftsführung übernahm, war das auch noch die Rechtsform. Es gab allerdings schon länger Überlegungen, den Verein in eine Stiftung zu überführen. Ich habe dann darauf hingewirkt, dass wir das schnell umsetzen. Am 1. Juli 2008 wurde die Stiftung gegründet, der Verein fungierte dabei als Stifter und gab das nötige Kapital ein.
Wer war Mitglied in dem Verein?
Die Musiker und Musikerinnen der Camerata sowie natürliche und juristische Personen, hauptsächlich aus Bern und der Umgebung. Der Verein wurde de facto auch in die Stiftung importiert, indem die Mitglieder des ehemaligen Vereins heute Mitglieder der Stiftungsversammlung sind.
Was waren die Gründe, eine Stiftung zu gründen und nicht z.B. eine GmbH oder AG?
Wir haben damals die Rechtsformen untersucht, die in der Schweiz in Frage kommen. Das sind GmbH, Genossenschaft, Aktiengesellschaft (AG) und Verein. Die kommerziellen Formen, also GmbH und AG, waren allerdings unvorteilhaft, denn der Verein war seit langem steuerbefreit und es ging auch darum, die Steuerbefreiung beizubehalten. Das wäre in einer GmbH sehr viel schwieriger gewesen. Die Stiftung hat dem Verein gegenüber wiederum den Vorteil, dass sie eine viel solidere, stabilere Struktur bietet. In einem Verein kann es sehr schnell gehen – je nachdem, wie eine Generalversammlung verläuft – dass die Kontinuität der Arbeit nicht mehr gewährleistet ist. Die Camerata hat das einmal erlebt, als der Vereinsvorstand die Auflösung des Vereins beschließen wollte. Nur die Machtübernahme eines neuen Vorstands hat die Camerata vor dem Ende bewahrt. Viele Musiker, die heute im Orchester sind, haben das miterlebt und aus dieser Erfahrung den Schluss gezogen, dass eine stabilere Struktur gut wäre. Wir merken zwar einerseits, dass uns diese Rechtsform gegenüber der Stiftungsaufsichtsbehörde stärker verpflichtet. Aber wir merken andererseits auch, dass wir mit vielen Stiftungen, die uns Geld für unsere Projekte geben, jetzt auf einer Augenhöhe kommunizieren können. Auch bei Sponsoren haben wir an Glaubwürdigkeit und Seriosität gewonnen, ebenso bei den subventionierenden Behörden, also dem Stadtrat, dem Kantonsrat und der Burgergemeinde. Deswegen ist die Stiftung die beste Rechtsform für uns.
Gibt es über die Stiftungsurkunde hinaus noch so etwas wie ein Leitbild? Ein Dokument, das die Ziele und Grundsätze der Zusammenarbeit beschreibt?
Die Regelungen des Stiftungsreglements beziehen sich auf die Strukturen und Formalitäten und sind vor allem durch rechtliche Anforderungen definiert. Darüber hinaus gibt es ein Leitbild, in dem das Selbstverständnis der Camerata als flexibles Ensemble beschrieben ist, das von seinem Konzertmeister geleitet wird. Damit ist klar, dass es eine flache Hierarchie gibt. Das Top-Down-Gebilde eines Sinfonieorchesters, wo vorne ein Dirigent steht und die Musiker ausführen, was er möchte, gibt es hier nicht. Man arbeitet auf ähnlicher Augenhöhe zusammen und der Konzertmeister leitet das Ganze als primus inter pares. In den Proben kann jeder etwas einbringen. Allerdings sollte man das auch nicht zu sehr idealisieren, eine gewisse Hierarchie gibt es schon. Wir haben sehr knappe, weil teure Probenzeit. Wenn da alles basisdemokratisch diskutiert und entschieden werden müsste, könnten wir die Zeit nicht effizient nutzen.
Wieviele Proben werden denn für ein Konzert angesetzt?
In der Regel sechs Proben und eine Generalprobe. Je nach Schwierigkeit der Werke können das auch mal sieben oder acht Proben sein, sehr selten noch mehr. Werke, die fest im Repertoire sind – ein Mozart-Hornkonzert zum Beispiel – brauchen nur eine halbe Probe. Das entspricht dem, wie auch Sinfonieorchester proben, aber da ist ja wie gesagt ein Dirigent, der alles organisiert und bestimmt. Und da sind auch die Bogenstriche bereits in die Noten eingetragen worden und so weiter. Das ist bei uns nicht der Fall. Die Musiker müssen sich selber organisieren. Wer bei uns seinen Einsatz verpasst, ist selber Schuld.
Im Unterschied zu Sinfonieorchestern spielt die Camerata auch im Stehen. Was ist der Grund dafür?
Im Stehen ist ein viel dynamischeres Musizieren möglich. Die Musiker können durch intensive Körpersprache und Augenkontakt besser miteinander kommunizieren, weil sie sich einander situationsabhängig zuwenden können. Dabei geht es nicht darum, Einsätze zu geben, sondern darum, die absolute Präzision zu schaffen. Die Reaktionszeiten sind so viel kürzer, als wenn das über einen Dirigenten koordiniert wird und man erreicht eine viel höhere Präzision. Die Musiker proben zwar sitzend, aber die Generalproben und die Konzerte spielen sie stehend. Die CD-Aufnahmen übrigens auch.
Antje Weithaas ist derzeit die künstlerische Leiterin. Das heißt, sie hat die künstlerische Verantwortung für die Programme und leitet die Proben. Wählt sie auch die Stücke aus?
Das ist komplizierter. Für unsere Abonnementskonzerte machen wir die Programme zu dritt: Antje, ein Kollege aus dem Ensemble und ich. Wir bilden also eine kleine Kommission, zu der wir auch einen musikwissenschaftlichen Berater hinzuziehen, der Mitglied im Stiftungsrat ist. In diesem Kreis entstehen die Programme. Aber natürlich gehen wir auch auf die Wünsche von Gästen ein. Oder es gibt mal Stücke, die wir für eine Tournee einstudiert haben und die wir dann in der nächsten Saison auch in Bern aufs Programm nehmen. Insgesamt ist das also ein sehr dynamischer Prozess, der im Austausch mit verschiedenen Stakeholdern entsteht. Das letzte Wort über das Programm habe ich. Denn ich muss geradestehen für alles, was hier passiert, deswegen liegt die letzte Entscheidung im Zweifel bei mir und ich muss schauen, welches Interesse überwiegt.
Das heißt aber auch, die Solisten werden nicht für bestimmte Konzerte mit definiertem Programm eingekauft, sondern es wird geguckt, mit welchen Künstlern man arbeiten möchte und mit denen wird dann das Programm entwickelt?
Richtig, ja. Wir versuchen immer, Solisten einzuladen, die wir bereits kennen, d.h. in aller Regel besteht eine Beziehung. Es ist selten jemand, den wir nie gesehen haben.
Und die Entscheidung darüber, welche Solisten eingeladen werden, kommt auch in der Kommission zustande?
Das ist sehr unterschiedlich, wie diese Entscheidungen zustande kommen. Manchmal fragt uns ein Festivalleiter oder ein Veranstalter: Habt ihr Lust ein Konzert mit diesem oder jenem Solisten zu machen? Und dann versuchen wir es und wenn es gut klappt, dann setzen wir die Zusammenarbeit fort. Oder jemand aus dem Ensemble schlägt jemanden vor. Es gibt keinen festgelegten Ablauf, wie die Solisten ausgewählt werden.
Wie wird die künstlerische Leitung gewählt und bestimmt? Kommt das auch über Kontakte zustande oder wählen Sie Künstler aus, mit denen Sie arbeiten wollen und kontaktieren die dann? Und wer entscheidet das?
Die Ensembleversammlung – also die Musiker des Orchesters – schlägt vor, wen die Stiftung anstellt. Allerdings hat die Camerata bisher nicht so viele verschiedene Leiter gehabt, dass sich da ein ganz fest strukturierter Ablauf etabliert hätte. Der erste Leiter, der die Camerata gegründet hat, war 20 Jahre im Amt. Sein Nachfolger war bereits Mitglied der Camerata und hatte die Leitung ebenfalls fast 20 Jahre inne. Dann gab es eine Zeit mit einem Leitungs-Triumvirat. In dieser Zeit war Erich Höbarth als Gastleiter eingeladen worden und das Ensemble wollte gern weiter mit ihm arbeiten. Er war dann fast 10 Jahre Konzertmeister, bis ihm Antje Weithaas folgte, die ebenfalls zuerst als Gastleiterin mit der Camerata gearbeitet hat. Die Camerata spielt ungefähr die Hälfte ihrer Konzerte mit der ständigen künstlerischen Leitung; die anderen Konzerte werden von Gästen geleitet. Als der Vorschlag auf Antje fiel, wurde eine Umfrage im Ensemble gemacht und da es ein einstimmiges Ergebnis gab, hat die Stiftung Antje Weithaas dann eingestellt.
Wie sieht denn das Anstellungsverhältnis der Musiker aus? Sind die auf Honorarbasis engagiert?
Richtig. Die Musiker werden ins Ensemble gewählt. Sie erhalten keinen fixen Monatslohn, sondern immer einen Projektlohn. Es gibt da einen fixen Satz pro Probe und pro Konzert gemäß den Sätzen des Schweizer Musikerverbandes. Von diesem Lohn werden die Sozialabgaben und die Beiträge für die Pensi onskasse5 abgezogen, da sind wir ein ganz normaler Betrieb und werden auch so kontrolliert. Meistens haben wir auch externe Musiker dabei, die keine Ensemblemitglieder sind, aber regelmäßig von uns engagiert werden, zum Beispiel die Bläser oder weitere Streicher, wenn wir Verstärkung brauchen. Außerdem gibt es drei fest angestellte Mitarbeiter im Management: Die Geschäftsführung mit einem 100 %-Pensum und zwei Mitarbeiterinnen mit je einem 50 %-Pensum. Unsere Buchhaltung lassen wir extern machen. Die Administrationskosten betragen so 15 % von unserem Gesamtetat.
In Ihrem Jahresbericht schreiben Sie von einem strengen Prozess der Selbstkritik und Qualitätskontrolle. Können Sie erläutern, wie der genau aussieht?
Das ist nicht genau festgelegt. Es gibt keine Nachbesprechung nach einem Konzert. Manchmal geschieht das einfach, weil man noch zusammen etwas trinken geht, aber das ist nicht institutionalisiert. Wenn aber das gleiche Programm mehrfach gespielt wird, gibt es für die weiteren Konzerte eine Anspielprobe, zum Beispiel, wenn wir in einem anderen Saal spielen. Bei dieser Gelegenheit kann man auch die Stellen noch einmal proben, mit denen man im Konzert noch nicht ganz zufrieden war. Die künstlerische Leitung oder ein Stimmführer kann dann den Wunsch äußern, eine Stelle noch einmal genauer zu proben etc. Das ist die Qualitätskontrolle. Bei einem Programm, das nur ein oder zweimal gespielt wird, wird das weniger der Fall sein. Aber auch wenn man ein neues Programm einstudiert, kann man schauen, dass gewisse Schwachpunkte aus früheren Programmen besser erarbeitet werden. Die Qualitätskontrolle erfolgt auch sehr stark bei der Auswahl der Ensemblemitglieder. Das ist auch Gegenstand einer großen internen Diskussion, wer bei der Wahl der Ensemblemitglieder wie viel zu sagen hat.
Wie sieht denn so ein Auswahlprozess aus?
Bei unserem letzten Auswahlprozess wurden nach einem Probespiel vier Probandinnen für ein Jahr eingeladen, verschiedene Programme mitzuspielen. Für ein weiteres Jahr wurde dann eine von denen für ein weiteres Jahr gewählt. Am Schluss der Saison hat man dann beschlossen, dass es leider doch nicht passt und sie doch nicht ins Ensemble aufgenommen. Das hat uns zweifeln lassen, ob ein Verfahren mit Probespiel ein geeigneter Weg ist, um gute Leute zu finden. Denn Topleute haben in der Regel keine Muße, Stelleninserate zu lesen und zu schauen, wo es Stellen gibt, die sie interessieren. Gute Leute haben ohnehin so viel zu tun, dass sie nicht darauf angewiesen sind, danach zu schauen. Aber das sind genau die Leute, die wir möchten und brauchen. Wir arbeiten jetzt daran, neue Ensemblemitglieder über den Berufungsweg zu holen. Das heißt, wir verzichten auf Ausschreibungen und Probespiel und laden Kandidaten, die wir interessant finden, für ein paar Projekte ein. Wenn wir finden, sie sind interessant für uns und könnten gut zu uns passen, dann laden wir sie für ein Probejahr ein. Mittlerweile haben wir auch ein sehr großes Netzwerk, denn unsere Leute spielen nicht nur bei uns, sondern auch beim Chamber Orchestra of Europe, beim Mahler Chamber Orchestra, bei der Cappella Andrea Barca oder in Kammerensembles. Also sind unsere Musiker ständig in Wechselbeziehungen mit anderen Musikern, so dass es da ein riesiges Netzwerk gibt.
Topleute heißt auch topmotivierte Leute. Unternehmen Sie etwas, um die Motivation der Musiker zu fördern? Zum Beispiel durch bestimmte Anlässe?
Wir machen keine Motivationsanlässe oder ein Kickoff zum Saisonstart oder ähnliches wie man das von Wirtschaftsunternehmen kennt. Vielleicht wäre es interessant, so etwas auch zu machen, aber es gibt zwei Gründe, warum das schwierig ist: Einer ist, dass die Zeit sehr knapp und teuer ist, in der uns die Musiker zur Verfügung stehen. Eine Probe mit allen Musikern kostet 1.000 Franken pro Stunde6. Und da wir mit wirklich sehr knappen Ressourcen arbeiten müssen, versuchen wir, diese immer nur der Musik, der künstlerischen Arbeit, zugute kommen zu lassen. Der zweite Grund ist, dass die Ensemblemitglieder so einen An-satz wahrscheinlich gar nicht verstehen würden. Wer nicht motiviert ist, hat keinen Platz hier und sollte sich anderswo umschauen. Die Leute müssen vorbereitet in die Proben kommen, sie müssen vorher zu Hause geübt haben. Sie müssen sich die Werke angehört haben. Wenn es hier eine Motivationsspritze bräuchte, dann machen wir etwas falsch. Wir versuchen uns die besten Mitarbeiter zu sichern erstens mit einem guten Lohn, zweitens mit einem guten Ruf und drittens mit guten Projekten. Das sind in meinen Augen die drei Säulen, warum die Leute gern mit uns arbeiten. Darüber hinaus laden wir auf Tourneen alle zum Essen ein und ich versuche, in der alltäglichen Kommunikation das Wir-Gefühl anzusprechen, anstatt bei punktuellen Anlässen. Auch der persönliche Kontakt zwischen den Musikern und mir ist wichtig, deswegen bin ich immer mindestens bei der ersten Probe eines Projekts dabei, um die Leute zu begrüßen und das Projekt vorzustellen, Fragen zu beantworten. Und ich bin natürlich immer bei allen Konzerten und Generalproben dabei.
Öffentlich finanzierte Kultureinrichtungen programmieren primär nach künstlerischen Gesichtspunkten und versuchen dann ein Publikum für das Programm zu gewinnen. Für die Camerata, die nur zu einem geringen Teil öffentlich finanziert wird, dürfte das schwieriger sein. Trotzdem nehmen Sie nicht nur marktgängige Gassenhauer ins Programm. Wie ist vor diesem Hintergrund Ihr Blick auf Ihr Publikum?
Ich verstehe die Camerata in diesem Punkt als ganz normalen Betrieb, der Kundschaft hat und der mit dieser Kundschaft Erfolg haben möchte. Unsere Kundschaft ist das Publikum. Viele davon kennen wir mittlerweile persönlich und viele geben uns auch sehr wichtige Feedbacks auf das, was wir machen. Da sind wir wie die Bäckerei an der Ecke. Die macht Brötchen, wir machen Musik. Wenn wir sie nicht verkaufen können, haben wir ein großes Problem, denn die 40 % Subventionen, die wir erhalten, reichen nicht aus, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Das ist der Unterschied zu den Theatern oder Sinfonieorchestern, die, wie Sie sagen, weniger für das Publikum programmieren müssen und dadurch viel mehr Planungsfreiheit haben. Genau genommen müsste man bei ihnen von der «freien Szene» sprechen.
Trotzdem haben wir natürlich auch klare Vorstellungen bezüglich gutem Geschmack: Wir wollen gute Musik machen und das fängt mit guten Musikern an. Und diese gute Musik kommt beim Publikum an. Bei unseren ersten Konzerten im Kultur-Casino Bern haben wir nur Haydn, Mozart und Beethoven gespielt. Das hat sich sehr gut verkauft. Dann haben wir gedacht, wir müssen auch zeitgenössische Musik aufführen, von deren Qualität wir wirklich überzeugt sind, das aber meistens kombiniert mit sehr beliebten Werken. Ich glaube, das Publikum weiß inzwischen, dass sie nur beste Werke von uns in bester Aufführung bekommen. Wir sehen unser Publikum also wi...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort von Dirk Schütz, KM Kulturmanagement Network
- Einleitung: Kultur unternehmen
- Führung und Zusammenarbeit: «Mit offenen Flügeln spielen»
- Interview mit Meret Lüthi, Les passions de l’Ame: «Ich möchte die ganze Regenbogenpalette»
- Innovation: Streng nach dem Lustprinzip
- Interview mit Steven Walter, PODIUM Festival: «Wir haben kein Produktproblem»
- Marketing: Anschlussfähigkeit schaffen
- Interview mit Tobias Rempe, Ensemble Resonanz: «Die sind korrekt!»
- Public Relations: Keine Berührungsängste
- Interview mit Daria van den Bercken, Pianistin: Liebe auf den ersten Ton
- Musikvermittlung: Die beste Vermittlung ist die, die keine ist
- Interview mit Etienne Abelin, Superar Schweiz: «Passion first»
- Interview mit Louis Dupras, Camerata Bern: «Wer nicht motiviert ist, hat keinen Platz bei uns»
- Literatur
- Über den Autor
- Impressum