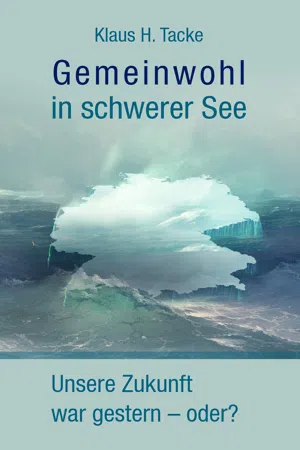![]()
Es gilt aufzuzeigen, wie es dem einzelnen Menschen allein oder in einer Gruppe gelungen ist, im Rahmen seiner offiziellen Tätigkeit zusätzliche Vorteile für sich oder seine Gruppe zu realisieren. Erst wenn diese grobe „Mängelliste“ bekannt ist, kann man gemeinsam überlegen, ob es überhaupt Möglichkeiten für eine Änderung der Zustände gibt und wenn ja, wie man sich am wirkungsvollsten für Änderungen engagieren kann.
Die Beispiele werden drei Gruppen zugeordnet, die wesentlichen Anteil an der heutigen Situation unseres Gemeinwohls haben.
- 1. Menschen in Verwaltung und Politik.
Die erste Gruppe betrachtet die Institutionen, die sich direkt oder indirekt mit der Gestaltung und Verwaltung unseres Gemeinwesens befassen. Die in diesen Institutionen tätigen Menschen werden von mir im weiteren Verlauf zusammengefasst zu „öffentlichen Arbeitnehmern“. Zu ihnen gehören auch jene Arbeitskräfte, die in gemeinnützigen Organisationen arbeiten oder in anderen Institutionen, die nicht gewinnorientiert tätig sind. (Im Gegensatz dazu sind die Mitarbeiter in gewinnorientierten Unternehmen hier zusammengefasst als „private Arbeitnehmer“). - 2. Menschen als Unternehmer.
Die zweite der drei aufzuzeigenden Gruppen wird den Unternehmern gewidmet. Sie versuchen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wenn sie erfolgreich sind, benötigen sie Personal und schaffen produktive Arbeitsplätze. Arbeitsplätze als Konsequenz ihrer Tätigkeit sind wichtige Voraussetzung für das Funktionieren unseres Wirtschaftssystems.
Unternehmer sind in der jüngeren Geschichte gleichzeitig das beste Beispiel, wie man nicht erwünschte Auswirkungen auf das Gemeinwohl effizient eingrenzen kann. - 3. Menschen in Interessengemeinschaften.
In der dritten Gruppe sollen beispielhaft die mit Interessengemeinschaften verbundenen Tätigkeiten und ihre negativen Auswirkungen auf die Situation unseres Gemeinwohls beleuchtet werden.
Wir werden sehen, wie durch die angesprochenen Tätigkeiten der Staat in seinen finanziellen Möglichkeiten entscheidend beschränkt wird, die dringend anstehenden Aufgaben zur Sicherung unserer Zukunft zu bewältigen.
Mit der Begrenzung des unternehmerischen Freiraums durch die soziale Marktwirtschaft wurde ein Meilenstein zum Wohl der Allgemeinheit gesetzt. Er war von entscheidender Bedeutung. Aber er war trotzdem lediglich der erste und einzige konsequente Schritt, das Wohl der Gemeinschaft gegen die individuellen Interessen einzelner Gruppen zu schützen. Es gibt zahllose und teilweise sehr einflussreiche Institutionen, die ebenfalls Wege gefunden haben, sich auf Kosten der Gesellschaft Vorteile zu verschaffen.
Betrachten wir als erste die Organisationen, die direkt mit der Verwaltung und Gestaltung unseres Gemeinwesens befasst sind – die öffentliche Verwaltung und die Vertreter des Volkes.
Während in kleineren Verwaltungen jeder seinen Aufgabenbereich hat und weiß, was er wie zu tun hat, gibt es in größeren und großen Verwaltungen öffentlicher oder privater Art zusätzliche Problemkreise, die jeder dort tätige Arbeitnehmer kennen und respektieren muss, wenn er nicht ins Abseits gedrängt werden will.
Nachfolgende Aspekte bedürfen in der Regel besonderer Beachtung:
- Ein Mitarbeiter wird von Dritten ausgewählt – und muss sich deshalb deren Gunst versichern,
- er wird von Dritten bezahlt – und muss deshalb seinen „Wert“ deutlich machen,
- er ist in der Regel austauschbar – und muss deswegen vorbeugende Maßnahmen vorsehen, um
- – ein Netzwerk zu basteln, welches ihn in seinem Existenzkampf unterstützt,
- – seine Wichtigkeit zu dokumentieren,
- – Konkurrenz von unten früh genug zu entdecken und zu neutralisieren,
- – sich nach oben „angepasst“ zu benehmen (als Teil des Netzwerkes) und
- – sich dadurch für höhere Aufgaben zu empfehlen.
Ein Netzwerk beruht in der Regel auf Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit bedeutet, dass jeder die Möglichkeiten, die ihm seine Aufgabe und Position geben, zum Wohl anderer Netzwerker einbringen kann.
Je interessanter sein Befugnisspielraum für möglichst viele andere Kollegen ist, umso mehr Chancen hat er, mit „Gegendiensten“ auf breiter Basis rechnen zu können.
Je länger so ein Netzwerk besteht, umso stabiler und effizienter funktioniert es. Der frühere Personalvorstand bei der Volkswagen AG, Peter Hartz, und sein dortiges Umfeld sind ein klassisches Beispiel für die Möglichkeiten, sich selbst über Gewährung von Vergünstigungen an andere eine Machtposition zu schaffen, an der niemand, weder in der informellen noch in der formellen Hierarchie, vorbeigehen kann.
Die Beziehungsgeflechte, die jeder versucht aufzubauen, um sich im Idealfall wie die Spinne mitten ins sichere Netz zu setzen, beruhen auf gegenseitiger Hilfe, Abhängigkeit, Korruption, Erpressung und ggf. Nötigung. Man leistet oft selber vor, damit der andere noch „einen Gefallen schuldig“ ist. Und alles passiert in einer Form, die in der Regel schnell als Irrtum oder Missverständnis interpretiert werden kann.
Neben der aktiven Form der „Existenz“-Sicherung ist es erforderlich, seine Wichtigkeit und Unersetzlichkeit zu dokumentieren. Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass ein Mensch in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Verwaltung auf die Idee käme, eine Aufgabe zu vereinfachen oder wegfallen zu lassen. Er würde sich damit dem Risiko aussetzen, dass die Arbeit problemlos von anderen übernommen werden und er selber schlimmstenfalls als überflüssig angesehen werden könnte. Deshalb tendiert der öffentliche Arbeitnehmer eher in die entgegengesetzte Richtung. Eine Aufgabe muss möglichst kompliziert und komplex sein, damit niemand so richtig durchblicken kann. Das macht ihn im Idealfall unersetzlich und verschafft ihm dadurch in seinem kleinen Arbeitsumfeld eine mehr oder weniger monopolähnliche Nische.
Eine weitere Strategie der Selbsterhaltung besteht darin, dass man sich mit viel nötiger oder unnötiger Arbeit umgibt. Damit erreicht man einen doppelten Effekt. Zum einen wird es dadurch schwerer, jemanden im Umfeld zu finden, der das ganze Arbeitsfeld abdecken könnte. Das schafft zusätzliche Sicherheit. Zum anderen ist aber zuviel Arbeit unbedingte Voraussetzung, um den nächsten Programmpunkt dieser Strategie umsetzen zu können. Entlastung durch zusätzliche Arbeitskräfte bekommt nur der, der zuviel Arbeit hat. Der Überlastete kann sich auf diese Weise zwar nicht nach oben arbeiten, aber de facto wird eine neue Hierarchiestufe unter ihm angebaut, durch die er dann gleichzeitig „Führungsqualitäten“ nachweisen kann. Er schafft neue Arbeitsplätze. Im Gegensatz zum privaten Sektor muss er sie aber nicht selber bezahlen, also braucht er sich auch nicht zu sorgen, ob das dafür benötigte Geld auch eine entsprechende Leistung erwirtschaftet.
Die obigen Erklärungen führen in der Konsequenz zu Verhaltensformen, die in wissenschaftlichen Untersuchungen eindeutig beschrieben wurden. Wer bei dem englischen Soziologen Cyril Northcote Parkinson nachliest, bekommt auf sehr humorvolle Weise seine Beobachtungen der Verhaltensweisen von Mitarbeitern großer Verwaltungen und die Begründungen für deren stetiges Wachstum weltweit. Die beschriebenen Zusammenhänge gingen in die Soziologie ein als die beiden Parkinson’schen Gesetze.(023)
Das erste Gesetz besagt:
Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht – und nicht in dem Maße, wie komplex sie tatsächlich ist. Als Beispiel nimmt er die Rentnerin, die sich einen halben Tag Zeit nimmt für einen Geburtstagsgruß, den ein vielbeschäftigter Manager in drei Minuten erledigt. Daraus folgt, dass die Mitarbeiter einer öffentlichen Verwaltung immer voll beschäftigt sind bis zum Rand des Zumutbaren. Jeder dieser Mitarbeiter – bis in die höchsten Etagen – wird das auch jederzeit auf Anfrage bestätigen.
Nimmt man diese Erkenntnis zusammen mit der allgemeinen Feststellung, dass die Bereitschaft zur Veränderung oder Verbesserung des Aufgabenbereiches denkbar gering ist, wird deutlich, dass für jede Neuerung, die von außen an die Verwaltung herangetragen wird, wegen Vollauslastung eine entsprechende Anzahl an neuem Personal eingestellt werden muss.
Das zweite Gesetz betrifft die Art der Themen-Besprechungen:
In Konferenzen werden diejenigen Themen am ausführlichsten diskutiert, von denen die meisten Teilnehmer Ahnung haben – und nicht die Themen, die am wichtigsten sind. Als Karikatur lässt Parkinson ein Kernkraftwerk bauen. Die Konstruktion des Reaktor-Inneren ist relativ schnell abgehakt mangels fehlenden Fachwissens der Teilnehmer, aber über die Farbe des Fahrradschuppens für die Mitarbeiter wird dann stundenlang heiß diskutiert.
Es dürfte klar sein, dass private Arbeitnehmer (im oben definierten Sinne) grundsätzlich nicht anders programmiert sind als ihre öffentlichen Kollegen. Sie sind jedoch aufgrund der Gewinnorientierung ihrer Unternehmen wesentlich stärker in die Kosteneinsparung eingebunden und laufen deshalb leichter Gefahr, dass zu ihrem eigenen Nachteil die geplanten strategischen Winkelzüge erkannt und abgestellt werden. Schließlich berühren alle Kosten die direkten Interessen des jeweiligen Arbeitgebers, der nur erfolgreich sein kann, wenn er diese Kosten unter Kontrolle hat.
Alle öffentlichen Verwaltungen haben die gleichen Neigungen, sich von innen heraus zu vergrößern, ohne dass es zusätzlicher Aufgaben bedarf. Während jedoch bei den großen Verwaltungen im Privatbereich die Kostenkontrolle der jeweiligen Eigentümer in der Lage ist, gegenzusteuern, ist diese Funktion in öffentlichen Verwaltungen wesentlich schwächer ausgebildet. Die gesamte öffentliche Verwaltung bis hinauf zum höchsten Chef verwaltet nur fremdes Geld – „OPM“ (Other People’s Money). So nennt es die internationale Finanzbranche, wenn sie zur Senkung des eigenen Risikos Fremdgeld einsetzt. Während sie für selbst aufgenommene Kredite haftet, haften bei OPM die fremden Geldgeber. Fremdgeld verführt also – und das ist bei öffentlichen Verwaltungen nicht anders als in der Finanzwelt, zu höherem Risiko und nachlässigerem Umgang.
Zudem erlauben sich die „Öffentlichen“ durchaus einige Privilegien, die unter einem privaten Eigentümer nicht akzeptiert würden. Der Griff in die öffentliche Kasse ist umso verlockender, je weniger mit einer Kontrolle gerechnet werden muss. Das gilt auch und insbesondere für Institutionen, in denen mehrere Nationen engagiert sind. Kontrollen erweisen sich hier in der Regel als langwierig und wenig effizient. Journalisten deckten Ende der 90er Jahre schwere Bereicherungs- und Begünstigungsfälle in der EU-Verwaltung auf. Die Vorwürfe waren so schwerwiegend, dass die gesamte EU-Kommission unter Jacques Santer im März 1999 geschlossen zurücktrat, um einem Misstrauensvotum des EU-Parlaments zuvorzukommen. Die eingesetzte Untersuchungskommission kam zu einer vernichtenden Beurteilung der Situation. „Die EU-Kommission habe jegliche politische Kontrolle verloren, dies habe zu einem Klima der Unwissenheit und Inkompetenz geführt.“(024)
Zu den beiden schon genannten Gesetzmäßigkeiten von Parkinson ist für den öffentlichen Sektor besonders eine Feststellung interessant, welche als das „Peter-Prinzip“ 1969 von Dr. Laurence J. Peter und Raymond Hull in ihrem gleichnamigen Buch vorgestellt wurde: „In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.“ Peter begründet seine Überlegungen mit dem üblichen Beförderungsmechanismus in den Unternehmen und Verwaltungen. Hat jemand seine Position ausgefüllt, ist er reif für die nächste Stufe. Solange, bis er eine der Stufen nicht mehr ausfüllt. Auf der Stufe bleibt er dann, da Rückstufungen selten sind.(025)
Im Fokus der Peter’schen Überlegungen steht immer die falsche Beförderung.
Die Beispiele begegnen uns täglich in der Praxis:
- Ein Lehrer als guter Pädagoge wird plötzlich Schulrat und muss feststellen, dass er von Verwaltungsdingen keine Ahnung hat, oder
- ein guter Fachmann wird zum Abteilungsleiter befördert und versagt, weil er keine Ahnung von Menschenführung hat.
Wenn auch die oben genannten Prinzipien für viele Bereiche Geltung besitzen und nicht nur für die öffentliche Verwaltung, sind sie doch hier besonders zu bedenken, denn den öffentlichen Sektor müssen wir alle bezahlen. Es muss deshalb in unser aller Interesse sein, dass die erforderlichen Tätigkeiten so effizient und kostengünstig wie möglich durchgeführt werden.
Der Beamtenstatus hat nicht nur alles in der Geschichte überdauert, sondern hat zur Folge gehabt, dass die „Klasse des bürokratischen Adels“ sich auch stetig ausbreiten konnte. „Für jedes neue Problem: neue Staatsdiener. Für jedes alte Problem: noch mehr Staatsdiener. Für jedes wegfallende Problem: nicht einen Staatsdiener weniger.“(026)
Es ist enttäuschend, wenn Politiker angesichts der maroden Haushaltslage ernsthaft versichern, dass bei der Kosteneinsparung auf der Ausgabenseite angesichts der vielen zu erledigenden Aufgaben der Boden seit langem erreicht sei und man nur noch die Einnahmenseite nach oben anpassen könne. Sie haben es weder geprüft noch besitzen sie die Kompetenz, das beurteilen zu können. Es wird von ihnen nur gefragt, ob man zur Erledigung der Aufgaben Personal und sonstige Kosten einsparen kann statt zu fragen, welche Aufgaben man einsparen kann.
Und wir stehen zähneknirschend dabei und sehen, wie die öffentliche Bürokratie sich zwar noch scheinbar ehrerbietig „Staatsdiener“ nennt, aber de facto den Staat – also uns – zu ihren Dienern gemacht hat. Sie breitet ihre Tätigkeitsbereiche immer weiter aus und engt damit unseren Freiheitsspielraum mehr und mehr ein. (Lesen Sie bei Interesse unter diesem Link(027) nach, wofür sich öffentliche Bedienstete haarsträubende Zulagen bezahlen lassen.).
Es sitzen faktisch viele „Arbeitslose“ auf den öffentlichen Arbeitsplätzen. Sie haben es aber verstanden, durch immer neue Aufgabenerfindung und –ausweitung sich selber beschäftigt und in Beschäftigung zu halten. Der öffentliche Dienst sollte das übernehmen, was die private Wirtschaft nicht in ausreichender Form erreichen kann oder soll. Das Schaffen neuer Aufgaben ist relativ einfach, weil sich immer ein plausibler Grund finden lässt, um sie zu tun und niemand Interesse zeigt, die Notwendigkeit einer neuen Aufgabe objektiv zu überprüfen.
Motivation ist der wichtigste Motor für menschliches Handeln. Es treibt den privaten Unternehmer dazu, Tag und Nacht über Möglichkeiten zur Verbesserung seines Produktes nachzudenken, weil er sich davon ein Ergebnis erhofft, das ihm wichtig ist und was im Idealfall seine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Ohne Motivation gibt es so gut wie keine Erneuerung resp. Verbesserung. Das haben alle zentralverwalteten Systeme gezeigt. Das stimmt analog aber auch für große und insbesondere öffentliche Verwaltungen. Wer für sich durch Nachdenken oder Verbesserung keinen Vorteil aus einer Tätigkeit ziehen kann, hat keine Veranlassung, sich intensiv Gedanken über eine Veränderung einer bestehenden Situation zu machen. Die Motivation im öffentlichen Sektor bleibt also im Wesentlichen beschränkt auf den Bereich, der die Möglichkeit bietet, das eigene Befriedigungspanel zu optimieren.
Es ist uns allen bewusst, dass in der öffentlichen Verwaltung die Uhren anders gehen als in der Privatwirtschaft. Gegen Tätigkeitskontrollen und Nachprüfungen hat man sich wohlweislich abgeschirmt, indem festgelegt wurde, dass bei uns alle Dokumente der öffentlichen Verwaltungen per se als „geheim“ eingestuft sind und nur in Ausnahmefällen veröffentlicht werden können. Also kann man sich beruhigt zurücklegen.
Ein Angestellter des öffentlichen Dienstes ist verantwortlich für ein bestimmtes Aufgabengebiet, ohne jedoch für die Erledigung seines Aufgabengebietes persönlich haftbar zu sein. Die Möglichkeiten, ihn zur Verantwortung zu ziehen in den Fällen, wo er seiner Verantwortung nicht gerecht wird, sind jedoch so gut wie nicht vorhanden. Es gibt zwar den Paragraphen 266 im Strafgesetzbuch, welcher Untreue im Amt bestraft. Dieser greift allerdings nur dann, wenn es sich um Unterschlagung, Betrug oder Untreue handelt. Sonstige Möglichkeiten, verantwortungsloses Handeln zu ahnden, sind zwar gegeben in Form von Abmahnung, Aussetzen von Beförderungen, Strafversetzung, Dispensierung und ähnlichen Maßnahmen. Sie werden jedoch in der Praxis zu wenig angewandt, als dass sie bei den öffentlichen Arbeitnehmern das Risikobewusstsein gestärkt hätten. Fehlende persönliche Konsequenzen bei Steuerverschwendung sind die Ursache für „überzogene Ausgaben, chronisch defizitäre Haushalte, steigende Staatsschulden und eine erdrückende Belastung mit Steuern und Abgaben. Das heutige Strafrech...