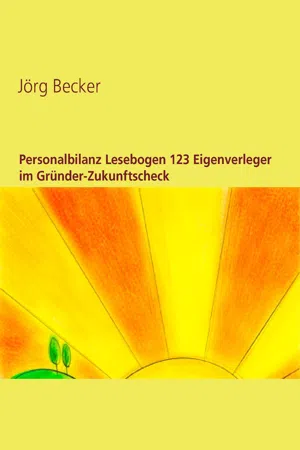![]()
Management der Chancen und Risiken optimieren
Für keinen Eigenverleger gibt es eine hundert-Prozent-Erfolgsgarantie, die Gefahr des Scheiterns, der Insolvenz ist immer dabei
Firmen floppen, das gehört so selbstverständlich zur Geschäftswelt wie die Tatsache, dass ständig neue entstehen. Manche werden gezwungen sein, darüber nachzudenken, wie sich das Scheitern anfühlt, wie man dennoch damit leben kann. Im Amtsdeutsch heißt die Zeit nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens „Wohlverhaltenszeit“. Eine Zeit, in der dem Zahlungsunfähigen gerade noch ein Minimum an Geld zum Leben zugestanden und alles andere einkassiert wird. Wenn die Statistiken stimmen, nach denen etwa acht von zehn Gründern langfristig scheitern, so wäre es an der Zeit, dies nicht manchmal als einen unehrenhaften, sondern vielleicht fast schon normalen Prozess zu begreifen: in jedem Fall aber, die Angst vor dem Verlieren zu verlieren. Die große Gefahr: der Gescheiterte verliert den Kontakt zu sich selbst. Nur eines zählt: möglichst menschlich, man selbst zu bleiben. Nicht den festen Glauben und die Gewissheit zu verlieren, dass man es schaffen kann. Es bringt keinen Gescheiterten weiter, sich ständig (lebenslang?) zu selbstquälend zu fragen: „Wer ist schuld? Was, wenn meine nächste Entscheidung wieder falsch ist? Kann ich wirklich noch etwas riskieren? Anstatt in einer Negativspirale weiter abzusteigen sollte man sich stattdessen besser fragen: „Was mache ich jetzt?“. Ansonsten lebt man zu viele Dinge und Chancen nicht. Menschen machen Fehler und trotzdem geht es weiter. Ein Startup benötigt ein gehöriges Maß an Resistenz gegen Krisen. Etwas Selbstironie und möglichst viel Humor können dabei kaum schaden.
Technologische Verschiebungen im Besitz von Wissen und veränderten Kommunikationsformen
Technik formt auch Strukturen des Wissens und beeinflusst die Modalitäten des Entstehens von Wissen. Der Wandel von Wissen verändert die uns umgebende Welt einschließlich Reaktionen des Bewusstseins: elektronische Technologien verändern traditionelle Denkstrukturen. Der Wandel der Kommunikationsformen hat Auswirkungen sowohl ganz allgemein auf die Gesellschaft als auch speziell auf Eigenverleger als Einzelpersonen. Elektronische Kommunikation überspringt und verschiebt Grenzen: sie verändert Bedingungen und bisherige Restriktionen der Zeitlichkeit: während früher die Sphäre des Privaten auf mündlicher Kommunikation basierte, mündet dies heute vor dem Hintergrund technologischer Verschiebungen in sozialen Netzwerken. Die Konfrontation mit den Herausforderungen der digitalen Revolution verlangt auch von einem Eigenverleger nach dem Verstehen dessen, was da geschieht. Bevor dies aber möglich wird, müssen Strukturen und Prozesse der auf uns in immer schnellerer Folge einstürmenden elektronischen Technologien aber erst einmal identifiziert und erfasst werden. So hat der klassische Besitz von Wissen über das Gedächtnis an Bedeutung verloren: elektronische Medien schaffen neue Möglichkeitsräume in denen alles verfügbare Wissen auf jedem Laptop zugänglich gemacht werden kann. Mit der Anbindung an elektronische Systeme entstehen neue Szenarien mit einer fortschreitenden Virtualisierung des Lebens.
Phase 2 - Zusammengefasste Auswertungen, beispielsweise: Wirkungsstärke auf das Gesamtsystem, d.h. für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, wie groß seine Wirkungsstärke auf das Gesamtsystem aller Faktoren ist. Für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, mit welcher durchschnittlichen Zeitdauer zu rechnen wäre, bis die für ihn angenommene Wirkung eintreten würde. Anteil Wirkungsstärke von Gesamt, d.h. für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, welchen Anteil er hinsichtlich seiner aktiven Wirkungsstärke sein Einfluss auf das Gesamtsystem aller Faktoren hat. Zeitdauer als Abweichung vom Durchschnitt, d.h. für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, wie stark er vom Durchschnitt des Gesamtsystems abweicht hinsichtlich der zu erwartenden Zeitdauer, bis seine jeweilige Wirkung eintritt:
Aggregationsebenen und Verdichtungskalküle von Informationen optimieren: durch die technischen Möglichkeiten begünstigt wird auch oft ein zu hoher Detaillierungsgrad verfolgt, der die personellen Informationskapazitäten überbeansprucht und damit Lernprozesse und Kreativität hemmt. Dies führt zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass neben dem Datenschutz auch eine menschlich machbare Verwertbarkeit der Datenflut gewährleistet sein muss. Der Punkt scheint erreicht, am dem der kritische Faktor nicht mehr die Verfügbarkeit der Daten ist: sondern die Kunst, die richtige Frage zu stellen, um das gewünschte Wissen erzeugen zu können. Denn Datenmüll, ungenaue oder inkonsistente Daten werden auch immer nur falsche Informationen liefern. Diese wiederum würden mehr oder weniger zwangsläufig falsche Entscheidungen verursachen: Informationsfülle und Wissensdefizite stehen in einem Missverhältnis zueinander. Von einer Informationsverarbeitung in diesem Sinne wird deshalb besonders die Entwicklung von Filter- und Selektionsfunktionen zu erwarten sein, damit die Zunahme der Informationsschwemme nicht zu isolierter Kompliziertheit, sondern statt dessen zu entscheidungsrelevanten Informationen führt. Denn solche sind heute wichtiger denn je. D.h. es geht um nicht mehr oder weniger als die planvolle Erstellung und Verteilung der Ressource „Information“ aus der Perspektive von Eigenverlegern. Das heißt: weg von Papier und Informationsflut; statt dessen Informationen selektieren, Verdichtungskalküle einsetzen und nur auf den jeweils erforderlichen Aggregationsebenen anzeigen. Während in der Vergangenheit Eigenverleger eher passives Opfer als aktive Träger bei der Einführung von Informationstechnologien war, hat sich hier im Wege der Entwicklung auch ein Wandel in der Rollenverteilung vollzogen: mit dezentralisierten Informationssystemen begann eine Reise, auf deren Weg jeder „Informationskunde“ an seinem jeweiligen Aufenthaltsort flexibel auf die von ihm benötigten Informationen zugreifen kann.
Die Entscheidung, welche Daten aufgehoben werden sollen, fällt nicht mehr nach ihrer Menge, sondern nach ihrer potentiellen Nützlichkeit. Mit den über alles und jedes in beunruhigender Schnelligkeit wachsenden Datenbergen scheint das Verhältnis von Informationen und Wissen zunehmend gestört zu sein. Es reicht nicht, über alles in der Welt informiert zu sein, um auch alles über die Welt zu wissen. Beispiel Finanzkrise: die täglich einstürmende Informationsflut stand im markanten Widerspruch zur Kärglichkeit des Wissens. In einer informationsfixierten Entscheidungsmaschinerie braucht ein Eigenverleger erhöhte Wachsamkeit, damit die Vernunft nicht unter die Räder gerät: nicht immer sind von Maschinen produzierte Ergebnisse auch die besten.
Planungs- und Kommunikationsprozesse mit Unterstützung von Wissensbilanzen
Verknüpfung plus Ausgewogenheit: Dabei sind einzelne Komponenten der Wissensbilanz zunächst nichts grundlegend Neues. Die eigentlich neue Managementmethode auf der Basis von Wissensbilanzen entfaltet sich erst aus der Verknüpfung verschiedener Management- und Planungsperspektiven sowie aus der Fähigkeit zur Ingangsetzung und Förderung von strategischen Kommunikationsprozessen. Dies drückt sich aus: in der Darstellung der gesamten Organisation des Eigenverlegers, wie hierbei die ganze Komplexität des Arbeitsgeschehens erfasst und transparent auf die entscheidungsrelevanten Aspekte komprimiert wird, wie Visionen und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele messbar gemacht werden, und wie diese strategischen Ziele kommuniziert und im Alltag des finanziellen Budgets verankert werden.
Phase 3 - Ermittlung der passiven Rückkoppelung: für jeden der zuvor identifizierten Einflussfaktoren kann sein aktiver Wirkungseinfluss geschätzt und erfasst werden. Aus diesen Werten lässt sich nunmehr auch die passive Wirkung ermitteln, d.h. wie stark der jeweilige Einflussfaktor umgekehrt von jedem der übrigen Faktoren beeinflusst wird (Rückkoppelung). Hieraus ergibt sich ein passives Wirkungsbild. Auch hierzu wird die jeweilige Zeitdauer angegeben, nach der Faktor seinerseits den passiven Wirkungen unterliegt, beispielsweise:
Symbiose zwischen Management der Chancen und Management der Risiken optimieren – in einer SWOT-Analyse ist nichts alternativlos
Um Erfolg zu haben, wird bei vielen zielorientierten Sachverhalten zunächst versucht, alle irgendwie damit zusammenhängenden Risiken zu identifizieren und nach Möglichkeit zu umgehen oder ganz auszuschalten. Die einseitige Fokussierung auf das Risikomanagement drängt möglicherweise aber gleichzeitig vorhandene Chancen mit einer Ausschöpfung möglicher Pote...