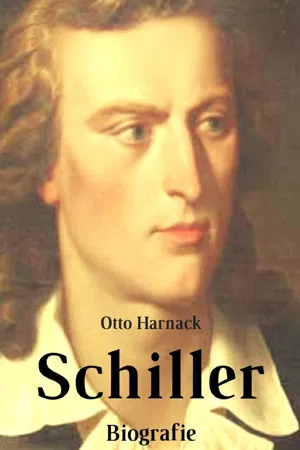
- 514 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die Schiller-Biografie von Otto Harnack gehört zu den Klassikern der Literatur über Friedrich Schiller. Harnack beschreibt die zentrale Rolle von Schillers Vater für dessen späteren Erfolg. Großen Raum widmet Harnack in seiner Biografie der Entstehungsgeschichte von Schillers großen Werken wie »Die Räuber«, »Wallenstein«, »Wilhelm Tell«, und »Die Jungfrau von Orleans«. Auch die starke Inspiration, die Friedrich Schiller aus der Freundschaft mit Johann Wolfgang von Goethe bezog, kommt ausführlich zur Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Schiller von Otto Harnack im PDF- und/oder ePub-Format. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Verlag
Books on DemandJahr
2018eBook-ISBN:
9783752873849Auflage
1Flüchtling und Theaterdichter
Nicht vom Kampf den Wilden zu entstricken,
Den Erschöpften zu erquicken,
Wehet hier des Sieges duft'ger Kranz;
Mächtig selbst wenn eure Sehnen ruhten,
Reißt das Leben euch in seine Fluten,
Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz.
Den Erschöpften zu erquicken,
Wehet hier des Sieges duft'ger Kranz;
Mächtig selbst wenn eure Sehnen ruhten,
Reißt das Leben euch in seine Fluten,
Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz.
Schiller.
Als Schiller vom schwarz-roten württembergischen Grenzpfahl zu dem blau-weißen pfälzischen hinüberschritt, äußerte er eine kindliche Freude; so freundlich wie die Farben, meinte er, sei hier auch der Geist der Regierung. Eine gewisse Behaglichkeit und Gemütlichkeit herrschte in der Tat in dem Ländchen, welches sein Kurfürst Karl Theodor gern durch Milde und Freigebigkeit dafür entschädigte, daß er seinen Hof nach dem durch Erbschaft ihm zugefallenen bayrischen Stammlande verlegt hatte. Aber ein Asyl für politische Flüchtlinge war Kurpfalz doch keineswegs, und Schiller hatte das unverzüglich zu erfahren. Die Erzählung seiner Schicksale erregte überall peinliche Empfindungen; selbst der Theaterregisseur Meier, dem Schiller besonderes Vertrauen geschenkt hatte, hielt doch für nötig, daß der Dichter sich verborgen halte; auch ermahnte er ihn dringend, an den Herzog zu schreiben und seine Unterwerfung anzubieten. Schiller schrieb in der Tat einen Brief, der aber nicht seiner wirklichen Stimmung und seinen Absichten entsprach. Wohl nur um die Ratschläge seiner Umgebung nicht gänzlich abzuweisen, vielleicht auch um seine Familie vor etwaiger Ungnade des Herzogs zu bewahren, entschloß er sich, in mitleiderregendster Weise seine Lage darzustellen und so vielleicht auf das Gemüt des Herzogs Eindruck zu machen; aber auch jetzt hielt er unbedingt an der Forderung fest, »Schriftsteller sein zu dürfen«. Gleichzeitig schrieb er auch an seinen Chef, den General Augé; von diesem erhielt er auch Antwort, die aber nur besagte, daß Schiller zurückkommen möge, da der Herzog gnädig gestimmt sei. Der Hauptpunkt war dabei nicht berührt, und so war für Schiller die Rückkehr unmöglich.
Tatsächlich dachte er auch nur daran, in Mannheim Fuß zu fassen. Sein »Fiesco«, den er fertig mitgebracht, sollte ihm dazu helfen. Ein erster Versuch, ihn den Schauspielern vorzulesen, hatte freilich keinen günstigen Erfolg. Dann aber gab Regisseur Meier, der das ganze Stück gelesen, gute Hoffnung; er wollte sich für die Aufführung verwenden. Doch Dalberg dachte anders. Als Schiller von Frankfurt aus, wohin er sich aus Vorsicht für einige Tage begeben hatte, sich ihm als Flüchtling offenbarte, als er ihm seinen Fiesco antrug und zugleich ihn um einen Vorschuß bat, um seine Schulden tilgen zu können, da hatte der Freiherr keinen anderen Gedanken, als sich den unbequemen Bittsteller vom Leibe zu halten. Er erklärte, daß Fiesco einer Umarbeitung für die Bühne bedürfe, und daß er vorher sich auf keinen Vorschuß einlassen könne. So handelte er gegen den Mann, dem er den glänzenden Erfolg der »Räuber« verdankte, und dem er dafür nichts vergütet hatte, ausgenommen die Reisekosten bei der Erstaufführung! Schiller blieb nichts übrig, als sich an eine Theaterbearbeitung zu machen, obgleich gar keine Ursache und gar kein Fingerzeig für eine solche vorlag; er arbeitete gezwungenermaßen, während er auf Borg lebte und wegen möglicher Nachstellungen aus Stuttgart sich sorglich verborgen hielt. Und doch war alle Arbeit umsonst. Als das Stück in der neuen Form eingereicht war, erklärte Dalberg in Gemeinschaft mit dem Theaterausschuß es auch jetzt für unannehmbar, ohne irgend eine Art von Linderung des für Schiller in diesem Augenblick vernichtenden Bescheides für nötig zu halten. Auch Ifflands Antrag, dem Verfasser zur »Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste« eine Gratifikation von acht Louisdors zukommen zu lassen, wies Dalberg zurück. Der ruhmgekrönte Verfasser der »Räuber« mußte hinter dem paßlosen Deserteur zurücktreten.
Verweilen wir hier, um Schillers zweites Drama, das erst ein Jahr später endlich die Bühne beschreiten sollte, näher zu betrachten! Zugegeben ist, daß der erste Eindruck für die Schauspieler wie für Dalberg eine Enttäuschung sein mußte. Neben den »Räubern« kann »Fiesco« nicht bestehen. Ja, – alles in allem genommen – wird man ihn wohl als das schwächste der Schillerschen Dramen bezeichnen müssen. Trotzdem hat das Stück eine bedeutende Bühnenwirkung. Seine Mängel treten bei der Aufführung hinter den Vorzügen zurück; beim Lesen drängen sie sich dagegen störend hervor. Der Hauptmangel liegt in Schillers damals ganz unvollkommener historischer Bildung, die doch für diesen Stoff unbedingt notwendig war. Nicht an Einzelkenntnissen fehlt es, wohl aber an klarer Erkenntnis der miteinander ringenden historischen Mächte. Gerade die »monumentale Freskomalerei«, welche Schillers gereifter historischer Dramatik eigen ist, die Auffassung der handelnden Personen als Vertreter großer, gegeneinander wirkender Bewegungen fehlt im Fiesco gänzlich. Wir erhalten weder eine klare Vorstellung von der Tyrannei, die den Genuesen droht oder schon auf ihnen lastet (auch dies bleibt zweifelhaft), noch von der Freiheit, welche die Verschwörung ihnen verschaffen soll. Noch viel weniger werden die Rollen uns deutlich, welche Frankreich einerseits und Kaiser Karl andererseits spielen; wie leerer Schall klingen ihre Namen dazwischen an unser Ohr. Diese Mängel führen dazu, daß das politische Pathos, welches in dem Stück so dröhnend hervorklingt, uns nicht mit der Macht innerer Wahrheit ergreift, wie es Schiller im »Tell« später so herrlich gelungen ist, sondern daß es uns phrasenhaft däucht. Und wenn wir schließlich lesen, daß Genua sich wieder friedlich dem alten Andrea Doria beugt, so wird diese Empfindung verstärkt; wozu das republikanische Gelärm? fragen wir, wenn doch alles darauf hinauslauft, daß sich die Familien Doria und Fiesco di Lavagna um die Herrschaft zanken? Man könnte nun vielleicht meinen, der Dichter habe in einer skeptischen Anwandlung die republikanische Freiheitschwärmerei persiflieren, als einen bloßen Deckmantel schildern wollen, hinter dem sich die Intrigen und Gewalttätigkeiten der ehrgeizigen Machthaber verbergen; aber von solchen sakrilegischen Gedanken war Schillers jugendlich-glühende Freiheitsbegeisterung weit entfernt. Dagegen hatte er sich im Stoff total vergriffen; offenbar hatte er bei bloß oberflächlicher Kenntnisnahme geglaubt, hier einen Stoff zu finden, in den er sein politisches Pathos frei könnte einströmen lassen, aber bei tieferem Eindringen zeigte sich das Gegenteil; daher auch das seltsame Schwanken in der Gestaltung des Abschlusses.
Die Geschichte erzählt uns, daß Ludwig Fiesco in Genua eine Verschwörung gegen die Vorherrschaft des Kaufes Doria ins Werk setzte, und daß im Augenblick, da sie gelungen war und er zum Herzog ausgerufen wurde, ein Sturz ins Meer seinen Tod herbeiführte. Das ist ein trauriges Ereignis, aber durchaus kein tragisches. Auch Schiller fühlte dies sehr wohl, aber er sah den Fehler nur in der Zufälligkeit der Katastrophe. Der Fehler liegt aber tiefer; in dem Mangel jeder erschütternden Leidenschaft, jedes tragischen Pathos. Kämpfe um die Herrschaft, Verschwörungen waren für die Italiener in den damaligen bald monarchischen, bald republikanischen, städtischen Gemeinwesen das tägliche Brot; in diesem Hin- und Herschwanken der Machtverhältnisse liegt so wenig etwas Tragisches wie in den Fraktionskämpfen des heutigen Parlamentarismus. Wollte man in diesem Stoffkreise etwas Tragisches darstellen, so mußte man eine Persönlichkeit wählen, die über diesem Intrigenspiel steht, aber trotzdem von ihm fortgerissen wird; ein Verrina, wie ihn Schiller in mächtigen Strichen hingeworfen hat, hätte sehr wohl der tragische Held sein können, der im Glauben, seinem republikanischen Ideal zu dienen, sich in dieses hohle Treiben des Ehrgeizes einläßt und dann, wie er seine Hoffnungen betrogen sieht, einen tragischen Tod sucht. Schiller meinte aber, in Fiesco selbst einen tragischen Konflikt zu legen, indem er in ihm die egoistische Herrschsucht mit dem uneigennützigen Patriotismus streiten läßt. Aber dieser Konflikt ist nur mit dem Verstand ausgeklügelt, nicht natürlich und überzeugend. Denn dieses Genua, das nicht die mindesten Anlagen zu republikanischer Freiheit zeigt, darf Fiesco ohne alle Gewissensbisse als überlegener Monarch regieren, – und unbegründete Gewissensvorwürfe dürfte ein Mann wie Fiesco sich wohl schwerlich machen. Es ist ja auch sein Tod durchaus nicht das Rachewerk eines beleidigten Volkes, sondern die Tat eines vereinzelten republikanischen Fanatikers. Ganz und gar Unnatur aber ist der Abschluß, mit dem die Bühnenbearbeitung das Trauerspiel in ein Schauspiel umwandelt. Fiesco überwindet am Schluß seine sündhafte Herrschsucht. Er wirft den Purpur weg; »sei frei, Genua«, ruft er aus, »und ich dein glücklichster Bürger«. Kam dem freiheitschwärmenden Dichter wirklich nicht zum Bewußtsein, daß eine Stadt, die sich die Freiheit von der Laune eines Fiesco schenken lassen muß, überhaupt der Freiheit nicht wert ist?
Will man den Fiesco genießen, so muß man von dem ganzen republikanischen Pathos und den tragischen Konfliktsmomenten völlig absehen und ihn einfach als Intrigenstück betrachten. Als solches zeigt er einen beträchtlichen Fortschritt über die »Räuber« hinaus, und darin liegt auch seine Bühnenwirkung begründet. Was bei den »Räubern« noch instinktives Gefühl für dramatischen Effekt ist, findet sich hier schon zu bewußter Technik entwickelt. Wenn Franz Moors Intrigen noch an einer gewissen naiven Einfachheit und darum an Unwahrscheinlichkeit leiden, so haben wir im »Fiesco« ein Intrigenspiel von großer Feinheit, ja an manchen Stellen von so verschlungener Entwickelung, daß es dem Leser schwer wird, ihm zu folgen. Wie scharf ist der Unterschied zwischen Gianettino Dorias plumpen Machinationen und Fiescos überlegenen, weitschauenden und sicher ineinandergreifenden Maßregeln! Und nun erst das Werkzeug Fiescos, der berühmte Moor! Es ist die einzige Gestalt des Stückes, die populär geworden ist und wahrhaft lebendig geblieben; aber diese eine Gestalt beweist auch einen großen Fortschritt in der dramatischen Charakterzeichnung Schillers. Sie ist in jedem Augenblick ganz den Erfordernissen der Situation angepaßt, fällt nie aus der Rolle, und jede ihrer Wesensäußerungen ist immer zugleich ein für den Fortgang des Stückes wesentliches Moment. Dabei ist sie in einer bei Schiller seltenen Weise von einem freundlich-humoristischen Licht umgossen, so daß man trotz aller Schändlichkeiten die summarische Exekution als ein fast zu hartes Endschicksal beklagen möchte. Am wenigsten gelungen sind auch im Fiesco noch die Frauengestalten. Zwar sind sie schon weit mehr individualisiert als Amalia von Edelreich; aber die herrschsüchtige Kokette Julia und die rein sich hingebende Leonore fallen beide öfters aus ihrer Rolle als Vertreterinnen der höchsten genuesischen Aristokratie, und der unglücklichen, vergewaltigten Berta hat der Dichter keinen einzigen interessanten Zug zu leihen vermocht. In der Theaterausgabe ist zudem die ganze Berta-Episode zur Unverständlichkeit verzerrt, da Gianettinos Anschlag gescheitert sein soll, und der Fluch des Vaters damit allen Sinn verliert.
Auf die schwülstig-gespreizte Sprache haben wir schon früher hingewiesen. Sie unterscheidet sich sehr zu ihrem Nachteil von dem urwüchsigen Kraftstil der Räuber. In Momenten des höchsten Affektes gibt man dem tragischen Dichter ja gern das Recht zum Gebrauch maßloser Hyperbeln; auch Shakespeare braucht sie dann; hier aber finden sie sich auch an Stellen, die jeder Leidenschaftlichkeit bar sind. Wenn Fiesco auf seinem Ballfest die Gäste zur Fröhlichkeit ermuntert, so ruft er aus: »Der bacchantische Tanz stampfe das Totenreich in polternde Trümmer!« Und wenn der alte Dona seinen ungeratenen Neffen zur Ruhe verweist, so beteuert er, er sei gewohnt, daß das Meer aufhorche, wenn er rede. –
Nach alledem wäre es wohl begreiflich, daß Dalberg nicht seine Hände nach dem »Fiesco« ausstreckte, wenn nur nicht derselbe Dalberg ein Jahr später, als keine Verfolgung von seiten des Herzogs von Württemberg mehr zu fürchten war, denselben »Fiesco« mit samt seinem Dichter mit offenen Armen aufgenommen hätte. Damit bewies er, daß er zuvor nur aus Furchtsamkeit und mit herzlosem Undank gegen Schiller gehandelt habe.
Vor der nächsten Not konnte der Dichter sich zwar retten, indem er das Stück nun zum Druck beförderte, wobei der Buchhändler Schwan ihm ein bescheidenes Honorar zahlte; aber trotzdem war die Lage Schillers verzweifelt. Seine Pläne für Mannheim waren gescheitert, andere Aussichten hatte er nicht; dabei verfolgten ihn von Stuttgart aus seine Gläubiger, und die Gefahr einer Auslieferungs-Forderung des Herzogs drohte ihm noch beständig. Unter diesen Umständen entschloß er sich, von einem Anerbieten Gebrauch zu machen, das er bisher zurückgewiesen hatte, um der Wohltäterin, von der es ausging, keine schlimmen Folgen zuzuziehen. Es war Frau von Wolzogen in Stuttgart, die ihm auf ihrem thüringischen Gut Bauerbach eine Freistatt eröffnete. Wenn der Herzog dies erfuhr, so war es ihm leicht, sich an dem Sohn, der ganz von ihm abhing, zu rächen, und so brachte die edle Frau ihrer Freundschaft für Schiller in der Tat ein großes Opfer. Er nahm es an, im Bewußtsein seines dichterischen Berufs, weil er hoffen durfte, dort in ländlicher Einsamkeit vor Sorgen und materieller Not eine Zeitlang geschützt, das neue, ihm vorschwebende Werk, die Luise Millerin, zu vollenden. Ein letztes Zusammentreffen mit der Mutter wünschte er noch, ehe er in eine, damals gar weit scheinende Ferne zog. Im Posthause zu Breiten an der pfälzisch-württembergischen Grenze traf sie mit der Tochter Christophine in stiller Nacht ein; bald darauf sprengte Schiller auf eiligem Pferde heran. Erst nach zehn Jahren folgte diesem schmerzlichen Abschied ein neues Wiedersehen. Der Vater, der die Wege des Sohnes damals mit besorgter Ängstlichkeit betrachtete, konnte als herzoglicher Beamter nicht wagen, mit dem »Deserteur« zusammenzutreffen. Doch war er erfreut, daß Schiller in der Einsamkeit von Bauerbach nun ferneren kühnen Unternehmungen entsagen werde, und hoffte wohl noch auf eine mögliche Aussöhnung durch Vermittlung der Frau von Wolzogen.
Aber Schiller selbst dachte an keine Aussöhnung. Sich höher zu schwingen mit der Kraft seines Genius, und damit sich allen kleinlichen Hemmungen und Gefahren zu entziehen, das war sein Entschluß. Noch ermaß er die Schwierigkeiten bei weitem nicht vollständig, noch war er von manchen Illusionen befangen; bald hier bald dort hofft er Anknüpfungen zu finden und muß den Gedanken bald wieder fallen lassen. Aber keine Enttäuschung konnte ihn in dem Glauben an sich selbst und an seinen Beruf wankend machen. In diesem Glauben lag wie bei allen großen Gestalten der Menschheit seine unversiegliche Stärke.
Von Mannheim sich zu trennen konnte ihm nicht schwer fallen. Nur von dem treuen Streicher war ein zu Herzen gehender Abschied zu nehmen. Mit Schwan und einigen Schauspielern waren äußerlich gute Beziehungen durch ein höfliches Scheiden aufrecht erhalten. Im Augenblick dachte Schiller wohl kaum an die Möglichkeit einer Rückkehr nach der kurpfälzischen Hauptstadt. Wie einem Paradiese, so fuhr er dem einsamen, unwirtlich gelegenen, im Winterschnee vergrabenen Bauerbach zu. Dreiundsechzig Stunden brauchte die Post damals vom Rhein bis nach Thüringen; Schiller verteilte diese Fahrt auf 7 Tage, so daß er etwa so viel Zeit benötigte, als man heute braucht, um nach Amerika zu reisen.
An ungestörter Freiheit zum Arbeiten fehlte es ihm sicherlich nicht, als er endlich in Bauerbach angekommen war. Aber es ist nicht zu verwundern, wenn er trotzdem in den ersten Monaten nicht zu regelmäßiger Tätigkeit gelangte. Zum erstenmal in seinem Leben genoß er, wonach er sich immer so stürmisch gesehnt hatte: Freiheit! Weder drängende Vorgesetzte noch drängende Not übten jetzt auf ihn Zwang; endlich einmal durfte er aufatmen. Das Arbeiten war übrigens auch dadurch erschwert, daß es in dem bescheidenen Gütchen an Büchern fehlte und daß auch Schiller natürlich wenig davon mitgebracht hatte. Und doch empfand er schon damals lebhaft das Bedürfnis nach historischer Anregung seiner Phantasie. Um es befriedigen zu können, trat er mit dem Meininger Bibliothekar Reinwald in Beziehung. Es war ein hypochondrischer und griesgrämiger Mann, dieser vom Schicksal und den Vorgesetzten ziemlich unfreundlich behandelte Bibliothekar; auch sein geistiger Horizont war eng, und in späteren Jahren, als er Schillers Schwester geheiratet hatte, hat dieser recht hart über ihn geurteilt und es als eine lästige Pflicht betrachtet, wenn er sich seinem Umgang nicht entziehen konnte. Damals aber war ihm Reinwald wirklich von großem Wert, und der noch jugendlich illusionsfähige Dichter träumte sich sogar eine intime Seelenfreundschaft. »Ihr vorgestriger Besuch,« schreibt er einmal, »hat eine ganz herrliche Wirkung auf mich gehabt. Ich fühle mich doppelt wieder, und wärmeres Leben ergießt sich durch meine Nerven .... Möchte auch ich Ihrem Herzen notwendig werden! Möchten auch Sie bei mir frischer atmen und Nahrung genug für Ihre Empfindungen finden!« Es hat etwas Rührendes, dieses Freundschafts- und Bewunderungsbedürfnis, das sich einen Gegenstand sucht, ohne viel nach dessen Würdigkeit zu fragen. Übrigens bemühte sich Reinwald, so viel er konnte, Schillern gefällig zu sein; offenbar hatte es etwas Wohltuendes, Versöhnendes für ihn, jemanden zu finden, der sich ihm so rückhaltlos anschloß. Er vermittelte auch Schillers Korrespondenz, die immer noch unter falschem Namen (Dr. Ritter) geführt wurde.
Der Meininger Freund mußte freilich zurücktreten, wenn Frau von Wolzogen selber in Bauerbach erschien. Schon im Dezember geschah das zuerst, freilich nur auf kurze Zeit. Schiller trat in ein wahrhaft herzliches Verhältnis zu ihr, wenn es auch nicht auf tieferer geistiger Gemeinschaft beruhte. Um ihr alle Ungelegenheiten zu ersparen, die sein Aufenthalt ihr hätte bereiten können, sprengte er brieflich allerlei irrige Nachrichten über seinen jetzigen Wohnort und seine Zukunftspläne aus. In Wirklichkeit dachte er nicht im entferntesten, Bauerbach zu verlassen. Er fühlte sich unlöslich dort gefesselt, da mit Frau von Wolzogen ihre eben erwachsene Tochter Charlotte angekommen war. Charlotte, noch von kindlicher Unbefangenheit des Benehmens, machte es dem Dichter leicht, sich an sie anzuschließen, und Schiller in seinem sanguinischen Bedürfnis und schwärmerischer Empfindung gab sich rückhaltlos der erwachenden Neigung hin. Daß das junge Mädchen in seiner recht einfachen geistigen Anlage und Ausbildung durchaus nicht dazu geeignet war, seinem Gedankenfluge zu folgen, übersah der Dichter zunächst. Lange konnte freilich die Täuschung nicht dauern, und wir werden bald sehen, wie sich dann unruhig eine Neigung in Schillers Herzen an die andere reiht, ja sich auch mehrere nebeneinander einschieben, bis endlich nach sechs Jahren sich seine Empfindung festigt und klärt. Ein Virtuose der Liebe wie Goethe ist Schiller niemals gewesen. Er erscheint bald von übermäßigem Selbstvertrauen gehoben, bald von Zaghaftigkeit zurückgehalten; leicht zu der Absicht geneigt, sich einen häuslichen Herd zu gründen, und ebenso schnell entschlossen, diese Absicht fahren zu lassen. Viel mehr als bei Goethe spielen äußere Rücksichten bei seinen Neigungen mit, und eben darum wird es ihm meist nicht schwer, sie auch wieder zu unterdrücken. Es ist mehr der Wunsch bei ihm durchschlagend, überhaupt ein weibliches Wesen zur Ergänzung seiner Persönlichkeit und zur Festigung seines Lebens für sich zu gewinnen, als das Wohlgefallen an einer bestimmten Person. Es erinnert an die Empfindungsweise des klassischen Altertums, wie der Sinn für Freundschaft bei Schiller sich weit leidenschaftlicher äußert als der für Frauenliebe.
Doch wir greifen mit diesen Bemerkungen vor, da wir Schiller ja hier zum erstenmal in eine Neigung verstrickt finden, die ihm den Gedanken an eine dauernde Verbindung erwecken konnte. Seine Lage war allerdings nicht der Art, daß er eine solche Absicht irgendwie hätte äußern dürfen; aber das war bei dem ungezwungenen, harmlosen Zusammenleben auch gar nicht notwendig. Als die Damen nach einigen Wochen zu Verwandten in der Nähe reisten, machte auch Schiller bei diesen Besuche. Ei trat als Gleichberechtigter in diesen adligen Familienkreis ein und gewann auch hier schnell einen Freund, einen Herrn von Wurmb, dessen »Seele in die seinige schmolz« und mit dem er sich ein längeres, ganz der Freundschaft gewidmetes Zusammenleben erträumte.
Doch zog ihn das Bewußtsein der dichterischen Pflichten schnell wieder in die Bauerbacher Einsamkeit zurück, und als die Wolzogenschen Damen wieder nach Stuttgart zurückgekehrt waren, kam es nun wirklich zu ernstlicher Arbeit. Jetzt (im Februar) wurde die Luise Millerin vollendet, und aus den historischen Werken, die Reinwald ihm zusandte, schöpfte Schiller schon neue dichterische Pläne.
»Don Carlos«, ja...
Inhaltsverzeichnis
- Titelseite
- Kindheit und Jugend
- Die Räuber
- Der Regimentsmedikus
- Flüchtling und Theaterdichter
- In Leipzig und Dresden
- In Weimar
- Professur und Vermählung
- Erkrankung. Philosophische Studien. Besuch in der Heimat
- Freundschaftsbild mit Goethe, Horen und Musenalmanach
- Gedankenlyrik, Xenien, Balladen
- Wallenstein
- Übersiedlung nach Weimar. Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans
- Fernere dramaturgische Tätigkeit. Die Braut von Messina
- Wilhelm Tell. Neue Pläne und Aussichten
- Letzte Lyrik. Demetrius. Ausgang.
- Literarische Übersicht.
- Impressum