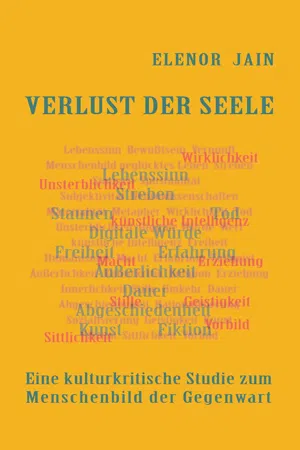![]()
Dritter Teil
DIMENSIONEN DER SEELISCHEN ENTFALTUNG
![]()
I. Die Entfaltung der Seele als Fundament menschlichen Seins
Es wurde versucht zu zeigen, welche Bedeutung der Seele des Menschen zukommt. Daran muß sich konsequent die Frage anschließen, wessen Aufgabe es denn sei, einen Prozeß der „Entfaltung der Seele“ anzuregen und wie dies zu geschehen habe. Der Mensch allein wird von sich aus nur selten dazu in der Lage sein, so daß eine Einwirkung von außen plausibel erscheint. Sind es die Bildungsinstitutionen, sind es Vorbilder oder die Familie? Ganz sicher müssen diese zusammenwirken, um irgend etwas im Menschen zu bewegen, was die Tätigkeit der Seele und ihre Kräfte wirksam werden läßt. Wenn nämlich, wie der Titel unserer Überlegungen verspricht, von einem Verlust der Seele aufgrund der bereits beschriebenen Veränderungen in der Lebenswelt ausgegangen werden kann, so verbindet sich mit diesem kritischen Axiom gleichzeitig auch die Hoffnung, diesem Prozeß entgegensteuern zu können. Die Wendung vom Verlust der Seele legt schließlich nahe, daß sogar von der Auflösung des Individuums gesprochen werden kann, weil die Seele das Eigentliche des Menschen, sein Wesen, ausmacht. Ohne die Vitalkraft der Seele verkümmert das menschliche Wesen, denn es entbehrt jener Instanz, die als Korrektiv alles Denken und Handeln bestimmt. Daher ist das Individuum, jeder einzelne, gefordert, sein Inneres zu entdecken und zu entfalten, um das Menschliche, sein eigentliches Wesen zu hervorzuheben und zu erhalten.
Die folgenden Gedanken konzentrieren sich dementsprechend auf Bedingungen und Möglichkeiten, die sich in Kunst, Kultur, aber auch im erzieherischen Bereich finden lassen. Es handelt sich dabei um geistige Gehalte unserer Lebenswelt, die einen besonderen Einfluß auf die menschliche Psyche besitzen und zu der bereits erwähnten und notwendigen „Umkehr“ führen können.
1
Die Erziehungswissenschaften setzten sich immer schon zum Ziel, den Educandus zu fördern, indem sie ihm Wissen und Bildung zu vermitteln suchten. Allerdings sind diese Ziele im Laufe der Zeit ständig modifiziert und ihre Inhalte und Methoden einer neuen Sichtweise angepaßt worden. Einmal ging es um Allgemeinbildung, dann um Förderung rein naturwissenschaftlicher Kompetenzen und schließlich auch um die Effizienz der pädagogischen Einwirkung in Bezug auf den Arbeitsmarkt.109 Heute stellt man fest, daß der Allgemeinbildung nicht mehr allzuviel Raum gewährt wird, während an ihre Stelle die Aus- oder Berufsbildung getreten ist, die für die Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt befähigen soll. So ist auch das Erlernen der alten Sprachen oder die musische Bildung zugunsten neuer Techniken ins Hintertreffen geraten, weil deren Nutzen für das alltägliche Leben nicht mehr erkannt wird. Es gibt also eine Vielzahl von Bildungstheorien, die sich teilweise sogar widersprechen und zu erheblichen Verunsicherungen durch ständige Paradigmenwechsel führen. Clemens Menze hat sich im Rekurs auf den bekannten Pädagogen Theodor Litt schon in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zur Berufs- bzw. Allgemeinbildung geäußert und dabei auch den Littschen Begriff der „Menschenbildung“ untersucht, der zugleich auch immer mit Nachdruck angesichts der fortschreitenden Technik mit Humanität bzw. anthropologischen Grundfragen in Verbindung gebracht wird. Menze erläutert zunächst den humanistischen Grundgedanken der Pädagogik, daß nämlich „eine reine, und das heißt eine nicht von spezifischen, auf Abrichtung und Außensteuerung gerichteten Zwecken durchwirkte Bildung erforderlich“ sei, die
„den Menschen selbst erst zum Menschen werden läßt, ehe er sich auf die Wechselfälle des Lebens einlassen darf. Sinn und Zweck einer solchen Bildung ist es, den Menschen zu ertüchtigen, sich jederzeit von den von außen ihn bestimmenden Inanspruchnahmen zu lösen, sich auf sich selbst zurückzuwenden und in der eigenen Menschheit steigern zu können “.110
Weshalb dieses humanistische Konzept zunächst so überzeugend klingt, wird zwar im folgenden erläutert, aber Litt hat es offensichtlich bereits als nicht mehr der Zeit entsprechend kritisiert. Denn die Behauptung sei nicht haltbar, daß das Ausklammern des Berufs aus dem Innenbereich des Bildungsprozesses deshalb sinnvoll sei, weil bloße Aus- oder Berufsbildung „die Tendenz hat, den Menschen an einen Ausschnitt von Welt, seine Berufswirklichkeit, zu binden, und ihn so, statt ihn sich entfalten zu lassen, zu einem im Prinzip austauschbaren Element des Fortschritts funktionalisiert und ihm mit seiner Würde und Freiheit seine Individualität zu nehmen droht“.111
Wenn der Humanismus also als Abwehrmechanismus gegen Verwissenschaftlichung und Rationalisierung aller Lebensbereiche verstanden werde, die zudem die Funktionalisierung des Menschen unterstützen, so sehe Litt in dieser Auffassung eine polemisch abschätzige Beurteilung seiner Zeit „mit der blinden Bekämpfung der sie prägenden Kräfte, vor allem der Naturwissenschaften, in Verkennung der Wirklichkeit des Menschen…“.112 Nun war Litt zu seiner Zeit noch in keiner Weise mit den inzwischen bekannten technischen Auswüchsen konfrontiert, so daß seine Kritik vielleicht berechtigt und angemessen war, als die Naturwissenschaften sich noch nicht in die Lage versetzt hatten, mit ihren Erkenntnissen eine ganz andere Macht über den Menschen auszuüben, als es der Humanismus je gekonnt oder gewollt hatte. Erhebliche Nachwirkungen hatte solche Kritik allerdings im erziehungswissenschaftlichen Bereich, was in der Folgezeit eine Glorifizierung der Wissenschaften und eine deutliche Abkehr von humanistischem Gedankengut hervorrief.
Es ist allerdings bekannt, daß Theodor Litt, grundsätzlich der Hegelschen Dialektik folgend, seine Euphorie für die Wissenschaften sogleich auch wieder revidiert und die andere Seite der Medaille ins Auge faßt. Menze ergänzt daher Litts anfängliches Plädoyer für die Wissenschaften mit dessen Worten, daß die Wissenschaften wohl die Besonderheit des Menschen vernachlässigten, so daß die Differenz zwischen Mensch und Sache verschwinde. Diese Kritik klingt modern und heute zeitgemäß, vor allem wenn es weiter heißt, daß der alles rationalisierende Zugriff nur noch „das Funktionale, das Berechenbare, Planbare, Austauchbare“ am Menschen gelten lasse. Dies laufe auf eine „Entpersönlichung des Subjekts“ hinaus, denn in der „Einschränkung auf den rechnenden, alles quantifizierenden Verstand“ werde die Eigentümlichkeit und das Besondere des Menschseins verfehlt. Litt konzediert also, daß die Rationalität sich „wider das Individuum kehrt“ und damit sogar gegen „die Kraftquelle, aus der sie selbst lebt“.113
Es wird weiterhin deutlich, daß die Gegenwartsanalyse Litts schließlich eine resignative Einschätzung erkennen läßt, denn er merkt an, daß der Mensch offensichtlich keine Entscheidungsfreiheit zwischen der Akzeptanz des wissenschaftlichen Fortschritts und einer auf den Menschen selbst bezogenen Entwicklung besitzt. Immerhin bemüht Litt sich daraufhin, eine Synthese vorzuschlagen, in der keine der Strömungen absolut zu setzen sei. Dies setze voraus, einerseits den „blinden Rationalisierungsprozeß zu domestizieren“, und ihn andererseits „in das Ganze des Menschen zurückzuholen“.114
Litt rekurriert nun auf die einsichtige menschliche Vernunft, wenn er erwartet, daß der Mensch sich der Bedrohung bewußt werde, die die „Entseelung“ des Menschen durch den wissenschaftlichen Fortschritt nach sich zieht. Diese idealistische und auch weltfremde Einschätzung wird der Lage jedoch kaum mehr gerecht. Überzeugend allerdings ist seine Forderung, daß Humanität und technischer Fortschritt in ihrer „unaufhebbaren Spannung“ grundsätzlich zusammenwirken müssen. Die Frage bleibt jedoch, welche Strömung sich schließlich durchsetzen wird und vor allem, welche Entscheidungsfreiheit dem Menschen überhaupt noch zugestanden werden wird.
Wenn also Wissen und Spezialisierung zum Lebenserhalt notwendig und sinnvoll sind, so ist es zumindest ebenso notwendig, anthropologische Grundeinsichten nicht aus dem Blick zu verlieren. Schon deshalb ist letzteres notwendig, weil immer die Gefahr besteht, daß wissenschaftliches Denken und Handeln sich zum Maßstab des menschlichen Lebens erheben und dieses unter Ausschluß des menschlichen Wesens und seiner elementaren Menschenrechte beherrschen. Es gilt also, die Forschung in den Lebenszusammenhang mit all seinen Facetten zu integrieren und diesen als Priorität zu begreifen. Mit dieser Forderung ist nicht zuletzt die Forderung nach Reflexion und Verantwortung verbunden, denjenigen „Tugenden“ also, die ganz konkret zur Lösung des Problems beitragen können. Litt glaubt an die Kraft dieser Aspekte und bemerkt: „Wir Menschen des gegenwärtigen Zeitalters …müssen Philosophen werden, wenn wir nicht zu politischen Analphabeten herabsinken wollen“. 115
Eine bevorzugte Stellung der Naturwissenschaften wurde eine Zeitlang im Bildungskanon der Erziehungswissenschaften aufrechterhalten. Aber es gab nicht nur Einwände anderer Erziehungswissenschaftlicher, die einen neuerlichen Richtungswandel ankündigten, sondern auch pädagogisch bewanderte Philosophen, die ihre Auffassungen weder der einen noch der anderen Strömung angepaßt haben. Ihr Bildungsgedanke orientierte sich vielmehr an philosophischen Erkenntnissen, denen sie eine zeitübergreifende Gültigkeit attestierten. Zu diesen zählt der bereits erwähnte O.F. Bollnow, aber auch Karl Albert, auf dessen philosophisch-pädagogische Vorstellungen wir im folgenden eingehen möchten.
2
Karl Albert hat kein systematisches Konzept für das Curriculum der praktischen Pädagogik vorgelegt, denn sein Anliegen war vielmehr, der pädagogischen Theorie in Erinnerung zu rufen, daß neben der Wissensvermittlung vor allem die geistigen Fähigkeiten des jungen Menschen zu entfalten und zu fördern seien. Albert bezeichnet in diesem Zusammenhang daher das ´Innen´, die ´Innerlichkeit´ des Menschen als denjenigen Ort, der für die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit zuständig sei. Die Entfaltung der inneren Fähigkeiten ist nach Albert zwingend notwendig, damit der Mensch zur Selbstverwirklichung und Orientierung in der Welt fähig werde.
In vielen seiner Schriften stellt Albert eine Beziehung zwischen der Philosophie und der Pädagogik her, wobei er die historischen Grundlagen mit ihren recht verschiedenartigen Ansätzen und Inhalten vor Augen führt. Einschlägige Belege für seine eigene Vorstellung einer philosophischen Pädagogik erhalten wir sowohl in seiner Schrift über die philosophische Pädagogik116, als auch in verschieden anderen Publikationen, die sich z.B. mit der Kunst, der Literatur oder Musik befassen. Auf die zentralen Gedanken seiner Überlegungen werden wir uns im folgenden beziehen, denn sie machen einen spezifischen Standpunkt deutlich, der in unserer Gesellschaft in Vergessenheit geraten ist.
Wie schon zuvor erwähnt, ist Alberts Denken stark geprägt von platonischem Gedankengut, welches seinen eigenen philosophischen Ansatz grundsätzlich trägt und auch seine pädagogischen Überlegungen maßgeblich bestimmt. Von der Voraussetzung ausgehend, daß ein nichtphilosophisches Leben sich von einem philosophischen (also reflektierten) fundamental unterscheide, nimmt Albert konsequenterweise an, daß das menschliche Wesen sich auch dementsprechend charakterisieren lasse. Eine philosophische Lebensweise kann nach Albert nur durch ein philosophisches Denken erreicht werden, welches durch das Bedürfnis nach Erkenntnis entstehe. Diese Erkenntnis liegt für ihn in der „Seinserfahrung“,117 die er im philosophischen Denken seit der Antike vorfindet, beschreibt und in seine eigene Konzeption integriert. Die Beschränkung auf diesen metaphysischen Bezug hat allerdings auch Kritik hervorgerufen, die sich vor allem gegen eine Art von „Letztbegründung“ wendet. Da es hier primär, auch im Sinne Alberts, aber um ein reflektiertes Denken und Leben an sich geht, spielt dieses in unseren Überlegungen die wesentlichere Rolle. Philosophische Reflexion betrachten wir daher als Erkenntnis und Erfahrung des eigenen Ich und des Gesamt menschlicher Existenz. Ein solch bewußtes und tiefergehendes Denken bewirkt eine ´Horizonterweiterung´, die sich im Alltag bewährt, indem eine Offenheit für das Andere, das Fremde und bislang Unverstandene eintritt. Das Denken konzentriert sich auf diese Weise nicht mehr nur auf sein eigenes ´Ich´ und seine Bedürfnisse, sondern fügt dieses Ich in den Gesamtzusammenhang alles Seienden (auch der Natur) ein. Dadurch verschieben sich auch die Prioritäten, die der Mensch sich im Blick auf seine eigenen Bedürfnisse gesetzt hat: vieles zuvor Wichtige verliert an Bedeutung, anderes, zuvor nicht Beachtetes, gewinnt an Bedeutung. Es findet eine Wert- und Sinnverschiebung (auch im ethischen Bereich) statt, die durch reflektiertes Denken entsteht.
Albert bemerkt in diesem Zusammenhang, daß erzieherische Einwirkung mit dem Ziele der Entfaltung des zu Erziehenden nur dann erfolgreich sein kann, wenn eine grundsätzlich affirmative Haltung zum Leben und der Welt vorhanden sei, auch wenn gewisse Zustände in der Welt dem widersprechen. Gemeint ist damit auch, daß der Respekt vor dem Leben an sich als Basis für ein sinnvolles Leben vorausgesetzt ist: denn „das Ziel der Erziehung ist ja die Menschwerdung des Menschen, d.h. die Verwirklichung des Wesens des Menschen“.118 Das Wesen des Menschen offenbart aber sein Selbst, und Albert weist schon in der Antike nach119, daß dieses ´Selbst´ im Kreise der Platoniker mit der ´Seele´ identisch ist, deren Erkenntnis und Bedeutung für das menschliche Leben hervorgehoben werde.120 Eine Gleichsetzung von Selbst und Seele finde sich ferner u.a. bei Cicero und schließlich auch bei Hegel, der in seiner „Phänomenologie des Geistes“ darauf eingeht, wobei die Seele im übri...