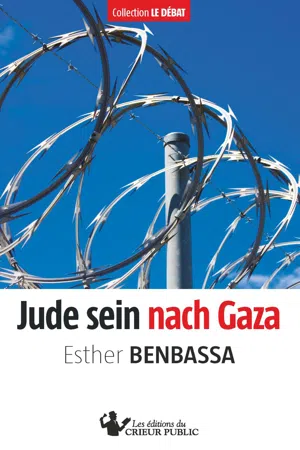![]()
III
DIE WAHRE RELIGIOSITÄT der heutigen Juden liegt in der Heiligkeit, die sie Israel zusprechen, und in der Inbrunst, mit der Israel sie erfüllt. Von diesem Land erwartet man alles, man liebt es blind, und in der Diaspora ist man bereit, es mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, auch gegen handfeste Beweise. Die Israelis sind Helden, die für „uns“, für die Juden in der Diaspora, Amalek bekämpfen, diesen zeitlosen biblischen Feind, der nun durch die Palästinenser verkörpert wird, deren unschuldige Opfer die Israelis sind.
Seit den 1970er-Jahren schlüpften die Israelis allmählich in eine Opferrolle. Die 1977 an die Macht gekommene rechtsgerichtete Regierung unter Ministerpräsident Menachem Begin stellte den Holocaust ins Zentrum ihres politischen Kredos, um auf diese Weise die Gebietsbesetzungen zu rechtfertigen. Unmerklich wandelte sich Israel von dem Land, das gegründet worden war, um den Überlebenden der grausamen Verfolgung Zuflucht zu gewähren, zu einer Kolonialmacht, wobei bereits erstgenannter Status eine Rekonstruktion darstellt. Denn die Gründung des Staates Israel war ja zu allererst durch den Zionismus ermöglicht worden, also durch eine im Kontext anderer Nationalismen des 19. Jahrhunderts entstandene nationalistische Bewegung, unabhängig vom Holocaust, der die Staatsgründung nur beschleunigt hatte. Paradoxerweise erfolgte der Wandel zur Kolonialmacht aber gerade im Namen des Holocaust und in der Absicht, dessen Wiederholung zu verhindern.
Die erzwungene und/oder freiwillige Ausreise hunderttausender Palästinenser bei der Gründung des israelischen Staats wurde verschwiegen, keine Katastrophe – „Nabka“, wie die Palästinenser dieses Ereignis nennen – kann dem Vergleich mit dem Holocaust standhalten. Selbstverständlich sind der Völkermord an den Juden und die „Nakba“ der Palästinenser zwei ganz verschiedene Ereignisse, was ihren Kontext, ihre Natur, ihren Verlauf und ihre Folgen betrifft. Die Palästinenser nahmen ihre „Katastrophe“ dennoch als Genozid wahr und so lebt sie in ihren Phantasien und Erinnerungen weiter. Während des 2. Weltkriegs wurde in Palästina, das damals noch unter britischem Mandat stand, das traditionelle hebräische Wort „Hurban“ (= „Ruine, Zerstörung, Katastrophe“) verwendet, um das zu benennen, was den Juden in Europa widerfuhr. Erst später, am 12. April 1951, führte das israelische Parlament hierfür offiziell den seinem Wesen nach religiösen Begriff „Shoah14 “ ein, der auch Passivität ausdrückt. In der Folge trug das dazu bei, die qualvollen Leiden, die die Juden während des 2. Weltkriegs erlitten hatten, zu verabsolutieren und damit jede andere vergangene oder auch zukünftige Katastrophe in den Schatten zu stellen.
Lange Zeit bemühte sich Israel bei jedem Konflikt, seine Soldaten als Helden zu glorifizieren. Nach dem Sechs-Tage-Krieg übernahmen die Opfer des Genozids, denen bisher nur geringe soziale Beachtung zuteil geworden war, diese Rolle. Der Eichmann-Prozess im Jahr 1961 hatte dazu beigetragen, sie ins Zentrum gesellschaftlicher Aufmerksamkeit zu rücken. Die Kämpfer stiegen nach und nach von ihrem Sockel, während die Opfer zu neuen Helden aufgebaut wurden. Damit begann die Ära der Opfer, die die Besetzung palästinensischer Gebiete zu einer Notwendigkeit für das Überleben Israels machte. Nun war die Kolonisierung natürlich kein moralisches Unterfangen und die israelischen Regierungen waren gewiss nicht so naiv, dies zu glauben. Allerdings erhielt die Kolonisierung einen moralischen Anstrich, wenn ihr erklärtes Ziel die Vermeidung eines zweiten Holocaust und somit ein dauerhafter Schutz für die Opfer war. Alles war dem Streben nach Sicherheit unterzuordnen. Der – zumindest militärisch – mächtigste Staat des nahen Ostens kämpfte um sein Überleben. So wurde die Okkupation in den Augen der internationalen Öffentlichkeit, der Juden in der Diaspora und der Israelis zu einem „tugendhaften“ Unterfangen. Ja, das Recht stand auf ihrer Seite, auf der Seite der ewigen Opfer, und nicht auf der Seite der heutigen Opfer, der Palästinenser, die nicht nur vertrieben und in Flüchtlingslager gepfercht worden waren, sondern die nun auch Besetzung und Kolonisierung erdulden mussten. Unter diesen Opfern, denen man ihr Opfer-Sein abgesprochen hatte, wurden später die „Märtyrer“, rekrutiert, lebende Sprengkörper, bereit, Israelis – besonders israelische Zivilisten – wahllos umzubringen und entschlossen, sich auch selbst zu töten.
Haben sich die Opfer von gestern – die Juden, die Unterdrückung, Massaker und Verfolgung erlitten haben – in Täter verwandelt? Erzeugen sie palästinensische Opfer, die selbst wiederum zugleich Opfer und Täter sind? Diese widernatürliche Verkettung macht ein Zusammenleben in einem Gebiet, auf das beide Völker in unterschiedlich ausgeprägter Legitimität Anspruch erheben, unmöglich. Sie annulliert und zerstört jede Ethik. Selbst wenn es eine Ethik gäbe, die sich dem Wahn des Nationalismus widersetzen könnte. Im Nahen Osten wütet noch immer dieser Wahn, diese zerstörerische Kraft, auf die sich die modernen Nationalstaaten gründen, diese Brutstätte der Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts.
Wenn man der äußerst gewandten Kommunikation Israels glaubt, so liegt alle „Schuld“ bei den Palästinensern: sie waren es ja, die die von den Israelis angebotenen Bedingungen für eine Friedenslösung nicht akzeptiert haben. Bedingungen, die freilich auch unakzeptabel sind. Zwischen Mythos und Legende, Ideologie und Propaganda, den arabischen Feind nicht vom palästinensischen Feind unterscheidend – so präsentiert sich Israel weiterhin als ein Land, dessen Existenz ständig bedroht ist. Auf diese Weise verstärkt Israel einerseits das Schuldgefühl, das die internationale Öffentlichkeit verinnerlicht hat – ganz besonders in Europa, wo die Nazi-Verbrechen ja stattgefunden haben – und sichert andererseits auch seine eigene Immunität. Pressure-groups, jüdische Institutionen in der Diaspora, Medien, Diplomaten, organische Intellektuelle15 stellen sich erfolgreich in den Dienst dieser Aufgabe, wobei sie mitunter zu Mitteln der Einschüchterung greifen. Diejenigen, die dieses Schwarz-Weiß-Schema nicht akzeptieren wollen – auf der einen Seite die unschuldigen Israelis, auf der anderen Seite die mörderischen Palästinenser – stellen ihren guten Ruf aufs Spiel. Als letzte Waffe wird den Zweiflern der Vorwurf des Antisemitismus entgegen geschleudert. Und ein Antisemit ist heutzutage ein Paria.
Was ganz und gar nicht bedeuten soll, dass der Antisemitismus endgültig ausgerottet wäre. Im Gegenteil: der heute in westlichen Ländern auftretende Antisemitismus findet im israelisch-palästinensischen Konflikt ein Alibi. Laut „Weltforum zur Bekämpfung des Antisemitismus“ nahm er während der Operation „Gegossenes Blei“ drastisch zu. Die Anzahl antisemitischer Aggressionen während dieses Konflikts war drei Mal so hoch wie in derselben Zeitspanne des Vorjahres16.
Kein Rassismus, auch nicht der, der im Kleide des Antisemitismus auftritt, hat irgendeine „Legitimität“. Ganz Im Gegenteil, er ist das offenkundige Zeichen dafür, dass eine Gesellschaft oder eine Gruppe krank oder zumindest geschwächt ist und nicht in der Lage, ihre Unterschiede oder ihre Niederlagen zu akzeptieren. Er ist kein Heilmittel, sondern eine Symptombehandlung, eine Symptombehandlung für Länder, die ihre wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten nicht bewältigen können und die sich, wie es viele islamische Staaten tun, der Juden und der Israelis bedienen, um ihre Bevölkerung von ihren wahren Problemen „abzulenken“. Dort machen dann die „Protokolle der Weisen von Zion“ Furore. Ihr Inhalt – jüdische Weltherrschaft und jüdische Weltverschwörung – wird für bare Münze genommen, während er doch nichts ist als Propaganda und Wahnidee. Keinerlei Erklärung des Palästinenserproblems findet sich darin, auch kein Lösungsvorschlag für den Konflikt. Derartige Machwerke vertiefen nur den Graben zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Arabern und Juden, zwischen Juden und Muslimen.
Wenn Rassismus und Antisemitismus im Westen auch nicht übermächtig sind, so ist doch nicht zu übersehen, dass der Antisemitismus seit Beginn der Zweiten Intifada wieder deutlich zugenommen und seit Beginn der Gaza-Offensive eine neue und noch komplexere Form angenommen hat. Ein trauriges Paradox, wenn man bedenkt, dass die Entwicklung des Zionismus als Ideologie eine Reaktion auf den virulenten Antisemitismus des 19. Jahrhunderts darstellte und dass sein Ziel gerade darin bestand, die Juden durch die Gründung eines eigenen Staates zukünftig vor Antisemitismus zu bewahren. Früher war Israel ein symbolisches Bollwerk, das die Juden in der Diaspora vor dem gegen sie gerichteten Hass beschützen wollte. Doch nun liefert es selbst Tag für Tag neue – selbstverständlich trügerische – „Rechtfertigungen“ für den grassierenden Antisemitismus und beschwört damit eine neue Gefahr für die Juden herauf, die es doch zu schützen beabsichtigt. Israels übermäßige Forderungen schädigen das Bild der Juden in der Diaspora. In diesen Forderungen werden Juden und Israelis – absichtlich oder unabsichtlich – in ungebührlicher Weise gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung ist zwar nicht wünschenswert, hat aber doch auch einen guten Grund. Die Juden der Diaspora identifizieren sich so sehr mit Israel und wenden sich entschieden gegen alles, was an Negativem über Israel gesagt wird – und zwar auch dann, wenn einzelne Vorwürfe nicht ungerechtfertigt sind. Lässt sich unter solchen Umständen denn vermeiden, dass sich im Denken derer, die diesen Mechanismus nicht besser verstehen, sondern die geschilderte Dynamik ausnutzen wollen, diese Gleichsetzung ganz unwillkürlich einstellt?
In der Rhetorik der jüdischen Institutionen und ihrer Intellektuellen wird das Thema „Antisemitismus“ zudem benutzt, um die verheerenden Auswirkungen, die Israels erbarmungsloser Krieg gegen die Palästinenser in der öffentlichen Meinung hat, abzumildern. Man sollte nicht unterschätzen, wie schädlich ein derartig problematischer Gebrauch dieses Themas ist. Und was soll man von der Art und Weise halten, in der Ariel Sharon sich während der Zweiten Intifada zynisch dieses Themas bediente, in der Hoffnung, die französischen Juden zu einem Zeitpunkt, als die Einwandererströme von russischen und äthiopischen Juden zu versiegen begannen, zur Emigration nach Israel zu bewegen?
Kein anderer Konflikt löst so viele Kommentare aus, regt zu so vielen Stellungnahmen an und genießt so große mediale Aufmerksamkeit wie der zwischen Israelis und Palästinensern. So, als ob die Augen der ganzen Welt auf dieses winzig kleine Stück Land gerichtet wären, das in der Geschic...