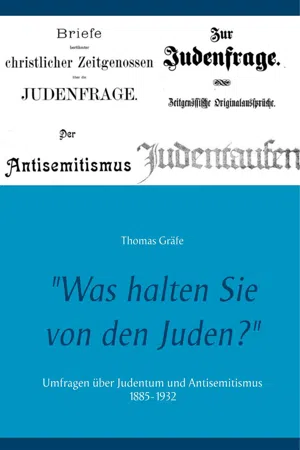
eBook - ePub
"Was halten Sie von den Juden?"
Umfragen über Judentum und Antisemitismus 1885-1932
- 104 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Zwischen 1885 und 1932 wurden von deutschen und österreichischen Journalisten acht umfangreiche Intellektuellenbefragungen zu den Themen Judentum und Antisemitismus durchgeführt. Sie ermöglichen es, nachzuvollziehen wie sich im Bildungsbürgertum die Haltung zum Antisemitismus und die Vorstellungen vom Zusammenleben von Mehrheit und Minderheit zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik veränderten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu "Was halten Sie von den Juden?" von Thomas Gräfe im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Umfragen im Kaiserreich
Die Intellektuellenbefragungen Isidor Singers (1885) und Carl Klopfers (1891)
In Mitteleuropa gelang es dem Antisemitismus, sich Anfang der 1880er Jahre als politische und soziale Bewegung zu etablieren. In Deutschland erregten die neuen antisemitischen Parteien und Vereine unter anderem durch den Berliner Holprediger Adolf Stoecker eine breite mediale Aufmerksamkeit, ohne allerdings nennenswerten politischen Einfluss zu gewinnen. Dramatischer gestaltete sich die Situation in Österreich-Ungarn. Durch das Linzer Programm von 1882 entstand ein parteipolitisches Drei-Lager-System aus Christlichsozialen, Deutschnationalen und Sozialdemokraten, während der politische Liberalismus vollständig erodierte. Christlichsoziale und Deutschnationale beherrschten mit ihren charismatischen Führern Karl Lueger und Georg von Schönerer bis zur Reichsratswahl von 1911 die politische Szenerie Deutschösterreichs und verbreiteten einen radikalen Antisemitismus. Auch in den slawischen Landesteilen koppelte sich die Judenfeindlichkeit gleichermaßen an den politischen Katholizismus und an die nach Autonomie strebenden Nationalbewegungen.30
Der Wiener Journalist Isidor Singer (1857-1921) stellte seine im Frühjahr 1884 begonnene Intellektuellenbefragung explizit in den Kontext der Abwehr des Antisemitismus. Hinter den judenfeindlichen Agitatoren vermutete er Klerus, Adel und bürgerliche Reaktion, die versuchten, den „Straßenpöbel“ gegen den Liberalismus zu vereinnahmen. Besonders scharf polemisierte er gegen den ultramontanen Katholizismus in Österreich und den konservativen Protestantismus in Deutschland, in denen er durchaus treffend die damaligen Hauptträgerschichten des Antisemitismus beider Länder ausmachte.31 Intelligente Kreise der Bevölkerung hoffte Singer, mit Aufklärungsarbeit immunisieren zu können. Da die Juden in dieser Angelegenheit als parteiisch eingestuft würden, sollten ausschließlich christliche Gelehrte ihr Gewicht gegen den Antisemitismus in die Waagschale werfen. Das Vorbild lieferte Mommsens Notabelnerklärung vom November 1880. Dass die „Judenfrage“ durch Assimilation zu lösen sei, war für Singer eine Selbstverständlichkeit. Die „Wiederherstellung eines nationaljüdischen Reiches“ bezeichnete er als „frommen Wahnsinn“. Nach der Emanzipation hätten die Juden die einmalige Chance, ihre 2.000-jährige Ghettoexistenz hinter sich zu lassen und am Kulturfortschritt der Menschheit teilzuhaben. Es gehe nicht darum, anderen zu gefallen, sondern sich selbst zu verbessern. So würden sich die Juden in Österreich-Ungarn auch dort an der überlegenen deutschen Kultur orientieren, wo sie unter den slawischen Völkern lebten, die selbst noch „Schüler der europäischen Culturgemeinschaft“ seien.32
Singer und seine Umfrageteilnehmer gehörten einer Generation an, die politisch von der Revolution 1848/49 geprägt war. Die „Judenfrage“ war für sie Teil der Auseinandersetzung zwischen Liberalismus und Konservatismus, Fortschritt und Reaktion, vernünftiger Religiosität und Dogmenfrömmigkeit. Sie neigten dazu, Aufklärung und Bildung in ihren Wirkungsmöglichkeiten zu überschätzen, während sie mit den Strukturen des politischen Massenmarktes fremdelten. Der Antisemitismus war ihnen allein schon deshalb suspekt, weil er auf die Instinkte der ungebildeten Massen setze. Er wurde von den Intellektuellen einhellig als „Verrohung“ und „Verdummung“ verurteilt33, doch nicht in der von Singer erhofften Deutlichkeit. Viele Intellektuelle schoben den Juden eine Mitschuld an der Entstehung des Antisemitismus zu. Ihre negativen „Volkseigenthümlichkeiten“ seien noch nicht überwunden. Der Schriftsteller Dagobert von Gerhard sprach von „Taktlosigkeit und Anmaßung“, der Philosoph Eduard von Hartmann kritisierte die „nationale Stammessolidarität“ der Juden und der Pfarrer Julius Karl Reinhold Sturm hielt sie für aufdringliche Wucherer.34
Alle Befragten sprachen sich für die Assimilation aus. Diese verstanden sie im Unterschied zu Singer aber nicht als angleichende Akkulturation, deren Ausmaß und Ziel die Juden selbst bestimmen könnten. Der Schweizer Kunsthistoriker Johannes Scherr betonte, dass man nicht „Nationaldeutscher“ werden und doch „Nationaljude“ bleiben könne. Der tschechische Journalist Erwein Spindler kritisierte, dass die Juden in Böhmen mit den Deutschen paktierten, obwohl sie unter Tschechen lebten.35 Die Zielvorstellung war das Aufgehen des Judentums in der Mehrheitsgesellschaft, im Christentum, in einer konfessionslosen Vernunftreligion der Zukunft oder im allgemeinen Menschentum. Vorherrschend war also die integrationalistische Variante. Während die Intellektuellen dem Historiker Ferdinand Gregorovius folgend das biblische und antike Judentum in höchsten Tönen priesen, erachteten sie das Judentum der Gegenwart als überflüssiges Fossil. Die protestantischen Geistlichen nutzten die Umfrage, um für die Judenmission zu werben.36 Die religionskritischen oder religiös indifferenten Intellektuellen mochten die Taufe hingegen nicht empfehlen. Für den katholischen Reformtheologen Jacob Frohschammer bedeutete der Eintritt der Juden ins Christentum den sinnlosen Wechsel von einer Orthodoxie in eine andere. Der Schriftsteller Robert Springer setzte auf den Siegeszug der liberalen Theologie, die Judentum und Christentum ohnehin angleichen werde. Der Mediziner Emil du Bois-Reymond gab zu bedenken, dass es den Antisemiten um die Rasse gehe, weshalb die Konversion den Juden nichts nütze.37 Daher erschien den Befragten die Konfessionalisierung des Judentums als akzeptables Zugeständnis.
Singers Intellektuellenbefragung wurde in der Öffentlichkeit allgemein als „judenfreundlich“ wahrgenommen und setzte die Antisemiten unter Zugzwang. Carl Klopfer (1865-1937) führte für den Münchener Lehmann-Verlag eine tendenziell judenfeindliche Gegenumfrage durch. Die Antisemiten nutzten zwar die Gelegenheit, die Judenemanzipation als schädlich zu geißeln. Jedoch wusste kaum jemand, eine Alternative zur allmählichen Angleichung der Juden an die Mehrheitsgesellschaft zu benennen. Der Historiker Otto Henne betonte, dass es nicht angehe, die Juden „aus der Gemeinschaft des Volkes, zu dem sie staatsrechtlich und sprachlich gehören, hinauswerfen zu wollen“. Sein Berufskollege Gustav Glogau ermahnte die Antisemiten, konkrete Reformvorschläge vorzulegen, anstatt sich „in unmöglichen Vorstellungen zu berauschen“. Mit Ausnahme eines Grenzschlusses für Ostjuden, fielen den von Klopfer befragten Antisemiten aber kaum realisierbare Diskriminierungspläne ein. Manche konzentrierten sich bei der Bekämpfung des „Jüdischen“ gar auf die Mehrheitsgesellschaft. So wollten der Kunsthistoriker Wilhelm Bode „jüdische“ Charakterschwächen der Deutschen und der Komponist Gustav Kastropp die jüdischen Wurzeln des Christentums ausmerzen. Den „echten“ Juden empfahlen die meisten Beiträger die Assimilation. Der Innsbrucker Philosophieprofessor Karl Ueberhorst erkannte die „Judenfrage“ in der Zugehörigkeit von zwei verschiedenen Rassen zu demselben Vaterland. Die Lösung liege in der Verschmelzung der Rassen, weshalb Mischehen eine patriotische Pflicht seien.38 In einer Nachlese kam der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger zu dem Schluss, dass sich 47 der 90 Befragten gegen den Antisemitismus ausgesprochen hätten.39 Die Antisemiten führten das unerwartete Ergebnis darauf zurück, dass die Intellektuellen mit Rücksicht auf die „jüdische Pressemacht“ nicht ihre wahre Meinung gesagt hätten.40 Tatsächlich dürfte ein ganz anderer Umstand ausschlaggebend gewesen sein. Singer und Klopfer waren mit dem Versuch gescheitert, eine anti-antisemitische bzw. antisemitische Position einseitig durchzusetzen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die integrationalistische Assimilation gleichzeitig gegen Juden und Antisemiten richten konnte – gegen die Juden, weil sie assimilationsunwillig seien, gegen die Antisemiten, weil sie die Assimilation behinderten. Die Assimilation galt für fast alle Beteiligten als alternativlos, gestritten wurde lediglich darüber, wie weit sie gehen sollte. Dieses Bild bestätigte sich in der nächsten Umfrage.
Die Intellektuellenbefragung von Hermann Bahr 1893-94
Die Umdeutung von Korruptionsskandalen in jüdische Verschwörungen wurde im späten 19. Jahrhundert zu einem Klassiker antisemitischer Agitation. Das Grundmuster hierfür lieferte die Affäre um den Bau des Panama-Kanals. In Frankreich hatte die Kanalgesellschaft Parlamentarier und Minister bestochen, um das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Bauprojekt zu retten. Seit 1892 nutzte der Journalist Édouard Drumont die Beteiligung jüdischer Bankiers, um den Skandal in eine jüdische Verschwörung umzudeuten. Seine Zeitung La labre Parole erzielte auf dem Höhepunkt des Panama-Skandals eine Auflage von 200.000 Exemplaren. In Deutschland hatte sich zur selben Zeit Hermann Ahlwardt auf einen antisemitischen Enthüllungsjournalismus spezialisiert. Er deckte zahlreiche vermeintliche Skandale auf, in denen korrumpierende jüdische Kapitalisten die Hauptrolle spielten. Obwohl Ahlwardt wegen seiner haltlosen Verleumdungen als unseriöser „Radauantisemit“ verschrien war, erzielte er mit seiner Agitation eine beachtliche mobilisierende Wirkung und mediale Aufmerksamkeit.41 Die Antisemiten perfektionierten ihre Agitation, bestimmten das Meinungsklima aber nicht alleine. Anders als in den Jahrzehnten zuvor stießen sie nun auf eine organisierte zivilgesellschaftliche Gegenwehr: Die Alliance Israélite Universelle in Frankreich, den Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Deutschland und den Verein zur Abwehr des Antisemitismus in Deutschland und Österreich.42
Über den Panama-Skandal und Ahlwardts „Enthüllungen“ hatte der österreichische Journalist und Literaturkritiker Hermann Bahr (1863-1934) ausführlich für die Wiener Deutsche Zeitung berichtet. Dies inspirierte ihn zu einer Interviewserie über den Antisemitismus, für die er 43 Gespräche mit deutschen, französischen, belgischen, britischen, italienischen, spanischen und norwegischen Intellektuellen führte. Unter den Befragten befanden sich 40 Christen (darunter ein Konvertit) und drei Juden. Neun Teilnehmer gaben eine antisemitische, 29 eine antiantisemitisc...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Hinweise
- Einleitung: Die Sprache der Tiere – oder von der Kunst, aneinander vorbei zu reden
- Soziologische Grundalgen: Assimilation und ethnischer Pluralismus
- Die Intellektuellenbefragungen als Quellengattung
- Intellektuelle im Meinungsstreit über Judentum und Antisemitismus
- Umfragen im Kaiserreich
- Umfragen in der Weimarer Republik
- Epilog: Tiere können nicht sprechen
- Glossar
- Danksagung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Impressum