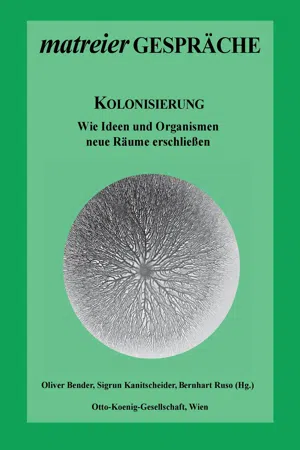![]()
Max Liedtke
Mission als Kolonisierung – Beispiele missionsgeschichtlicher Verläufe in evolutionstheoretischer und kulturethologischer Sicht
Zusammenfassung
Mission ist auch eine Form der Kolonisierung. Die christliche Mission wird hierzu als Beispiel genommen und schwerpunktmäßig nach ihrer Entwicklung im ersten christlichen Jahrtausend skizziert. Die Entwicklung stellt sich als sehr heterogen dar, je nachdem ob aus einer Minderheitensituation heraus missioniert wird oder aus einer Mehrheitssituation. Es lässt sich wahrscheinlich machen, dass Religiosität genetisch disponiert ist und schon insoweit ein Produkt der Evolution ist. Zudem lässt sich zeigen, dass alle Formen von Mission sich auch unter den Aspekten der Kulturethologie interpretieren lassen. Besonders wird herausgestellt und kulturethologisch erläutert, dass sich Inhalte und Form der Mission beider großen Kirchen nach der Aufklärung deutlich geändert haben und so Mission von einer durch fast 2000 Jahre zunächst höchst problematischen, partiell verwerflichen Einrichtung zu einer menschenrechtlich ohne Zweifel humanen und der Weltentwicklung sowie dem Weltfrieden dienenden Angelegenheit geworden ist. Es wird die Hoffnung ausgedrückt, dass dies vielleicht auch ein geschichtliches Modell für die Weiterentwicklung anderer missionierender Religionsgemeinschaften sein könnte.
1 Einführung
In der Tradition der christlichen Kirchen ist Mission der Versuch, christliches Ideengut zu verbreiten. Diese Verbreitung bedeutet zunächst, dass versucht wird, bislang Ungläubige als Gläubige zu gewinnen. Schon diese individuelle, personbezogene Verbreitung lässt sich in einem weiteren Sinn als Form einer Kolonisierung bezeichnen: Ideengut einer Person A wird auf Person B übertragen. Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang, wenn man diesen Prozess der Ideenverbreitung unter territorialen Aspekten betrachtet. Hier bedeutet Mission immer auch, das christliche Ideengut an neuen Plätzen anzusiedeln. Insoweit ist sie eine Form der Kolonisierung. Natürlich lassen sich mit leichter Hand begriffliche Unterschiede konstruieren, zum Beispiel der angenommene göttliche Auftrag der Mission oder auch die ‒ zunächst ja nur nominell gewährte ‒ freie Akzeptanz des missionarischen Angebotes. Aber auch diese konstruierten Unterschiede schließen nicht aus, dass beide Begriffe in wesentlichen Merkmalen terminologisch identisch sind. Begriffsgeschichtlich ist die Nähe beider Begriffe auch dadurch gegeben, dass die von Europa ausgegangene ‚Kolonisierung‘ Jahrhunderte hindurch häufig nicht nur von ‚Mission‘ initiiert und begleitet war, sondern auch legitimiert. Es gibt eine Fülle geschichtlicher Belege, nach denen ‚säkulare Kolonisierung‘ und ‚christliche Missionierung‘ ununterscheidbar werden.
2 Christliche Mission: Auftragsebene und Erfolg
Der Missionsauftrag wird von der katholischen wie von der evangelischlutherischen Kirche unmittelbar auf Texte aus dem Neuen Testament zurückgeführt. Es gibt dort mehrere Textstellen, nach denen Jesus Christus unmittelbar den Missionsauftrag erteilt hat (Matthäus 28, 18–20, Markus 16, 15f., Lukas, 24, 46–48, Johannes 20, 21, Apostelgeschichte 1, 8). Am deutlichsten ist die entsprechende Formulierung im Markus-Evangelium, Kap. 16, 15f.:
„Hierauf sprach er [Jesus] zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft [das Evangelium] der ganzen Schöpfung!“
Genau dies ist die Initiierung eines kulturethologischen Prozesses. Es liegt – analog zur biologischen Evolution, die von der Entwicklung und der Verbreitung von ‚Genen‘ abhängt – eine lernabhängig entwickelte Idee vor, eine Summe von ‚Memen‘, die nunmehr, soweit es nur geht, verbreitet und ‚lebendig‘ erhalten werden soll.
Der Erfolg dieses Auftrages ist in geschichtlicher Sicht gewaltig. Historiker gehen davon aus, dass sich „das Christentum […] als Massenbewegung bereits am Ende des 3. Jahrhunderts durchgesetzt“ hatte (Andresen 1971, 307, zitiert nach Schwarte 1994, 203). Vermutlich gibt es keine religiöse Idee, die vergleichbar schnell gewachsen ist und sich so lange behaupten konnte. Geht man davon aus, dass dieser Missionsauftrag in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. erteilt worden ist, lässt sich sagen, dass sich die christliche Botschaft binnen 2000 Jahren weltweit verbreitet und sich – oft gar nicht mehr erkannt – in vielen Staaten zu einem bestimmenden Faktor des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens entwickelt hat. Zahlenmäßig belegt sich der christliche Missionserfolg auch darin, dass das Christentum heute mit 2,3 Milliarden Anhängern auch die mit Abstand größte Gruppe unter den Weltreligionen darstellt (Johnson & Ross 2009, 6f.). Die christliche Mission ist offensichtlich eine sehr erfolgreiche ‚Kolonisierung‘ einer Idee und lässt sich wohl auch kulturethologisch interpretieren.
3 Woher kam dieser Erfolg?
Natürlich lassen sich die Ursachen und Rahmenbedingungen dieser 2000-jährigen Erfolgsgeschichte nicht aufzählen. Man muss sich vor Augen halten, dass die Missionsgeschichte ein Stück globaler Weltgeschichte ist, im Detail unüberschaubar. Ebenso ist es nicht zu leisten, die Inhalte dessen, was Christentum in schriftlicher und mündlicher Tradition, aber auch in ihren allgemeinen kulturellen Leistungen (Architektur, Musik, bildende Kunst, soziale Dienste usw.) ausmacht, bezüglich ihrer Auswirkungen auf Gläubige wie Ungläubige darzustellen. Aber auch wenn Ursachen und Rahmenbedingungen im Detail unüberschaubar sind, liegt es auf der Hand, dass bewusst oder unbewusst hinter dieser Erfolgsgeschichte eine effiziente Strategie gestanden hat und steht, ein ‚Verlaufsmuster‘, durch das sich christliches Gedankengut so erfolgreich verbreiten konnte.
Zu dieser Strategie zählt erstens wohl, dass die Botschaft, die da verkündet wurde, in zentralen Stücken elementare Bedürfnisse des Menschen ansprach. Mit diesem Fragenkreis haben sich die Matreier Gespräche bereits 1990 (publiziert: Liedtke 1995a) und 2010 (publiziert: Bender et al. 2011) intensiv auch unter evolutionstheoretischen Aspekten befasst. Zwar gibt es in der Phylogenese des Menschen keinen Hinweis auf einen unmittelbar genetisch fundierten Funktionskreis ‚Religiosität‘, so wie es beispielsweise den Funktionskreis ‚Nahrungsbeschaffung‘ und ‚geschlechtliche Fortpflanzung‘ gibt. Aber im Falle der ‚Religiosität‘ lediglich eine lernabhängige Kulturtradition annehmen zu wollen, wäre wohl auch eine unzureichende Hypothese. Es ließe sich so nicht verständlich machen, warum ‚Religiosität‘ in zahlreichen Variationen offensichtlich weltweit verbreitet ist und sich zudem geschichtlich bis in die Steinzeit zurückverfolgen lässt (Liedtke 1994, 26). Durch Lernprozesse erklärt sich die Varianz der ‚Religionen‘, nicht aber die Ansprechbarkeit, die Sensibilität für ‚religiöse‘ Fragen.
Ein kultureller Anstoß für das Auftreten ‚religiöser‘ Fragen könnte auch die Erfahrung der Unumgänglichkeit des Todes sein (Liedtke 1994, 28f.). ‚Religiosität‘ könnte dann ein Mittel sein, Hoffnung auf eine Dauerhaftigkeit des Lebens aufzubauen und zu verstärken. So wäre ‚Religiosität‘ ein – ob in Darwinistischer oder soziobiologischer Deutung – evolutionäres Mittel zur Erhaltung des Lebens. Der biologisch-emotionale Anschluss der ‚Religiosität‘, die Anpassungsleistung von ‚Religiosität‘, wäre ursprünglich schlicht die Erhaltung des individuellen Lebens und des Lebens der Nachkommenschaft (Liedtke 1995b, 142).
Eine wenigstens partielle genetische Verankerung von ‚Religiosität‘ lässt sich allerdings aus der in allen Klassen der Lebewesen beobachtbare Verhaltenstendenz erschließen, nämlich auf ‚supranormale Objekte‘ intensiver zu reagieren als auf ein im natürlichen Umfeld normalerweise mögliches Reizangebot. Das klassische Beispiel war der ‚Austernfischer‘, ein bodenbrütender Watvogel, der von den ihm im Experiment angebotenen Eiern mit großer Präferenz die jeweils größeren ins Nest zu rollen suchte, selbst wenn diese Eier größer waren, als ein Austernfischer sie zu legen in der Lage gewesen wäre. Diese im Tierreich gehäuft belegbare Tendenz auf ‚supranormale Objekte‘, die mehr versprechen als bisher bekannt, besonders intensiv zu reagieren, kann als evolutives Wahrnehmungsschema ausgelegt werden, durch das Optimierungen möglich und abgesichert werden, die über das in normaler Erfahrungswelt vorhandene Reizangebot hinausgehen (Eibl-Eibesfeldt 1969, 96).
Auf ‚supranormale Objekte‘ besonders intensiv zu reagieren, ist auch im Humanbereich in allen Feldern der Wahrnehmung äußerst verbreitet. Das klassische, offensichtlich genetisch disponierte Beispiel ist hier das ‚Kindchenschema‘, das ‒ innerhalb bestimmter Grenzen ‒ den Menschen auf überzeichnete Darbietungen kindlicher Gestaltmerkmale positiver reagieren lässt als auf ‚normale‘ Merkmale (Liedtke 1972, 216 und 266f., Liedtke 1994, 27). Auf Grund seiner hohen Lernfähigkeit ist der Mensch zudem in der Lage, sich solche ‚supranormalen Objekte‘ selbst zu entwerfen. Kunst und Kosmetik sind besondere Ausprägungen dieser Fähigkeit. Eben aus dieser doppelten Fähigkeit, auf ‚supranormale Objekte‘ positiv reagieren und sich selbst solche Objekte ausdenken, gestalten zu können (Liedtke 2000, 31), lässt sich erklären, wie überhaupt der Mensch in der Lage sein konnte, die Idee eines Gottes, bei dem alle denkbaren positiven Merkmale in höchster Form zu finden sein sollen, zu entwerfen.
Insoweit ist ‚Religiosität‘, genauer die Sensibilität für ‚religiöse Fragen‘, ein Teilstück des genetisch disponierten Kanons menschlicher Bedürfnisse. Ohne Passung zu diesem Bedürfniskanon gäbe es keine ‚Religiosität‘, und es gäbe niemanden, der dafür ansprechbar wäre. Damit ist nicht alles zu beantworten, was es zu fragen gäbe. Warum es diese Welt gibt und ob sie nur das ist, was und wie wir wahrnehmen, bleibt offen. Aber auch diese Fragen gehören zum ‚religiösen‘ Bedürfniskanon. Dieser Kanon ist aber unter den Bedingungen der biologischen Evolution entstanden, steht weiterhin, was Erfolg oder Misserfolg betrifft, unter diesen Bedingungen und ist selbstverständlich auch von hieraus interpretierbar.
Zweitens zählt zu der erfolgreichen Strategie, dass das Christentum in den 2000 Jahren der Missionsgeschichte wohl nahezu alle bekannten technisch-kognitiven und motivationalen Mittel wie aber auch Machtmittel eingesetzt hat, die geeignet erschienen, die christliche(n) Botschaft(en) zu verbreiten, das Verhalten der Menschen zu christianisieren und den ‚Missionserfolg‘ zu sichern. Die Missionsarbeit befand sich bezogen auf die jeweilige geschichtliche und regionale Situation durchgängig auf hochprofessionellem Niveau der ‚Verkündigung‘ und der Verhaltenssteuerung.
Die Analyse des so erfolgreichen Verlaufs der ‚Missionierung‘ ließe erwarten, dass sich weitere evolutionstheoretische Voraussetzungen dieses Verlaufs finden ließen. Insbesondere aber steht zu erwarten, dass sich Verlaufsformen zeigen, die aus der biologischen Evolution geläufig sind beziehungsweise die kulturspezifischen Varianten oder kulturspezifische Weiterentwicklungen der biologischen Evolution, eben kulturethologische Verlaufsformen, sind. Eine solche Analyse kann hier natürlich nur in einigen Beispielen skizziert werden.
4 Szenerien der Missionsgeschichte und Hinweise auf ihre mögliche kulturethologische Einordnung
4.1 Konkretisierungen des biblischen Missionsauftrages und das frühe Christentum
4.1.1 Was wird verkündet?
Die den vier Evangelien folgende ‚Apostelgeschichte‘ und die Briefe der Apostel sind die zentralen Dokumente über Inhalte und Abläufe der Mission im frühen Christentum. Die Apostelgeschichte berichtet über die frühe Umsetzung des Missionierungsauftrags. Aber auch die Briefe der Apostel sind allesamt, ob sie sich ausdrücklich an Personen (z. B. Timothius), an Personengruppen (z. B. Römer) richten oder auch unadressiert bleiben, Dokumente zu Inhalten und Methoden der Mission, zu deren Erfolgen oder Problemen. Die Inhalte der missionarischen Verkündigung, der ‚frohen Botschaft‘, waren demnach die aus den Evangelien geläufigen Botschaften, aber auch die Inhalte des Alten Testamentes, soweit sie mit den Aussagen des Neuen Testamentes kompatibel waren. Die Botschaft war insgesamt ein anspruchsvolles Welterklärungs- und Weltorientierungsmodell, das in manchen Teilen in literarisch großartigen Texten fixiert war oder noch im Laufe des ersten nachchristlichen Jahrhunderts fixiert wurde.
Der Beginn der ‚Apostelmission‘ ist nach der Apostelgeschichte das Pfingstfest, das Jesus den nach seinem Tod zunächst mutlosen Aposteln und Jüngern prophezeit hatte: „Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die Grenzen der Erde“ (Apostelgeschichte 1, 8). Dieser Heilige Geist sei dann auch in wunderbarer Weise über sie gekommen:
„Plötzlich erhob sich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Sturm daherführe. […] Zungen wie von Feuer erschienen ihnen, […] und ließen sich auf einen jeden von ihnen nieder. Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen die Worte eingab“ (ebd., 2, 2–4).
Diese wundersamen Vorgänge, die bei der Bevölkerung zwar auch Spott, aber überwiegend doch Staunen und Ehrfurcht hervorriefen, habe der Apostel Petrus dann genutzt, um die Botschaft Jesu Christi zu verkündigen. Die biblischen Texte sind an kaum einer Stelle rational systematisierte und unmittelbar nachvollziehbare Texte. Auch ihre Historizität, ob sie überhaupt jemals so und im vorgegebenen Kontext gesprochen worden sind, ist in keinem einzigen Fall belegt. Aber wenn man sich fragt, wie konnte eine Religion so erfolgreich sein, was könnte den Zuhörer emotional überhaupt ansprechen, um zu glauben und sich taufen zu lassen, so gibt es in der Pfingstrede des Petrus (ebd., 2, 14–40) doch einen deutlichen Hinweis, durch den sich der konkrete Text auch glaubhaft in den Kontext – einige Wochen nach dem Tode Jesu – einordnen ließe.
Das zentrale, nahezu alleinige Thema der Pfingstrede ist die Auferstehung des gekreuzigten Jesus, die Auferstehung, die aber Vorbild für die Auferstehung und das ewige Leben aller Gläubigen sein solle (ebd., 2, 26f.) und damit die Lösung des Problems der Unumgänglichkeit des Todes. Damit ist der Punkt angesprochen, der evolutiv Sinn ergeben könnte, so etwas wie ‚Religiosität‘ zu entwickeln. Dass der Wunsch nach dauerhaftem Erhalten des individuellen Lebens wohl das zentrale Thema der Petrus-Rede war, ergibt sich auch aus dem einige Abschnitte später beschriebenen Widerstand der jüdischen Priesterschaft: „Sie waren ungehalten darüber, daß sie [die Apostel] das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten“ (ebd., 4, 2). Die christliche Verheißung eines ‚Ewigen Lebens‘ ist keineswegs die einzige zentrale Botschaft des Christentums. Die Nächstenliebe, die Feindesliebe, die Gleichstellung aller Menschen vor Gott waren sozialpolitisch auch hochattraktive Themen. Aber die Verhei...