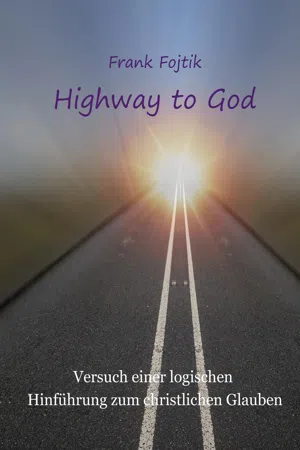![]()
1 Vorwort
Klare Logik und unscharfer Glaube – kaum zu glauben, dass sich diese Begriffe in vorliegendem Buch harmonisch ergänzen sollen. Unglaublich ist aber auch, wie viele Texte über Grundfragen des Menschen (z.B. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich?) im Lauf der Geschichte verfasst worden sind. In den Religionen und in der Philosophie wurde hierbei versucht, Systeme zu entwickeln, die diese Fragen mehr oder weniger befriedigend beantworten. Dabei stößt man allerdings auf zwei Arten von Problemen. Zum einen werden derartige Grundfragen je nach persönlicher Weltsicht oder Religion unterschiedlich gewichtet und formuliert, so dass es schwierig ist, Glaubens- oder philosophische Systeme sauber miteinander zu vergleichen. Zum anderen werden die Fragen in den meisten Fällen „offen“ gestellt (vgl. obige Fragen), d.h. sie erfordern als Antwort kein klares Ja oder Nein, was die Vergleichbarkeit der verschiedenen „Lösungen“ zusätzlich erschwert.
In diesem Buch wird nun der Versuch unternommen, in fünf logisch aufeinanderfolgenden, klar formulierten Fragen zu Kernelementen des christlichen Glaubens1 hinzuführen. Zwar ist wohl noch niemand über Vernunft und Logik allein zum Glauben gekommen. Eine vernünftige Auseinandersetzung hat jedoch das Potenzial, den Glauben nachvollziehbarer zu machen und zu festigen. Dies ist umso wichtiger, da in konkreten Situationen einem „Ja“ nicht selten ein emotionales „Nein“ entgegensteht. Auch wenn der Leser für sich nicht alle Fragen mit „Ja“ beantworten kann, hoffe ich, dass er an der einen oder anderen Stelle neue und logisch nachvollziehbare Sichtweisen in Bezug auf den Glauben im Allgemeinen erhält. Des Weiteren möchte ich ihn bitten, die Punkte, bei denen er anderer Meinung oder von der Argumentation nicht überzeugt ist, nicht einfach wieder in der Vergessenheit versinken zu lassen, sondern genau dort selbst auf die Suche zu gehen, um für sich passende Antworten zu finden oder Alternativfragen aufzustellen. Ein zentrales Anliegen des Buches ist nämlich nicht „Bekehrung“, sondern Bewusstwerdung und Entschiedenheit bzgl. fundamentaler Fragen, aus denen sich eventuell eine eigene Weltanschauung ergibt (vgl. Kapitel 2). In erster Linie geht es also um die Entscheidung zwischen „Ja“ und „Nein“ und nicht um die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Weltanschauung/Religion. Dies würde auch jeglicher Erfahrung widersprechen, dass man einen Fragenkatalog bearbeitet und sich aufgrund dessen für eine bestimmte Religion oder Weltanschauung entscheidet. Im Nachhinein ist die Aufstellung einer theoretisch-abstrahierenden Logikkette in Bezug auf den persönlichen Glaubensweg jedoch durchaus sinnvoll, auch wenn sie den tatsächlichen Glaubensweg sehr vereinfacht abbildet. Außenstehenden wird damit einerseits eine hilfreiche Orientierung gegeben, indem existenzielle Fragen mit Kernelementen des Christentums beantwortet werden. Des Weiteren bietet das Buch ganz allgemein die Möglichkeit, anhand existenzieller Fragen die konkrete Lebenssituation und -wirklichkeit, in der sich der Leser gerade befindet, zu prüfen und dabei „Lösungsansätze“ anderer Weltanschauungen kennen und schätzen zu lernen.2
Im Matthäusevangelium sagt Jesus: „Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man sie an dem, was sie tun.“ (Mt 7,16) Weiterhin schreibt der Dichter Hermann Hesse: „Die Religionen sind zum Teil Erkenntnisse über Gott und Ich, zum Teil seelische Praktiken, Übungssysteme zum Unabhängigwerden vom launischen Privat-Ich und dem Näherkommen an das Göttliche in uns. Ich glaube, eine Religion ist ungefähr so gut wie die andre. Es gibt keine, in der man nicht ein Weiser werden könnte, und keine, die man nicht auch als dümmsten Götzendienst betreiben könnte. Aber es hat sich in den Religionen fast alles wirkliche Wissen angesammelt, zumal in den Mythologien (…); aber jede ist ein Schlüssel zum Herzen der Welt. Jede weiß von den Wegen, aus dem Götzendienst am Ich einen Gottesdienst zu machen. (…) ich rufe Ihnen einfach den Gruß eines Wanderers zu, der gleich Ihnen im Dunkel geht, aber vom Licht weiß und es sucht.“3
Diese Zitate untermauern meine Überzeugung, dass jeder Glaube, jede Religion, jede Weltanschauung und jede Philosophie das Potenzial haben, Heil oder Unheil zu stiften. Das absolute Maß bleibt für mich daher – analog zu Lessings Ringparabel4 in „Nathan der Weise“ – die Lebensweise eines jeden Menschen. Es sei daher die These formuliert: Solange die Lebensführung eines Menschen dem eigenen Wohl, dem der Mitmenschen und der Welt dient, ist jeder Glaube, jede Religion und jede Philosophie die richtige und selig machend.
In diesem Sinne wünsche ich dem Leser eine gute Fahrt auf dem Highway to God5 und wertvolle Eindrücke, von denen er noch lange Zeit nach dem Ende der Reise zehren kann.
![]()
2 Hilfreiche Hinweise zum Verständnis
2.1 Ansatz: Logikkette aus geschlossenen Fragen
Vor dem Hintergrund der zu Beginn des Vorworts angesprochenen Problematik ist der Grundansatz des Buches folgender: In einer Art Logikkette werden hintereinander fünf ausgewählte Fragen gestellt, zu denen sich sicher viele Menschen im Laufe ihres Lebens Gedanken machen. Die Fragen wurden bewusst so formuliert, dass sie nur durch ein „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Softwareentwicklern wird diese Systematik vertraut sein, weil sie der 0/1-Logik in Computerprogrammen entspricht. Der Leser (und ebenso der Autor) wird dadurch gezwungen, klar Stellung zu beziehen (vgl. die Forderung Jesu in Mt 5,37: „Sag einfach 'Ja' oder 'Nein'. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass ihr euch vom Bösen bestimmen lasst.“), sich der Konsequenzen seiner Antwort bewusst zu werden und zu überprüfen, ob er mit diesem Ergebnis wirklich leben kann. Oder wie bereits Pythagoras sagte: „Die kürzesten Wörter, nämlich 'ja' und 'nein', erfordern das meiste Nachdenken.“6 Der Vorteil dieser Methode liegt ebenso darin, dass der Leser nicht einfach bloß Kritik an einer bestimmten Sichtweise anbringen und sich danach gleich wieder aus der Affäre ziehen kann, sondern dass er bei anderer Meinung gleichzeitig immer sich selbst fragen muss: „Was ist aber die Alternative?“ Ein gutes Beispiel hierfür wäre die große Frage „Warum lässt ein allmächtiger und gütiger Gott das Leid zu?“, für die es unzählige Erklärungsversuche gibt, die aber von keiner Religion allgemein befriedigend beantwortet werden kann. Deshalb wird diese so genannte „Theodizee-Problematik“ auch als eines der größten Argumente für den Atheismus eingesetzt. An dieser Stelle entzieht sich jedoch der Atheist mit seiner Kritik allzu schnell einer größeren Fragestellung, nämlich der, ob das Leid in der Welt überhaupt einen Sinn hat. Hier wird es für den Atheisten schwer, diese Frage zu bejahen und er wird den Sinn im Leid – wenn überhaupt – wohl auf den Reifungsprozess von Personen oder der ganzen Menschheit beschränken müssen. Eine derartige Ansicht lässt bei vielen Menschen wiederum starken Zweifel am Atheismus aufkommen. Es gilt also abzuwägen, ob man lieber mit dem „Theodizee-Problem“ oder lieber mit der „Sinnlosigkeit des Leids“ leben möchte.
Das Beispiel verdeutlicht einen weiteren Nachteil „offener“ Fragen: Neben der Versuchung, schwammig und kompliziert zu antworten besteht die Gefahr, dass man sich zu sehr auf eine Frage/Problematik konzentriert, die aber lediglich ein Mosaikstein in einer bestimmten Weltanschauung ist. Oder bildlich gesprochen: Die nicht befriedigend beantwortbare Frage ist ein – vielleicht sehr großer – Stein in einem Mosaik, wobei Letzteres in seiner Gänze eine bestimmte Weltanschauung darstellt. Auch wenn nun der große Mosaikstein durch Schmutz und Überlagerungen (z.B. unseren begrenzten Verstand) nicht wahrnehmbar und verborgen ist, so können wir doch erkennen, was auf dem gesamten Mosaik gezeigt wird. Der krampfhafte Versuch, eine schwierige offene (!) Frage zu beantworten, gleicht gewissermaßen jemandem, der mit der Lupe die verborgene Stelle untersucht, kaum Aussagekräftiges findet und dabei den Inhalt des gesamten Mosaiks aus den Augen verliert, auf den es eigentlich ankommt. Vielleicht findet der Forscher auch eine Möglichkeit, diese Stelle mit einer anderen „Weltanschauungs-Brille“ sichtbar zu machen, woraufhin aber meist andere Mosaiksteine verdunkelt werden. So bleibt es dem suchenden Menschen überlassen, ob es ihm wichtiger ist, bestimmte Details auf Kosten anderer Einzelheiten und des Gesamtbilds zu erkennen. Oder der Betrachter zieht es vor, sich am Gesamtbild und dessen Aussage zu orientieren, auch wenn es einige dunkle Flecken aufweist.
2.2 Anliegen: Bewusstwerdung der eigenen Weltanschauung und Einladung zum Glauben als Sinn machende Lebenshilfe
Es liegt in der Natur der Sache, dass beim Voranschreiten in der Beantwortung der Fragen bestimmte Weltanschauungen oder Hauptausprägungen von Religionen nach und nach aus der Logikkette „herausfallen“. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass natürlich nicht alle existierenden Religionen in der Betrachtung erfasst werden können und es sogar innerhalb von Religionen Strömungen gibt, die bzgl. einer konkreten Frage andere Meinungen vertreten.7 So beinhaltet beispielsweise der Hinduismus nicht zwangsläufig den Glauben an viele Götter, sondern es existieren auch dort Gruppierungen, die an nur einen Gott glauben. Das Ergebnis der Logikkette kann also schon deshalb keinerlei wertenden Charakter in Bezug darauf haben, welche Religion etwa die „bessere“ sei. Weiterhin wurden die Fragen von mir rein subjektiv – der eine oder andere Leser mag es sogar „willkürlich“ nennen – festgelegt und formuliert. Sie behandeln also die Themen, die für meinen Glaubensweg von größter Bedeutung waren und mich zum Glauben an einen Gott (Monotheismus) bzw. zum christlichen Glauben geführt haben. Für manche sind vielleicht andere fundamentale Fragen wichtiger, die sich aus dem Grundgedanken ergeben: „Was sind die tragenden Säulen meiner persönlichen Sicht der Dinge bzw. meiner Lebensrealität?“ Oder um an obiges Beispiel anzuknüpfen: „Was sind die wichtigsten Mosaiksteine in meinem persönlichen Weltbild?“ Auf die daraus resultierenden Alternativfragen können andere Religionen/Weltanschauungen genauso wertvolle oder gar wertvollere und elegantere Antworten liefern als der christliche Glaube. Es geht in diesem Buch also keineswegs darum, jemanden in irgendeiner Form zu „bekehren“, sondern ihm seine eigene Weltanschauung bewusst werden zu lassen und ihn dann zu einem für ihn schlüssigen Glauben(sweg) einzuladen.
Ferner ist die folgende Darstellung ein Versuch, auf der Basis persönlicher Erfahrungen und logisch nachvollziehbarer Schlussfolgerungen zu zeigen, dass der Glaube an Gott (egal welcher Religion) und die daraus resultierende persönliche Beziehung zu ihm8 durchaus Sinn machen9 und eine Lebenshilfe sein kann. Letztere ist eine der bedeutendsten, wenn nicht die wichtigste „Aufgabe“ des Glaubens. Als ich mich vor einigen Jahren mit einer einfachen Arbeiterin über verschiedene schwere Schicksalsschläge in ihrem Familien- und Bekanntenkreis unterhielt, sagte sie: „Weißt Du, was das Schlimmste ist, das mir passieren könnte?“ Ich erwartete als Antwort, dass ihrem Mann oder ihren Kindern etwas Schlimmes zustoßen könnte etc. Aber sie erklärte mit einer unglaublichen Überzeugung: „Wenn mir mein Glaube genommen werden würde.“, was mich im Nachgang sehr bewegt und mir die Lebenshilfe als Kernaufgabe des Glaubens verdeutlicht hatte.
2.3 Adressatenkreis: Sinnsucher, die ihren Glaubensweg aufgrund von Religionsvertretern oder unverständlicher Sprache abgebrochen haben
Das vorliegende Buch ist insbesondere an jene Personen gerichtet, die Antworten auf wichtige Fragen ihres Lebens suchen, aber aufgrund negativer Erfahrungen mit einer bestimmten Religion/Kirche, deren Vertretern oder Anhängern vorschnell jedem Glauben den Rücken gekehrt haben.10 Weitere Adressaten sind die vielen suchenden Menschen, die die schwere Verständlichkeit der Fachliteratur und der Bibel daran hindert, sich intensiver mit religiösen Dingen auseinanderzusetzen.11 Daher wird im Folgenden bewusst auf theologischphilosophische Höhenflüge verzichtet, die letztendlich immer vor der Realität des menschlichen Alltags scheitern oder bisweilen sogar lächerlich erscheinen (v.a. wenn man im sozialen Bereich mit Leben/Denken schwer behinderter oder kranker Menschen konfrontiert wird). Tatsächlich besteht gerade für intellektuelle Menschen die Gefahr, beim Denken abzuheben und die Bod...