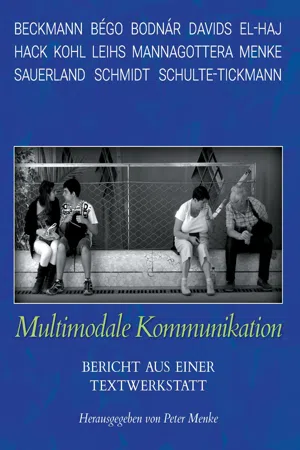
- 116 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Dieses Buch bietet einen Überblick über die Modalitäten, die neben der gesprochenen Sprache in zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen. Hierbei steht ein kurzer Abriss der Geschichte der Gestikforschung im Zentrum. Die Autorinnen und Autoren dieses Werks sind Studierende im Masterstudiengang Linguistik an der Universität Bielefeld, die sich diesem Thema im Rahmen eines Textwerkstatt-Seminars genähert haben. Ziel dieses Seminars war (neben dem inhaltlichen Einstieg in das Thema) die Erarbeitung und Veröffentlichung dieses Buchs.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Multimodale Kommunikation von Peter Menke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Languages & Linguistics & Linguistics. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
KAPITEL 1
Übersicht
1.1 Einleitung
Während sich die Linguistik in ihrer Geschichte ausführlich mit dem verbalen Teil gesprochener Sprache, und teilweise auch detailliert mit ihren verschiedenen prosodischen Merkmalen beschäftigt hat, sind die anderen Möglichkeiten des Menschen, mit anderen zu interagieren und zu kommunizieren, in der Linguistik nur vereinzelt und nicht in gleicher Tiefe erforscht worden. Gleichzeitig ist in der Vergangenheit oft mit der Sichtweise einer Vorrangstellung des gesprochenen Worts gegenüber den anderen Formen an Datenmaterial herangegangen worden — eine Perspektive, die sich erst in den letzten Jahrzehnten allmählich gewandelt hat, was sich daran zeigt, dass die Frage, ob eine solche Vorrangstellung aus der Sicht der Linguistik wissenschaftlich (noch) begründbar ist, sehr diskutiert wird (vgl. Oviatt, 1999; de Ruiter, 2004; Bonacchi und Karpiński, 2014).
Gleichzeitig sind jedoch in Fachgebieten, die nicht direkt zum Kerngebiet der Linguistik zählen, wichtige Erkenntnisse zu Gestik, Mimik, Blickbewegungen und weiteren Formen der nonverbalen Kommunikation zusammengetragen worden. Ziel unseres Seminars (und somit auch dieses Buches) war es daher, diese Erkenntnisse an Menschen heranzutragen, die einen linguistischen Hintergrund haben und einen überblicksartigen Einstieg in die Ergebnisse der anderen Disziplinen als Ergänzung zu ihrem bereits bestehenden Wissen suchen.
Daher bieten wir in KAPITEL 2 einen kurzen theoretischen Einstieg, der versucht, nonverbale Kommunikation an bestehende Theorien und Modelle anzubinden und Kernbegriffe wie Sinn oder Modalität greifbar zu machen.
KAPITEL 3 führt in die wichtigsten Eigenschaften und Besonderheiten einzelner Modalitäten ein. Danach widmen wir der Gestik in KAPITEL 4 einen dedizierten Raum. Hier stellen wir ausgewählte Meilensteine der Gestenforschung dar. Diese Darstellung (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausgewogenheit erhebt) arbeitet jeweils heraus, was die Neuerungen und Besonderheiten der jeweils behandelten Themen und Autoren sind.
Nach dieser theorielastigen Sequenz widmen wir uns in KAPITEL 5 praktischen Anwendungen und Analysen. Es werden (analoge) Notationsysteme für nonverbale Signale vorgestellt, und wir präsentieren einige beispielhafte Analysen von Interaktionen, die reich an multimodalen Kommunikationsformen sind.
In KAPITEL 6 kommen wir schließlich mit einem Ausblick auf Nachbardisziplinen der Linguistik zu einem Ende. Wir beleuchten, wie das Thema in Forschergemeinschaften gesehen wird, die, von der Linguistik ausgehend, in so unterschiedliche Richtungen wie Soziologie, Informatik oder Psychologie und Medizin weisen.
Ein Anhang (ab Seite →) führt kurz einige Werke auf, die sich mit Hinweisen, Tipps und Erläuterungen zum Thema Textproduktion oder Textrezeption befassen, außerdem finden sich hier eine lokal bedeutsame Hinweise zu Angeboten und Möglichkeiten an unserer Universität.
Von Peter Menke.
KAPITEL 2
Theoretische Vorüberlegungen
Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, gehen wir hier zunächst von der klassischen linguistischen Sicht aus, menschliche Kommunikation funktioniere primär über gesprochene Äußerungen. Wir stellen dann einige Überlegungen an, inwiefern sich kommunikative Praktiken wie Gestik oder Mimik hier einordnen lassen. Es wird deutlich werden, dass der Kommunikationsbegriff weiter gefasst werden muss, und dass wir uns zunächst überhaupt klar werden müssen, was wir genau unter Begrifflichkeiten wie Sinn, Kanal oder Modalität verstehen wollen.
2.1 Kommunikation
Linke, Nussbaumer und Portmann (2004) präsentieren in ihrem Studienbuch Linguistik eine Taxonomie menschlichen Verhaltens (S. 197f.), das die eigentliche sprachliche Kommunikation als in vielerlei Hinsicht besonders darstellt: Sie ist intentional (gilt somit als Handlung), partnerorientiert (ist daher Interaktion), ist symbolisch (somit Kommunikation) und zuletzt auch noch verbal. Während in den jeweils komplementären Kategorien zwar diverse nonverbale Verhaltensweisen beschrieben werden, erfolgt dies im Vergleich zur gesprochenen Sprache sehr viel oberflächlicher – der Hauptzweck ist hier die negative Abgrenzung. Blicke werden in diesem Schema pauschal als nicht-kommunikative Interaktion abgetan – eine Sichtweise, die wir für zumindest problematisch halten, wenn man daran denkt, dass mit Blicken beispielsweise aktiv gezeigt werden kann (vgl. Shepherd, 2010).
Weiterhin wird klar, dass Linke, Nussbaumer und Portmann (2004) eine einseitige Perspektive auf das Phänomen Kommunikation innehaben: »Das Schema definiert die Begriffe vom Standpunkt des Produzenten aus« (ebd., S. 198). Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf alternative Sichtweisen, wie etwa die bekannte von Watzlawick, Bavelas und Jackson (2007) eingenommene Perspektive, dass im Grunde alles, was wahrgenommen werden kann, auch potentieller Bestandteil von Kommunikation ist, nehmen diese Perspektive in ihrem Schema jedoch nicht auf.
Wir sind der Auffassung, dass die vorgeschlagene taxonomische Klassifikation nicht alle Feinheiten multimodaler Kommunikation erfassen kann. Etwas allgemeingültigere und daher (zunächst) brauchbarere Modelle finden wir in der Semiotik, beispielsweise bei Krampen (1997). Das dort vorgeschlagene Modell abstrahiert von den konkreten Erscheinungsformen von potentiellen Signalen – alles, was von einem Organismus rezipiert werden kann, kann auch durch eine entsprechende Interpretation Bedeutung erlangen. So können nun auch solche Beobachtungen Teil von kommunikativen Prozessen werden, die nach dem Modell von Linke, Nussbaumer und Portmann (2004) überhaupt nicht berücksichtigt werden, wie etwa unterbewusst oder unbewusst erzeugtes Verhalten, wie ein erschrecktes Luftholen oder eine Weitung der Augen nach der Entgegennahme einer unbekannten negativen Information. Obwohl diese Verhaltensweisen in der Regel nicht intendiert sind, tragen sie doch zu den weiteren Iterationen der Kommunikation bei, wenn sie von Rezipienten dahingehend interpretiert werden, dass der Produzent durch die neuen Informationen in einer bestimmten Weise beeinflusst worden ist (sei es lediglich durch Überraschung oder sogar durch Veränderung seiner emotionalen Einstellung).
Krampens Modell ist bis dahin primär rezipientenorientiert, jedoch werden auch hier reaktive produktionsbezogene Elemente angesprochen: Auf der Basis der aus den rezipierten Beobachtungen entnommenen Informationen veranlasst die sogenannte interpretierende Einheit den Organismus zu einem bestimmten Verhalten. Dieses Verhalten wiederum kann Kanäle in der Außenwelt manipulieren (wie etwa die Luft in Form von Schallwellen oder Licht), was wiederum (in der nächsten Iteration der Semiose) von weiteren Teilnehmern rezipiert und verarbeitet werden kann.
Natürlich vereinfacht auch dieses Modell die kommunikative Wirklichkeit. Beispielsweise ist Kommunikation nie so streng sequenziell, wie es dieses Modell suggeriert. Dennoch ist sein großer Vorteil die Abstraktion von einer vorherrschenden kommunikativen Strategie – gesprochene Sprache ist hier nur eine Möglichkeit unter vielen, und der Organismus kann neben dem akustischen auch über eine ganze Reihe anderer Pfade Informationen aus der Umwelt aufnehmen. Diesem Aspekt der Kommunikation widmen wir uns im folgenden Abschnitt.
Literatur
Krampen, Martin (1997). »Models of Semiosis«. In: Semiotik. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. Hrsg. von Posner, Roland. Bd. 1. Berlin: de Gruyter. Kap. 5, S. 247–287
Linke, Angelika, Nussbaumer, Markus und Portmann, Paul R. (2004). Studienbuch Linguistik. Tübingen: Max Niemeyer
Watzlawick, Paul, Bavelas, Janet Beavin und Jackson, Don D. (2007). Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 11., unveränderte Auflage. Bern: Huber
Von Peter Menke.
2.2 Sinne
Wie viele Sinne hat der Mensch? Die offensichtliche Antwort, die der Fragesteller erwarten würde, wäre sicherlich »fünf«. Diese Antwort ist jedoch nicht nur offensichtlich, sondern auch zu vereinfacht. So antwortet ein Artikel in der Onlineausgabe von Spektrum (Schönfelder, 2013) auf diese Frage mit »sechs«, und rechnet zu den bekannten Sinnen Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken und Riechen auch noch das Gleichgewichtsgefühl hinzu.
Was macht das Gleichgewichtsgefühl zu einem Sinn? Was macht irgendeinen der anderen fünf Sinne zu einem Sinn? Sehr vereinfacht gesagt, lässt sich ein Sinn als aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt sehen:
Einerseits gibt es, damit die Sinneswahrnehmung zustande kommt, ein Signal, einen Sinnesreiz. Dieser Reiz muss allerdings nicht von außerhalb des Körpers kommen. Andererseits gibt es ein Organ am oder im Körper, das diesen Reiz wahrnimmt: ein Sinnesorgan. Die Sinneswahrnehmung dabei ist stets auch individuell, und mag sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Diese Darstellung von Sinnen erlaubt es einem nun auch, interessante alternative Sichtweisen darauf, was ein Sinn überhaupt ist, nachzuvollziehen.
Während die klassische Sichtweise der fünf Sinne sich bereits bei Aristoteles zeigt (in De anima III, 1), unterscheidet Lowenstein (1966) beispielsweise nur drei Arten von Sinnen, die er danach kategorisiert, auf welchem physikalischen Weg das Signal übermittelt wird: chemisch (wie beim Schmecken und Riechen), elektromagnetisch (wie beim Sehen) oder mechanisch (wie beim Hören und Fühlen).
Schmidt (2007) dagegen geht von den altbekannten fünf Sinnen aus, er betrachtet aber auch noch andere Möglichkeiten. Speziell wirft er die Frage auf, ob Jucken, Schmerz, Kitzel Sinne seien. Schmidt sagt dort treffend: »Es wird immer eine Interpretationsfrage sein, über wie viele Sinne der menschliche Körper verfügt.« Hinzugefügt sei noch, dass es auch vermutlich eine Frage der jeweiligen Disziplin sein mag, aus der man kommt.
Das die allgemeine Vermutung, die fünf Sinne des Menschen seien ein Fakt, sich so nicht halten lässt, führt (hoffentlich) zu weiterem Interesse an der Auseinandersetzung mit diesem weiten Feld.
Literatur
Aristoteles. De anima
Lowenstein, Otto (1966). The senses. Harmondsworth: Penguin Books
Schmidt, Robert F. (2007). Physiologie des Menschen. Hrsg. von Lang, Florian und Thews, Gerhard. 30. Aufl. Springer-Lehrbuch 30. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, S. 994
Schönfelder, Vinzenz (2013). Wie viele Sinne hat der Mensch? URL: http://www.spektrum.de/quiz/wie-viele-sinne-hat-der-mensch/867032
Von Rick Davids.
2.3 Modalitäten
Nachdem durch den vergangenen Abschnitt schon deutlich geworden sein sollte, dass ein vermeintlich so klarer Begriff wie der des Sinnes gar nicht so eindeutig zu bestimmen ist, soll dieser Abschnitt kurz darstellen, dass auch das Konzept der Modalität in verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich verstanden und gleichzeitig oft gar nicht ausreichend genau definiert wird. Hierfür versuchen wir, die Literatur nach einer für all unsere Fälle gültigen und hilfreichen Definition von »Modalität« zu durchforsten.
Zunächst grenzen wir, um initiale Missverständnisse zu vermeiden, den Bereich der Modalsemantik aus, mit ihrem unter das Adjektiv »modal« subsumierbaren Themenfeld, das sich mit der sprachlichen Kennzeichnung von Notwendigkeit oder Möglichkeit bestimmter Ereignisse befasst (und hier beispielsweise mit den bekann...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kapitel 1: Übersicht
- Kapitel 2: Theoretische Vorüberlegungen
- Kapitel 3: Einzelmodalitäten
- Kapitel 4: Meilensteine der Gestenforschung
- Kapitel 5: Analyse
- Kapitel 6: Multimodalität im Blickpunkt anderer Disziplinen
- Anhang: Informationen zur Arbeit mit Texten.
- Sachregister
- Personenregister
- Literaturverzeichnis
- Impressum