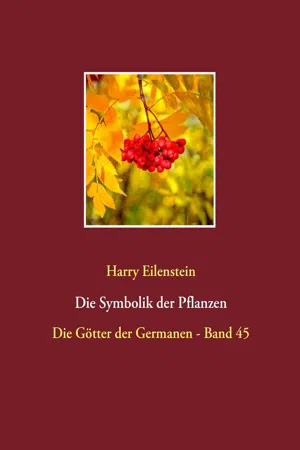![]()
III Die einzelnen Pflanzen
III 1. Alraune
Der Name „Alraune“ stammt von „Albrune“, was „Alfen-Geheimnisse“ bedeutet. Die Alraune (Mandragora officinarum) gehört zu der Familie der Nachtschattengewächse, in der sich viele Giftpflanzen wie der bittersüße Nachtschatten, die Tollkirsche und das Bilsenkraut, Drogen wie der Tabak und Gemüsepflanze wie die Kartoffel und die Tomate finden.
Die Wirkung der Alraune besteht aus Halluzinationen, Atemnot, Durchfall, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen und Hyperaktivität. Sie ist vermutlich wie andere Nachtschattengewächse auch für das Hervorrufen von Astralreisen (Verlassen des Körpers) benutzt worden.
Die Alraune wurde auch „Mandragora“, „Galgenmännlein“, „Zauberwurzel“ und im Arabischen „Geister-Ei“ und „Apfel der Verrückten“ genannt.
III 1. a) Die Sagen der Gebrüder Grimm: Der Alraun
Ein Alraun ist kein Kobold, aber er hat als Jenseitswesen ähnliche Fähigkeiten wie ein Kobold. Der Text stammt von den Angelsachsen in England und wurde ungefähr um 1000 n.Chr. verfaßt.
Es ist Sage, daß, wenn ein Erbdieb, dem das Stehlen durch Herkunft aus einem Diebesgeschlecht angeboren ist oder dessen Mutter, als sie mit ihm schwanger ging, gestohlen, wenigstens groß Gelüsten dazu gehabt (nach andern: wenn er zwar ein unschuldiger Mensch, in der Tortur aber sich für einen Dieb bekennet), und der ein reiner Jüngling ist, gehenkt wird und das Wasser läßt (ut sperma in terram effundit), so wächst an dem Ort der Alraun oder das Galgenmännlein.
Oben hat er breite Blätter und gelbe Blumen. Bei der Ausgrabung desselben ist große Gefahr, denn wenn er herausgerissen wird, ächzt, heult und schreit er so entsetzlich, daß der, welcher ihn ausgräbt, alsbald sterben muß. Um ihn daher zu erlangen, muß man am Freitag vor Sonnenaufgang, nachdem man die Ohren mit Baumwolle, Wachs oder Pech wohl verstopft, mit einem ganz schwarzen Hund, der keinen andern Flecken am Leib haben darf, hinausgehen, drei Kreuze über den Alraun machen und die Erde ringsherum abgraben, so daß die Wurzel nur noch mit kleinen Fasern in der Erde steckenbleibt. Darnach muß man sie mit einer Schnur dem Hund an den Schwanz binden, ihm ein Stück Brot zeigen und eilig davonlaufen. Der Hund, nach dem Brot gierig, folgt und zieht die Wurzel heraus, fällt aber, von ihrem ächzenden Geschrei getroffen, alsbald tot hin.
Hierauf nimmt man sie auf, wäscht sie mit rotem Wein sauber ab, wickelt sie in weiß und rotes Seidenzeug, legt sie in ein Kästlein, badet sie alle Freitag und gibt ihr alle Neumond ein neues weißes Hemdlein. Fragt man nun den Alraun, so antwortet er und offenbart zukünftige und heimliche Dinge zu Wohlfahrt und Gedeihen.
Der Besitzer hat von nun an keine Feinde, kann nicht arm werden, und hat er keine Kinder, so kommt Ehesegen. Ein Stück Geld, das man ihm nachts zulegt, findet man am Morgen doppelt; will man lange seines Dienstes genießen und sichergehen, damit er nicht abstehe oder sterbe, so überlade man ihn nicht, einen halben Taler mag man kühnlich alle Nacht ihm zulegen, das höchste ist ein Dukaten, doch nicht immer, sondern nur selten.
Wenn der Besitzer des Galgenmännleins stirbt, so erbt es der jüngste Sohn, muß aber dem Vater ein Stück Brot und ein Stück Geld in den Sarg legen und mit begraben lassen. Stirbt der Erbe vor dem Vater, so fällt es dem ältesten Sohn anheim, aber der jüngste muß ebenso schon mit Brot und Geld begraben werden.
III 1. b) Jacob Grimm: Deutsche Mythologie
Unter allen berühmten wurzeln steht die Alrune oben an. schon althochdeutsche glossen liefern alrûna, alrûn für mandragora und ich habe den namen der persönlich gedachten pflanze wol befugt mit dem der weisen frauen unsers höchsten alterthums zusammengestellt.
Hans Sachs schildert noch die Alraun als eine am scheideweg begegnende göttin:
Alrawn du vil güet
mit trawrigem müet
rüef ich dich an;
dastu meinen leidigen man
bringst darzue,
das er mir kein leid nimmer tue.‹
… … …
fraw, du solt haim gan
und solt güeten müet han,
und solt leiden, meiden, sweigen;
thuest du das von allen deinen sinnen,
so machtu wol ein güeten man gewinnen.
… … …
Ähnlich ist ein mittelhochdeutsches gedicht und ein märchen, wo aber der mann, statt der frau, sich am holen baum oder spindelbaum (fusarius) im garten weissagen läßt. Der anruf ›Alrûn, dû vil guote‹ gemahnt an Walthers stelle von der kleidenden schrotenden frô Sælde, wo gleichfalls gesagt ist: ›si vil guote‹.
… … …
Alle diese bestimmungen klingen alt und können hoch hinauf reichen. Schon jene althochdeutschen glossen halten alrûna für die in der vulgata-Bibel Genesis 30, 14 mehrmals vorkommende mandragora, wo der hebräische text dudaim liest, die mittelhochdeutsche dichtung aber erdephil verdeutscht.
… … …
Der semihomo (Halbmensch) mandragoras entspricht jener sage und selbst das vesanum gramen könnte ihr näher entsprechen, als aus den worten erhellt.
… … …
Da französisch mandagloire für mandragore steht, ist gemutmaßt, daß die fee Maglore aus Mandagloire entsprungen sei, und das wäre als bestätigung des analogen verhältnisses zwischen Alrûna und alrûna nicht zu verachten.
… … …
Sie scheint bei nacht wie ein licht, es wird ihr haupt, hände und füße beigelegt, sie soll erst mit eisen umschrieben werden, damit sie nicht entweiche, nicht mit eisen angerührt, sondern mit elfenbeinernem stabe gegraben; vieles gemahnt an lateinische grundlage. statt an den schweif soll an den nacken des hundes gebunden werden. Plinius legt dem mandragoras vim somnificam bei.
III 1. c) Griechen
In Griechenland ist die Alraune der Göttin Aphrodite geweiht gewesen, die daher den Beinamen „Mandragoritis“ trug. Evtl. ist jedoch die Tollkirsche und nicht die Alraune gemeint gewesen.
Die Alraune wurde auch für Liebeszauber verwendet – was ja in den Tätigkeitsbereich der Göttin Aphrodite fällt.
Die Alraune hat die Gestalt eines Menschen und wurde wie eine Göttin angesprochen. Insbesondere ihr Haupt soll des Nachts leuchten, was an eine Sonnengöttin in der Unterwelt erinnert.
Die Anweisungen zum Ernten der Alraune sind recht aufwendig, was vermuten läßt, daß ihr ältere Rituale und Mythen zugrunde liegen.
Es ist ungewiß, ob die Alraunen-Geister einen germanischen Ursprung haben – zumindestens gibt es keinen deutlichen Hinweis darauf. Im Mittelmeerraum ist sie hingegen von verschiedenen Völkern auf unterschiedliche Weise verwendet worden.
III 2. Ampfer
III 2. a) Jakob Grimm: Deutsche Mythologie
Hat sich jemand heftig an einer nessel verbrannt, so nimmt man einige blätter von ampfer (rumex obtusifolius, englisch dock, dockon), speit darauf, und reibt damit die verletzte stelle, indem man die worte ausspricht: ›in dockon, out nettle!‹
anderwärts: in dock, out nettle!
schon bei Chaucer: ›nettle in, dock out‹;
mittellateinischer spruch: ›exeat urtica, tibi sit periscelis amica!‹
Übersetzt: „Nessel rein, Ampfer raus!“
Der Ampfer nimmt das, was die Nessel in die Haut gestochen hat, wieder heraus.
Der Ampfer ist als Heilmittel gegen Brennn...