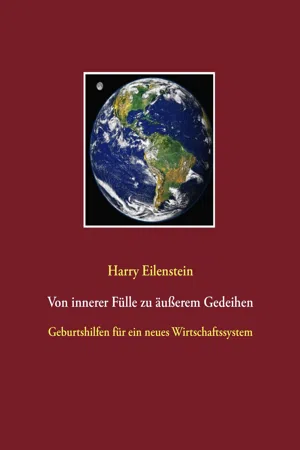![]()
Manche Dinge sind so absurd, daß es gar nicht mehr auffällt: Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Da sind Menschen, die arbeiten wollen, und diese Menschen wollen auch die verschiedensten Waren kaufen, dann gibt es genügend Land, Rohstoffe, Maschinen usw., um diese Dinge auch herzustellen – es ist also alles, da, was gebraucht wird, um genau das zu produzieren, was die Menschen auch haben wollen – aber es klappt nicht.
Die Menschen haben keine Arbeit, weil es sich für die Produzenten nicht lohnt, etwas für diese Menschen zu produzieren, weil sie es nicht kaufen könnten, eben weil die Betreffenden kein Geld haben, da sie keine Arbeit haben. Ein Kreislauf, ein Kurzschluß.
In der Marktwirtschaft gibt es kein Gleichgewicht – entweder die Konjunktur boomt und steigert sich immer weiter oder sie läßt nach und schrumpft immer weiter. Es gibt genau zwei Möglichkeiten:
Das marktwirtschaftliche System steigert sich ständig in eine der beiden Richtungen: Beinahe-Stillstand der Wirtschaft oder Boom, Arbeitslosigkeit oder Arbeitskräftemangel.
Dies beruht darauf, das die Marktwirtschaft auf der Konkurrenz aufgebaut ist: Wer ist bereit am meisten zu zahlen? Wer kann das Produkt am billigsten herstellen? Wer kann seine Konkurrenz ausschalten? Wer kann das andere Unternehmen schlucken? Und Kämpfe haben am Schluß immer einen Sieger und einen Besiegten – auch wenn die Kämpfer am Anfang in etwa gleich stark waren.
In der sozialen Marktwirtschaft versucht der Staat und die Bundesbank diese Steigerung in ein Extrem hinein abzufangen und zu regulieren, aber das klappt keineswegs immer.
Bei den verschiedenen Ansätzen zu dieser Regulierung streitet man sich lediglich darum, ob man die Produktion verbilligen (konservatives Lager) oder die Nachfrage, d.h. die Löhne erhöhen (soziales Lager) soll – aber beide Ansätze bleiben innerhalb diesem „System des Wettkampfes“ und streiten sich auch untereinander – eben Wettbewerb…
Offensichtlich ist die Arbeitslosigkeit aber eine wirtschaftliche „Krankheit“ die sich nicht durch weitere Konkurrenz, sondern nur durch Kooperation heilen läßt – es besteht die Notwendigkeit, die Arbeitswilligen, die anstehende Arbeit, die benötigten Produkte und die Rohstoffe so zu koordinieren, daß sich daraus eben eine produktive Tätigkeit ergibt. Wie gesagt, es ist alles da, um die benötigten Dinge zu produzieren, wir sind nur nicht in der Lage, die Arbeiter, die Rohstoffe und den Bedarf der Menschen so zusammenzuführen, daß es zu einer produktiven Tätigkeit kommt.
Es wird also Kooperation statt Konkurrenz gebraucht.
Wer wohnt gerne in Hochhäusern oder in Wohnsilos? So ziemlich niemand… Und warum gibt es solche Häuser, in denen eigentlich niemand wohnen möchte? Weil ihre Erbauer nicht in ihnen wohnen müssen, sondern weil sie durch diese Art von Häusern die größtmöglichen Mieteinnahmen erhalten.
Auch hier gibt es wieder den Wettstreit: die Mieter wollen eine möglichst schöne Wohnung zu einer möglichst niedrigen Miete haben – und die Vermieter wollen möglichst billig eine Wohnung produzieren und dann eine möglichst hohe Miete dafür erhalten. Was unter diesem Prinzip leidet ist natürlich die Wohnung…
Es wäre also allen geholfen, wenn jeder die folgen seines eigenen Handelns (und Produzierens) tragen müßte.
Bei der Arbeit ist es ähnlich: Der Arbeitgeber will möglichst gute und schnelle Arbeit und möchte dafür möglichst wenig Lohn zahlen, während der Arbeitnehmer das Gegenteil will: möglichst leichte und wenig Arbeit und dafür hohen Lohn.
Zudem entwerfen die Arbeitgeber Arbeitsplätze, die kein Arbeitnehmer gerne einnehmen will – z.B. am Fließband.
Auch hier sind es wieder zwei Parteien, die in Konkurrenz zueinander stehen statt sich in Kooperation der Produktion von Waren zu widmen – worunter vor allem die Ware selber leidet.
Auch hier ist demnach die Kooperation erstrebenswert und ebenso das Prinzip, das der Verursacher auch die Folgen seiner Handlungen tragen sollte.
In der Warenproduktion ist die Situation noch absurder. Wahrscheinlich hat inzwischen jeder schon einmal davon gehört, daß inzwischen viele Waren mit Absicht so hergestellt werden, daß sie nicht lange halten (man denke mal an die Haltbarkeit eines alten VW-Käfers oder einer Uralt-Waschmaschine…).
Die Motivation ist leicht verständlich: Wer Waren herstellt, die fast ewig halten, reduziert selber die Nachfrage nach den so hergestellten Produkten. Stellen Sie sich vor, eine Firma würde Rasierapparate herstellen, die 50 Jahre lang halten statt 5 – und die obendrein in diesen 50 Jahren auch nicht ständig neue Ersatzteile brauchen. Nach drei Jahren hätten alle einen solchen Rasierapparat und die Firma könnte für die nächsten 47 Jahre schließen, weil niemand mehr einen solchen Rasierapparat kaufen würde. Man kann die Firmeninhaber ja gut verstehen…
Aber stellen Sie sich einmal vor, was es für eine Volkswirtschaft bedeuten würde, wenn alle ihre Produkte so haltbar wie nur möglich herstellen würden. Dann müßte zunächst für die einzelnen Produkte vielleicht doppelt so lange gearbeitet werden und es würden vielleicht doppelt so viele Rohstoffe gebraucht werden, aber wenn die Produkte dann zehnmal solange halten, wird für dieses Produkt auf Dauer gesehen nur noch ein Fünftel soviel Arbeit und auch nur noch ein Fünftel soviel Rohstoffe gebraucht.
Stellen Sie sich das einmal für die gesamte Produktion vor: Sie und alle anderen Arbeiter brächten nur knapp zwei Stunden am Tag zu arbeiten statt acht… Unser Wirtschaftssystem ist offenbar zu einem „Selbstbeschäftigungsprogramm“ geworden, weil wir es auf der Konkurrenz statt auf der Kooperation aufgebaut haben.
Wenn man aus dem Blick auf das Ganze heraus entscheiden und handeln würde, wäre man sich sehr schnell einig, daß man sechs Stunden Freizeit pro Tag der Herstellung von Produkten, die nicht lange halten, deutlich vorziehen würde.
Hier wird wieder die Kooperation als Lösung für das Problem gebraucht.
Aus den vorigen Beschreibungen ergibt sich schon, daß noch einige andere Krankheitssymptome, die in unserer Wirtschaftsform auftreten, ebenfalls auf das Konkurrenzprinzip zurückzuführen sind.
Ganz offensichtlich ist dies bei der Umweltverschmutzung. Bis vor ein paar Jahrzehnten war alles „weg“, was man fortwarf – inzwischen ist den meisten bewußt geworden, daß die Erde ein weitgehend geschlossenes System ist und daß daher alle produzierten Gifte irgendwann mit der Nahrung zu ihrem Produzenten (und zu allen Menschen ) zurückkehren. Es gibt kein „weg“ auf unserer Erde, so wie man den Müll aus der Wohnung tragen kann – irgendwo begegnet man allem, was man fortgeworfen hat, wieder…
In diesem Bereich hat sich inzwischen schon ein erfreuliches Maß an Verantwortungsgefühl entwickelt – vor allem, weil die Folgen so offensichtlich sind.
Ähnlich ist es mit dem Naturschutz und dem Artensterben, das ebenfalls recht vielen Menschen bewußt geworden ist, wobei sich hi...