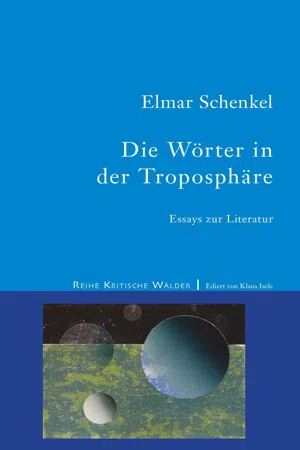![]()
Wie der Mensch ein Außerirdischer wurde
Aliens in der frühen Science Fiction 1880-1940
1.
Die vielfältigen Phantasien, mit denen der Mensch seit seinen Ursprüngen den Himmel überdeckt hat, legen nahe, dass es sich um eine Aufgabe handelt, vermutlich um einen Rorschachtest, den sich ein Psychologe am Rande des Universums ausgedacht hat. Doch sollte man für einen Moment das konventionelle Denken ausschalten, das uns sagt, der Mensch habe das Unbekannte und Fremde mythisch überzogen, um es sich vertraut zu machen. Gehen wir einmal davon aus, dass im Gegenteil der Mensch den Himmel nicht als fremd und unvertraut gesehen hat, sondern als Teil einer nützlichen und vielsagenden Umwelt. Erst mit der neuzeitlichen Wissenschaft, nach der Renaissance also, wird der Himmel etwas Unbekanntes. Alles, was zuvor gut gewusst und zuverlässig schien – der geozentrische Ort, die Perfektion der Gestirne, ihre Fixierung an Kristallscheiben –, brach zusammen, und an die Stelle von vertrauten Geschichten über Sternzeichen traten Wirbel, Löcher, Haufen, Unregelmäßigkeiten, Abgründe aus Nebel und Gas.
Erst diese Situation, die seit Galilei heraufzudämmern begann, erzeugte den Alien. Das Wort alien ist die moderne Ableitung aus einem lateinischen Wort für etwas Fremdes, alienus. Der Fremde als Ausländer begann seit etwa 1953, wie das Oxford English Dictionary vermerkt, das Wort den Außerirdischen zu überlassen, auch wenn man mit einem nichtbritischen Pass in Großbritannien noch bis in die siebziger Jahre hinein als Alien geführt wurde.
Mit George E. Slusser und Eric S. Rabkin kann man den Alien als Antwort auf eine Natur verstehen, der sich der Mensch entfremdet, während zugleich Lücken in der Kette des Seins entstehen, die nicht mehr leicht aufzufüllen sind. 1 Gott hatte solche Lücken und Rätsel, wie sie die Fossilien darstellen, nicht vorgesehen. Deshalb muss, bei aller Kontinuität, auch ein Unterschied gemacht werden zwischen den grotesken Wesen und Monstern, die sich das Mittelalter vorstellte, und den fremden Wesen, die aus dem Weltall kommen oder denen man auf der Erde begegnet. Je mehr der Mensch sich zum Rätsel wird, desto mehr bedarf er des Fremden. Das Rätsel sucht Rat und produziert dabei nur weitere Rätsel.
Es ist die Science Fiction, die man mit Mary Shelleys Frankenstein oder den Romanen von Jules Verne beginnen lässt, die sich in dieses Rätselspiel am intensivsten eingelassen hat und dabei andere Teilnehmer wie Theologie, Anthropologie, Biologie, Astronomie oder Physik hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Mentalität weit überholt hat. Kinobilder und Phantasmen der Science Fiction halten Positionen im Bewusstsein und Gedächtnis westlicher Menschen und lassen den Differenzierungen der Wissenschaft wenig Platz. Metaphorisch greifen sie mit Frankenstein, Dracula oder King Kong in den Alltag ein, und wir träumen eher von ET als von mathematischen Gleichungen. Die starke Visualisierung des Fremden in der Science Fiction macht es so wirksam in unserem mentalen Haushalt. Die Medien wiederum nutzen unsere Bereitschaft für Szenarien, die uns aus der Science Fiction vertraut geworden sind, um Aufmerksamkeit zu erregen oder politische Strategien durchzusetzen. Ich müsste mich wundern, wenn die »Achse des Bösen« nicht aus einer Space-Oper stammt.
Spätestens hier fällt auf, dass diese literarische Gattung, die von der akademischen Literaturwissenschaft immer noch nicht für ganz voll genommen wird, Funktionen des Mythos und der Religion übernommen hat, obwohl sie aus dem Geist der Wissenschaft entstanden ist.
In der Übernahme liegt eine Kontinuität, die es immerhin ermöglicht, eine Linie zu verfolgen von den Wunderfiguren und wilden Männern des Mittelalters hin zu den Aliens von Star Trek oder Independence Day. Man könnte sogar, wie dies Jean-Bruno Renard getan hat, behaupten, das Bild des Außerirdischen sei die Umkehrung des Bildes vom wilden Mann.2 Die verbindende Phantasie lautet Evolution. Der Wilde Mann, der auf Wirtshausschildern wie auf Wappen die Keule trägt, steht für die der städtischen Zivilisation entgegenstehende Welt des Waldes und der Wildnis. In Chrétien de Troyes’ Yvain findet er seine gültige Gestaltung und wird in der Renaissance von Dürer und Breugel bearbeitet. Er überlagert sich mit den sogenannten Wilden der Naturvölker, auf die die Europäer im Zuge ihrer Expansion stoßen, mutiert zum Edlen Wilden der Aufklärung und wird schließlich am Ende des 19. Jahrhunderts unter anderem zum missing link der Evolutionslehre. In dieser und ähnlicher Gestalt taucht er in den prähistorischen Erzählungen der Science Fiction und Fantasy auf, bei E. R. Burroughs ebenso wie bei H. G. Wells, J. H. Rosny dem Älteren und anderen. Er ist im Allgemeinen kräftig gebaut, haarig, dunkelhäutig, eher nackt oder mit einem Fell bedeckt. Der Außerirdische, wie er sich im Laufe der letzten hundert Jahre herauskristallisiert hat – ob als literarisches Produkt oder in jenen zahllosen Begegnungen der dritten Art, die seit 1947 so auffällig oft dokumentiert wurden – ist dagegen schlank und blass, eher haarlos und trägt einen engen Anzug. Sein Kopf ist groß im Verhältnis zum Körper, die Augen schmal und klein, und oft muss er ohne Nase, Mund oder Ohren auskommen, während der Kopf des Wilden Mannes eher kleiner ist und Nase und Augen samt Brauen betont werden. So könnte man fortfahren, wenn man nichts gegen strukturalistischen Binarismus hat, der aber oft die Phänomene verzerrt, um sie in sein Gitter zu pressen. Der Wilde Mann muss nicht erst auf den Alien zu warten, um sein Gegenbild zu finden; er hat es schon im Mittelalter und später, nämlich in den Feen, Geistern und Kobolden. Dass diese möglicherweise direkte Vorfahren der Außerirdischen sein könnten, zeigt das Bild der »kleinen grünen Männchen«. In der SF tauchen sie erstmals im ersten Roman des Mars-Zyklus von Edgar Rice Burroughs auf (1912ff.).3 Heutige Ufologen behaupten, sie seien tatsächlich grün und klein, diese Außerirdischen. Damit aber reden sie nicht anders über die Unbekannten als die Menschen des alten Europa, wenn sie über Elfen, Naturgeister und Kobolde sprachen: Irrlichter am Rande der Wahrnehmung, flüchtig, kaum fassbar, aber immer wieder präsent und so intelligent, dass ihnen heutige Gläubige auch Angriffe auf Computernetzwerke zutrauen.4 Auch die Entführungsszenarien gleichen sich aufs Haar.
2.
Wir stehen also mitten in einer Geschichte, deren Anfang wir suchen, solange noch kein Ende in Sicht ist. Science Fiction, soviel scheint gesichert, übernimmt religiös-mythologische Funktionen und prägt die Archetypen der Moderne. Sie arbeitet dabei etwa wie ein Filter, der das Überkommene in neue Formen gießt und es übersetzt in ein neues Idiom. Wenn wir die Krise der Religion im 19. Jahrhundert ansetzen – ausgelöst durch Bibelkritik, Historismus, Darwinismus, Geologie und Astronomie –, so fällt diese zusammen mit dem Beginn der modernen Science Fiction. Im Unterschied zu früheren Phantasien über die Vielzahl bewohnter Welten, die von Lukian bis zu Fontenelle reichen, orientiert sich die Science Fiction verstärkt an realen Möglichkeiten und versucht, ihren Spekulationen wissenschaftliche Fundamente zu geben oder zumindest zu suggerieren. Jules Verne etwa nutzt immer die Technik des 19. Jahrhunderts als Grundlage, um sie zu übersteigern.
Um zum Mond zu kommen, muss man eben eine gigantische Kanone bauen. Wells dagegen erfindet schnell ein Anti-Schwerkraft-Metall, um dasselbe Ergebnis zu erreichen. Verne kommentierte denn auch kritisch, Wells erfinde bloß, während er, Verne, Gebrauch von der Physik mache. »Das ist ganz reizend«, rief Verne, »aber zeigen Sie mir das Metall. Lassen Sie es ihn produzieren!« Die Differenz ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Science Fiction letztlich nur Wissenschaft oder deren spekulative Möglichkeiten als Horizont akzeptiert. Zumindest die frühe Science Fiction lässt sich anregen vom Positivismus und Materialismus des 19. Jahrhunderts. Auch dort, wo sie sich mit Phänomenen wie Telepathie, Teleportation, Reinkarnation und anderen parapsychischen Erscheinungen beschäftigt, färbt doch das Zeitalter materialistisch ab. Telepathie ist dann eben eine höhere Form der Telegraphie, Hellsehen eine gesteigerte Wahrscheinlichkeitstheorie.
Aber gerade aufgrund dieser Wechselbeziehungen zwischen Religion, Technologie, früher Medienvernetzung und Theosophie ist diese Epoche der Science Fiction so aussagekräftig. Sie nimmt nicht nur unsere Phantasmen vorweg, sondern bildet so etwas wie eine Brücke zwischen der Phantasie der alten europäischen Welt und der Moderne, in der wir leben. Das lässt sich insbesondere am Bild des Aliens zeigen, der als Figur die Bühne betritt und sie bis heute nicht verlassen hat.
Fragen wir uns zunächst, in welcher Form Fremdheit des Menschen gegenüber sich oder den Außerirdischen in der Science Fiction seit Frankenstein (1818) erzeugt wird.
In Frankenstein erschafft der Mensch etwas Fremdes, ein Ungeheuer, das aber zugleich vertraut ist und deshalb so gefährlich. Nimmt Mary Shelley hier genetische Manipulationen vorweg, wie wir rückblickend spekulieren könnten, so ist diese Phantasie doch deutlich vor der darwinistischen Revolution angesiedelt. Erst die Evolutionslehre ermöglicht nämlich wissenschaftlich-spekulative Reisen in die Vergangenheit oder Zukunft, in denen der Mensch auf sich selbst als Fremden trifft: fortentwickelt oder degeneriert, auf jeden Fall aber anders, schattenhaft und verzerrt auf die Version Mensch der Gegenwart verweisend. Natürlich lehrt auch die Geologie die Reise in die Vergangenheit – Charles Lyells Principles of Geology dienten Charles Darwin als Lektüre während seiner Weltumseglung – doch für den Menschen ist noch kein Platz. Die Zeitreise entsteht einerseits aus der beschleunigten Reise durch den Raum, der die Zeitwahrnehmung verändert. Chamisso schrieb 1830 das Gedicht »Das Dampfross« über die Eisenbahn, die er als Zeitmaschine sah: »Ich habe der Zeit ihr Geheimnis geraubt, / Von Gestern zu Gestern zurück sie geschraubt, / Und schraube zurück sie von Tag zu Tag, / Bis einst ich zu Adam gelangen mag.« Andererseits können Zeitreisen durch neuronale Veränderungen entstehen: Ein Schlag auf den Kopf versetzt bei Mark Twain den Yankee an den Hof des König Artus; mesmeristischer Tiefschlaf trägt Edward Bellamys Helden in das Jahr 2000. Bei de Quincey führt das Opium zu einer extremen Zeitdehnung, während in Wells’ Erzählung »The New Accelerator« eine Droge Zeitlupenwahrnehmung ermöglicht. Zeitreisen in die Zukunft und Vergangenheit werden initiiert durch Drogen, Somnambulismus, Reinkarnation, magnetische Bäder, Mumifizierung, vulkanische Gase oder gar Ekel. Überlegungen zur Lichtgeschwindigkeit führen um 1877 zur ersten Zeitmaschine der Literatur, einer Erzählung des tschechischen Autors Jakub Arbes unter dem Titel »Newtons Gehirn«. Wells schließlich reichte 1895 mit The Time Machine das Patent ein. Er war es auch, und deshalb ist seine Erzählung wichtiger als die meisten früheren Zeitreisen, der eine evolutionstheoretische Sicht der menschlichen Geschichte gab und somit das phantastische Reisemotiv zurück zur Wissenschaft brachte, die es erst ermöglicht hatte. Denn ohne die Zeitdimensionen von Geologie und Biologie, die den biblischen Rahmen von etwa 6000 Jahren Schöpfung sprengten, hätte das Genre Zeitreise nicht abheben können.
Es ist also der Faktor Zeit, der Fremdheit erzeugen kann, wenn die Außerirdischen mit dem Menschen noch verwandt sind. Dabei kann es zu einem Spezieswechsel kommen, so dass eine Begattung zwischen Menschen und Außerirdischen ebenso möglich erscheint wie zwischen Neanderthaler und Cro-Magnon.
Eine Steigerung der Fremdheit tritt ein, wenn in Analogie zu irdischen Verhältnissen auch für das Weltall eine Vielfalt von Arten angenommen wird und die intelligenten Außerirdischen sich von anderen Spezies ableiten: von Affen, Eidechsen oder Dinosauriern, von Spinnen, Ameisen und anderen Insekten. Erstmals tauchen humanoide Tiere 1883 in dem Weltraumepos Aleriel; or, a Voyage to Other Worlds des viktorianischen Geistlichen Wladislaw Sommerville Lach-Szyrma auf: Löwenmenschen auf dem Mars und Vogelmenschen auf der Venus. Sie müssen sich in diesem Stadium jedoch noch emanzipieren von den mythischen und allegorischen Geschöpfen, die Antike und Christentum in den Himmel projiziert hatten.
Solch eine Übergangsfigur stellen auch die Engel dar, die in einigen Werken noch oder wieder am Himmel oder gar im Inneren der Erde erscheinen. 1824 spekulierte Gustav Theodor Fechner über die vergleichende Anatomie der Engel und behauptete, die Menschen würden eines Tages Himmelswesen, indem sie sich der Kugelform als dem perfekten Körper annäherten. Wells schießt einen Engel ab in The Wonderful Visit (1897) und lässt ihn gleich von einem Wissenschaftler untersuchen und zoologisch einordnen. Die androgyne Erscheinung verbindet sich jedoch bestens mit ästhetisch-modischen Tendenzen des fin de siècle, so dass dem Himmelsbewohner große Aufmerksamkeit sicher ist. Auch die unterirdischen Vril-ya in Bulwer-Lyttons Klassiker The Coming Race (1871) tragen engelhafte Züge. Sie sind nicht nur unglaublich fortgeschritten, mächtig und im Besitz einer furchtbaren Energiequelle, sie tragen auch Flügel, die allerdings mechanisch an- und abgebaut werden können. Unterirdische und Außerirdische haben vieles gemeinsam, und so tauchen auch bei Lach-Szyrma oder in Charles Rowcrofts The Triumph of Woman (1848) engelhafte Wesen von Neptun und Venus auf.5
Erst gegen Jahrhundertende finden sich die ersten Geschichten, in denen die Fremdheit so weit fortgetrieben wird, dass keine anthropomorphen Elemente mehr bemerkbar sind – bis auf mentale Kategorien wie Bewusstsein, Gedächtnis, Angst, Kommunikation oder deren Verweigerung sowie, grundlegend, Intentionalität. Nun kann das Fremde die Form von Pflanzen annehmen, die Menschen vertilgen, wie bei Conan Doyle (»The American’s Tale«, 1880) oder Wells (»The Flowering of the Strange Orchid«, 1894). Sie können außerirdischen Ursprungs sein oder irdisch erzeugt im Dschungel oder durch genetische Experimente wie später in John Wyndhams The Day of the Triffids (1951). Es kann sich auch als gigantische Qualle in Luftdschungeln über der Erde aufhalten, die wir heute mit der Ionosphäre verbinden und in der Conan Doyles Flieger einsame Kämpfe mit wirklichen Luftschlangen und transparenten wolkenartigen Ungeheuern führen (»The Horror of the Heights«, 1913). Wells stellte sich in »The Empire of the Ants« (1905) Ameisen vor, die mit Werkzeugen und Waffen arbeiten und von Südamerika aus die Welt erobern. 1950 oder 1960, so prognostizierte er, würden die Ameisen Europa entdecken.
Bei all diesen Wesen handelt es sich um Grenzphänomene zwischen einer unbezähmbaren Natur, die nicht ohne Grund mit dem Dschungel assoziiert wird, und intelligenten Wesen, die aus ...