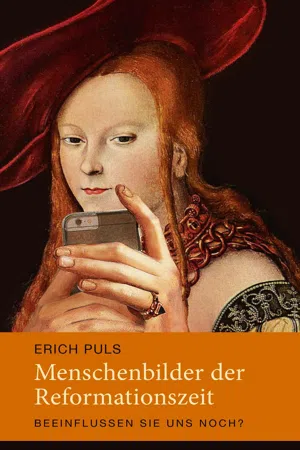![]()
Werte und tragfähige Menschenbilder
Wertvorstellungen aus Religion, Philosophie, Wissenschaften, Politik und Pädagogik werden hier als Grundlagen für tragfähige Menschenbilder betrachtet. – Die Werte aus den genannten Bereichen meinen aber trotz gleicher Bezeichnungen inhaltlich nicht das Gleiche und prägen deshalb unterschiedliche Menschenbilder.
Christliche Wertvorstellungen
und tragfähige Menschenbilder
Zu den christlichen Wertvorstellungen der Bibel gehören Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit und die Ethik der Gebote. – Diese Werte erweist Gott den Menschen und erwartet sie auch von ihnen gegenüber ihren Mitmenschen. Der christliche Glaube beantwortet die Menschheitsfragen, wer der Mensch ist, woher er kommt, wohin er geht und wozu er da ist. Demnach sind alle Menschen Kinder Gottes, er ruft sie ins Leben und nimmt sie am Ende wieder auf. Gläubige sollen ihre Sünden bekennen und bereuen, Demut zeigen, Gott für seine Gnade danken und Jesu vorgelebte Liebe und Barmherzigkeit an ihrem Nächsten üben.
Im Glaubensbekenntnis erkennen Christen den dreieinigen Gott an, nämlich den Schöpfer des Himmels und der Erde, seinen Sohn Jesus Christus, der Gläubige von ihren Sünden erlöst und ihnen das ewige Leben versprochen hat. Sein Heiliger Geist wird Christen im Evangelium, in der Taufe und im Abendmahl zuteil. – Dieser Glaube ist nach Paulus eine Gabe Gottes, die Menschen selig macht, Freude und zuversichtliches Handeln bewirkt sowie inneren Frieden verbreitet und die Überwindung der Welt ermöglicht.
Die Würde des Menschen wird in seiner Gottebenbildlichkeit gesehen sowie im Auftrag, fruchtbar zu sein, sich die Erde untertan zu machen und das Leben zu erhalten sowie in seiner Freiheit, sich für das Gute oder Böse zu entscheiden. – Gläubige werden aus ihren Sünden durch Gottes Gnade zum ewigen Leben erlöst.
Heutige Theologen setzen die protestantische Tradition fort, religiöse Zeitfragen zu stellen und zu beantworten. – Als bekannte Frager und Mahner seien hier stellvertretend die Theologen Dietrich Bonhoeffer und Paul Tillich angeführt. Der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Bonhoeffer wurde 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Er beklagte die Verweltlichung seiner Kirche. Sie habe dazu beigetragen, dass den Menschen die Heilsbotschaft vom Kreuz nicht immer deutlich verkündet worden sei. Jesus habe am Kreuz einem gläubigen Sünder das ewige Leben versprochen und ihm nicht nur die Sünden vergeben. Diese Botschaft könne auch heutige Menschen ermutigen, für ihr sündhaftes Handeln Buße zu üben, um Vergebung zu bitten und im zuversichtlichen Glauben verantwortlich in der Welt zu handeln.55
Der evangelische Theologe Paul Tillich (1886–1965) fragt, was den Glaubenszweiflern mitgeteilt werden kann. Nach seinem Verständnis suchen diese Menschen nach dem letzten tragenden Grund ihres Lebens, wie der zweifelnde Thomas. Er konnte Jesu Auferstehung nicht glauben, bevor nicht seine Finger Christi Wunden berührt hatten. Jesus verurteilte den Jünger und seinen Zweifel nicht. Deshalb spricht Tillich von der »Rechtfertigung des Zweiflers vor Gott«.56
In der Bibel finden die Menschheitsfragen nach Krieg und Frieden eine hoffnungsvolle Antwort. – Im Alten Testament spricht Mose vom »heiligen Krieg«, in dem Gott den Israeliten hilft, das verheißene Land zu erobern. Unter der Regierung Salomons wenden sich die Propheten Elia und Elisa gegen die Einführung ägyptischer Kriegstechnik. Auch Jesaja warnt seinen König im Vertrauen auf Gott: »Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.« Nach seiner Prophezeiung werden eines Tages die Völker der Erde zum Berg Zion wallfahren, um Gottes Wahrheit zu hören. Dann werden Menschen Schwerter zu Pflugscharen schmieden und kein Volk mehr das Schwert führen. Andere Propheten prangerten die Verelendung des israelischen Volkes als Folge des Reichtums der Oberschicht an und forderten einen Ausgleich zwischen Armen und Reichen.57
Im Neuen Testament nennt Jesus in seiner Bergpredigt die Friedfertigen Gottes Kinder, deren Liebe und Verständnis auch die Feinde einschließen soll. – So wie Gott sich als barmherzig erweise, solle der Mensch auch handeln. Jesus hinterließ den Gläubigen seinen Frieden, einen Seelenfrieden im Glauben, den die Welt nicht geben könne. Er warnt vor dem Schätzesammeln auf Erden: »denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein«. In seinen Gleichnissen spricht er Arme und Reiche an. Der reiche Jüngling befolgte alle Gesetze und hielt sich deshalb für sündenfrei. Er konnte sich aber nicht von seiner Habe trennen und musste seine Sündhaftigkeit erkennen. Im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus kann der Reiche nicht bußfertig werden und Lazarus als Bruder annehmen. Jesus veranlasst die Menschen mit seinen Gleichnissen, sich selbst zu fragen: Wer bin ich angesichts der aufziehenden Herrschaft Gottes? Er verstärkt die Suche nach dem christlichen Menschenbild mit der Frage: »Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?«58
Das christliche Menschenbild ist als Gegenentwurf zum weltlichen zu verstehen. – Christen arbeiten an der Verwirklichung ihres Auftrages, wenn sie sich für Hilfsbedürftige einsetzen sowie für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, wenn sie Kriege, Umweltzerstörungen und wirtschaftliche Ausbeutung ablehnen. Beide Kirchen betreiben wirksame Entwicklungshilfe vor Ort. Inzwischen überlegen auch Politiker, wie die Flucht aus armen Ländern begrenzt werden kann und ob Fluchtursachen durch Befriedung und gerechte Handelsverträge eingedämmt werden können.
Humanistische Wertvorstellungen
und ihre Menschenbilder
Seit der Renaissance setzt die humanistische Philosophie ihr Vertrauen in die Vernunft und Selbstbestimmung des Menschen sowie in die Wissenschaften. – Der Glaube an die menschlichen Fähigkeiten und den wissenschaftlichen Fortschritt beeinflusst die Menschenbilder heute stärker als vor fünfhundert Jahren. Die Hinwendung zur Welt und zur Vernunft fördert die Wissenschaften. Obwohl ihre Erkenntnisse meistens nur vorläufig gelten und laufend fortgeschrieben werden, beeinträchtigen sie den neuzeitlichen Glauben an die begrenzte menschliche Vernunft kaum. Mit ihrer Hilfe werden Arbeitserleichterungen, Lebensverlängerungen und Wirtschaftserfolge erreicht. Die vermeintlich unabhängige Sicht der Wissenschaft auf die Welt und ihr Dienst an der Menschheit wird auch von wirtschaftlichen Absichten geleitet.
Zu den humanistischen Wertvorstellungen zählen Toleranz, die Achtung der Menschenwürde und Menschenrechte, Selbstbestimmung des Menschen und die Vorrangstellung der menschlichen Vernunft. – Diese humanistischen Werte sind in Demokratien inzwischen staatstragend geworden. Sie sind zwar größtenteils von christlichen Wertvorstellungen abgeleitet, aber nicht gleichbedeutend. So wird beispielsweise die humanistische Würde des Menschen aus seiner Vernunft und seinem Recht auf Selbstbestimmung abgeleitet.
Die humanistische Philosophie trennte Glauben und Vernunft zum Nachteil ganzheitlicher Menschenbilder. – Die verloren gegangene ganzheitliche Sicht auf den Menschen führte zu fragwürdigen Ansätzen in der Medizin und in der Bildung. Seither schwindet das Verständnis für das Zusammenwirken von Geist, Körper und Seele. Die Schulbildung wurde weitgehend auf weltliches Wissen verengt und führt in fachlich zerstückelten Unterrichtsstunden zur Zerstörung von Zusammenhängen. Humanisten strebten eine staatliche Bildung der Vernunft an. Dieses bildungspolitische Ziel wurde im Zeitalter der Aufklärung erneut aufgenommen und in den folgenden Jahrhunderten verwirklicht, wie heute an den einseitig ausgerichteten Lehrplänen der Schulen deutlich wird.
Die Tragfähigkeiten humanistischer Werte werden aus religiösen und philosophischen Gründen angezweifelt. – Der Humanismus beantworte nicht die Fragen des Menschen über seine Herkunft, Zukunft und Daseinsaufgaben, weil er selbst nicht über sich hinaus denke. Der britische Philosoph John Gray wirft dem Humanismus seinen Fortschrittsglauben und seine Gleichmacherei im Denken vor, die im Kommunismus gescheitert sei. Im Christentum sei der Daseinssinn den Menschen von Gott vorgegeben. Da der Mensch seinen Lebenssinn als Gottes Geschöpf nicht selbst bestimmen könne, solle er demütig bleiben. Der Humanismus biete dem Menschen keinen Trost. Er erkläre die Welt zu seiner endgültigen Heimat. Gray betrachtet den Humanismus als einen Aberglauben, der für das menschliche Seelenheil nicht tragfähig sei.59
Politische Wertvorstellungen
und die Menschenbilder
Neuzeitliche politische Wertvorstellungen sind unbeständig. Sie veränderten sich durch Auseinandersetzungen zwischen Staat und Volk über Gerechtigkeit, Freiheit und Machtansprüche. – In der Renaissance löste Machiavelli die Politik von ethischen Grundsätzen. Er empfahl, die Bürger den Staatsinteressen unterzuordnen, und erklärte die Staatsräson zum inneren und äußeren Schutz des Staates. Sie wird so auch in den meisten Ländern der Welt heute angewandt, mit Ausnahme Europas. Sozialwissenschaftler fordern, Politik und die Wirtschaft an die ethischen Werte der Menschenrechte zu binden. Ob das gelingt, wird angesichts der Macht- und Geldgier des Menschen bezweifelt.
Der europäische Staatsgedanke vom Heiligen Römischen Reich beeinflusste die politischen Menschenbilder in Deutschland durch viele Jahrhunderte. – Kaiser Karl V. strebte die Wiederherstellung des Reiches von Karl dem Großen an, aber die Landesfürsten lehnten das Vorhaben ab. Sie erlangten durch die Reformation zusätzliche Macht, die gegen den Papst, den Kaiser und den Reichsgedanken gerichtet war. Historiker behaupten, die Reformation habe die Gründung der deutschen Nation um drei Jahrhunderte hinausgeschoben.
Napoleon wechselte den europäischen Reichsgedanken gegen den Nationalgedanken aus und beendete 1806 das Heilige Römische Reich. – Seither beeinflussen andere Vorstellungen die politischen Menschen- und Weltbilder: Österreich entwickelte die Vorstellung eines großdeutschen Reiches, Bismarck gründete nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1871) den ersten deutschen Nationalstaat ohne Österreich. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik führte Hitler das deutsche Volk in den Nationalsozialismus. Er verkehrte den Reichsgedanken in eine nationalistische und rassistische Großraumpolitik.
Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands änderten sich das deutsche Nationalverständnis, das Verhältnis zu den Nachbarländern und damit auch die politischen Menschen- und Weltbilder: Die Siegermächte führten in Westdeutschland eine liberale und in Mitteldeutschland eine sozialistische Demokratie ein. Westdeutschland wu...