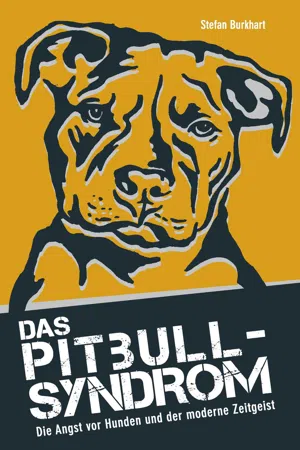![]()
1
Einleitung
Die Debatte um Kampfhunde hat nicht nur mit Hunden zu tun. Vielmehr manifestiert sich darin ein tiefergründiges Phänomen in der modernen Gesellschaft.
Als im Dezember 2005 im Züricherischen Oberglatt Pitbulls einen Jungen tödlich bissen, brachen die Dämme – das Phänomen, schon zuvor oft als Kampfhunde-Debatte beschrieben, erreichte seine höchste Eskalationsstufe. Ein Nährboden dafür bestand bereits früher. Hysterisierende Berichte aus Medien befeuerten schon zu Beginn der 90er Jahre eine aktivistische Politik und eine ins Obsessive gesteigerte Angst vor so genannten Kampfhunden, insbesondere dem Pitbull. Die Macht, mit der sich die Debatte um das Gefährdungspotential von Hunden in der Öffentlichkeit entfaltete, verlor immer mehr den Bezug zur realen Gefahr, die von Kampfhunden oder Hunden generell ausgeht.
Diese Irrationalität ruft nach Erklärungen, zumal ähnliche Mechanismen in anderen Bereichen der öffentlichen Wahrnehmung zu erkennen sind. Wer denkt dabei nicht an die populistisch inszenierten Kampagnen gegen Raucher, Fettleibige, Raser, Offroader-Lenker oder – manchmal erfindet man auch flugs eine neue Kategorie, um besser abdrücken zu können – Rauschtrinker. Analogien sind ferner erkennbar mit der überrissenen Darstellung der Gefährdung durch privat aufbewahrte Armeewaffen (obwohl die Statistiken keine besondere Gefährdung erkennen lassen), der mit religiösem Eifer zelebrierten Aversion gegen Genfood (obwohl keine Schadensfälle bekannt sind), der Sorge um Jugendgewalt (obwohl die Statistiken eigentlich keinen Anlass zu besonderer Sorge gäben). Beispiele liessen sich noch viele aufzählen.
Wahrscheinlich stehen solcherlei übersteigerte Ängste ganz im modernen Zeitgeist. Involviert sind Gefühle, Medien, Politik – und irgendwie die Unfähigkeit, mit Gefahren umzugehen, die nun mal das Leben birgt. Ein allumfassendes Sicherheitsdenken könnte man sogar als den tieferen soziologischen Grund bezeichnen, auf dem die Kampfhunde-Debatte erst richtig zu spriessen vermochte. Die Medien, die Politik und einfach die Emotionen der Menschen haben das Pflänzchen Hysterie gedüngt, dass es zu einem garstigen Strauch wachsen konnte.
War es in den von der amerikanischen Expertin Karen Delise geschilderten Hunde-Hysterien früherer Zeiten mehr die Sensationslust, das Gruseln vor einer bestimmten Rasse – so ist es heute mehr die illusionäre Forderung, dass Hunde immer lieb zu sein haben und von ihnen keine Gefahr ausgehen dürfe. Man hat verlernt, Gefahren als fundamentaler Bestandteil des Lebens zu akzeptieren und übt sich im vermessenen Anspruch, alle Risiken ausschalten zu können. Die Frucht für staatliche Reglementierungen ist sodann reif. Eingriffe in Freiheit und Privatsphäre geniessen Akzeptanz, wenn sie nur ja die Illusion bedienen, das Leben zur Zone einer absoluten Gefahrlosigkeit zu machen.
Absicht dieses Buches ist es, die ins Hysterische gesteigerte Form der jüngsten Kampfhunde-Debatte zu verstehen, in deren Zentrum der Pitbull als Prototyp einer absolut bösen Kreatur die Vorstellungswelt der Menschen pervertiert. Dazu ist zuerst ein Blick in die Geschichte der Kampfhunde nötig. Dann müssen wir uns fragen, ob diese so genannten Kampfhunde oder Kampfhunderassen tatsächlich gefährlicher sind als andere Hunde. Schliesslich blenden wir ein bisschen zurück, um zu erkennen, dass bestimmte Hunde oder Rassen schon in der Vergangenheit Hysterien ausgelöst haben. In der Öffentlichkeit zelebrierte Hunde-Obsessionen sind also nichts Neues.
Vor diesem mehr historischen Hintergrund schwenken wir sodann auf die aktuelle Kampfhunde-Debatte ein. Diese zeichnet sich durch drei besondere Aspekte aus. Man könnte es auch drei Zutaten nennen, die – schüttet man sie zusammen – die Hysterie ergeben. Jede dieser drei Besonderheiten wird in einem Kapitel erörtert Und zwar so:
Aspekt: Irrationale Angst (Kapitel "Die Angst geht um") – Es ist eine völlig falsche Einschätzung der realen Gefahr, die von Hunden ausgeht. Statistiken zeigen: Hunde sind nur ein marginales Sicherheitsrisiko. Man hat also Angst vor Hunden, obwohl sie kaum gefährlich sind. Die Kampfhunde-Hysterie ist deshalb Ausguss einer falschen Wahrnehmung und eines ambivalenten Umgangs mit Risiken.
Aspekt: Kampfhund als Sündenbock (Kapitel "Sündenbock Kampfhund") – Es ist das verkrampfte Fixieren auf die Kategorie Kampfhunde. Es scheint, als ob man eine klar definierbare Tätergruppe von Hunden suchte, ein typisches Sündenbock-Muster.
Aspekt: Politik und Medien (Kapitel "Medien und Politik") – Schliesslich hat die aktuelle Kampfhunde-Hysterie mit Medien und Politikern zu tun, die diese Ängste und diese Fokussierung auf einen Sündenbock bedienen, insgesamt mehr anfachen als besänftigen.
Das Zusammenspiel all dieser Aspekte ergibt einen emotionalen Zustand der Öffentlichkeit, den man im besten Fall als ängstlich, im schlimmsten Fall als hysterisch bezeichnen kann. Mit Hunden oder Kampfhunden hat das nur mehr wenig zu tun. Die aktuelle Kampfhunde-Obsession muss man daher im ersten Rang als soziales Problem sehen, das nur bedingt etwas mit Hunden zu tun hat.
![]()
2
Im Einsatz seit Menschengedenken
Die Geschichte der Kampf- und Kriegshunde ist uralt. Schon in Ägypten und Mesopotamien waren sie im Einsatz. In den römischen Arenen kämpften Hunde massenhaft gegen andere Tiere und Gladiatoren. Die meisten der heutigen Kampfhunde-Rassen gehen auf England zurück, wo Tierkämpfe bis ins 19. Jahrhundert ein Volkssport waren. Daraus entstanden Rassen wie der Pitbull.
Der Pitbull und seine Urahnen
Natürlich ist er nur einer der Protagonisten in der Kampfhunde-Debatte. Andere Rassen sind ebenfalls Gegenstand einer ins Hysterische verirrten Wahrnehmung geworden. Doch wie kein Hund sonst wurde er in der Öffentlichkeit mit dem Kainsmal des Bösen versehen, dämonisiert von Medien und vulgärer Massenmeinung als Ausgeburt des bedrohlichen Kampfhundes schlechthin: Der Pitbull. Seine Vorfahren stammten aus England. Man nannte sie dort Staffordshire Bull Terrier. Der Name verweist auf die Region Staffordshire, ein Zentrum der Industrialisierung in England. Die Rasse entstand aus Kreuzungen verschiedener Terriertypen mit Bulldogs. Mit Auswanderer-Familien gelangte der robuste Hund über den Atlantik nach Amerika, wo sich langsam entwickelte, was wir heute Pitbull nennen. Mit dem Bulldog hat der Pitbull einen Urahnen, der seinerseits auf den Mastiff zurückgeht. Und der Mastiff wiederum ist einer jener doggenartigen Hunde, wie sie schon in den frühsten Tagen unserer Zivilisation erwähnt werden. Damit sind wir mitten in der langen gemeinsamen Vergangenheit von Hund und Mensch angekommen.
Kriegs- und Kampfhunde der Antike
Doggenartige Hunde sind so etwas wie Prototypen starker und grosser Hunde mit hoher Wehrhaftigkeit, die schon früh "fürs Grobe" eingesetzt wurden. Sei es zum Schutz der Herde gegen wilde Tiere, zur Verteidigung von Haus und Hof, auf der Jagd, zum Packen von grossem Wild, zum Treiben von Vieh und im Krieg. Es ist nicht geklärt, wo und wie genau sie entstanden sind. Wahrscheinlich bildeten sich doggenartige Hunde unabhängig voneinander an verschiedenen Orten heraus.
Zeugnisse von solchen Hunden gibt es indessen viele und uralte. Bereits in Persien und Mesopotamien muss es sie gegeben haben, sind doch auf Bildern starke und kräftige Hunde auszumachen. Anatolische Felsmalereien aus einer Zeit um sechs bis sieben Tausend Jahre v. Chr. lassen grosse Hunde an der Seite eines Jägers erkennen. Auf sumerischen Siegeln aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend sind doggenartige Hunde bei der Jagd auf Wildschweine und Löwen zu sehen. In Kriegen kamen doggenartige Hunde ebenfalls schon früh zum Einsatz. Der berühmte Tutenchamun (ca. 1'300 Jahre v.Chr.) ist auf einer Abbildung mit grossen, kräftigen Kriegshunden zu sehen. Aus den Perserkriegen (490 bis 449 v.Chr.) berichtet Herodot von kämpfenden Hunden. Alexander der Grosse begegnete auf seinen Eroberungen vielen, grossen Kampfhunden. Der Hunnenkönig Attila soll ebenfalls riesige Kampfhunde eingesetzt haben.
Bis zur Erfindung der Feuerwaffe waren Hunde durchaus effiziente Kriegsteilnehmer. Man befestigte beispielsweise Messer oder Pechfackeln an ihnen und schickte sie in die Reihen der gegnerischen Kavallerie. Eine andere Taktik sah so aus: Der Hundeführer schritt zunächst alleine den feindlichen Soldaten entgegen. Ein Sklave hielt den Hund zurück. Sobald es zum Nahkampf Mann gegen Mann kam, liess der Sklave den Hund los, der sich auf den Gegner stürzte im Bestreben, seinem Meister zu Hilfe zu eilen.
Römer, Mittelalter, Neuzeit
Wichtig ist die Bezeichnung "Molosser", die bis heute als Oberbegriff für grosse, massige Hunde verwendet wird. Das Wort geht auf die griechische Region Molossis in Epirus zurück. Was in der Überlieferung mit "Molosser" gemeint war, lässt sich nicht immer ganz klären. Die Römer haben den Begriff relativ undifferenziert für allerlei grosse und kräftige Hunde verwendet. Dennoch scheint ein gewisser realer Zusammenhang zur Region Molossis (oder weiter gefasst zu Griechenland allgemein) zu bestehen. Xerxes gelangte während den Perserkriegen im 5. Jahrhundert v.Chr. mit einer grossen Meute an Kriegshunden nach Griechenland. Alexander der Grosse brachte von einem Eroberungszug 150 Kampfhunde mit, die ihm in Indien geschenkt wurden und die er als Basis für eine eigene Zucht nahm. An diesen Beispielen lässt sich ablesen, dass viele grosse und kräftige Hunde von Osten her nach Griechenland gelangten, deren Ursprung womöglich bis nach Indien, Zentralasien, sogar China und Tibet zurückreichten. Diese Hunde wurden in den Stammraum der römischen Kultur importiert und gelangten von dort bis über die Alpen. Am Limes etwa wurden solche Molosser an den Grenzbefestigungen eingesetzt.
Generell bildete sich bei den Römern bereits eine differenzierte Rassen- und Nutzungsvielfalt heraus. Ein besonderes Einsatzgebiet von grossen und starken Hunden in römischer Zeit war der Kampf in den Arenen. Die Grausamkeit können wir uns heute kaum noch vorstellen. Gehetzt wurde alles auf alles. Tiere wie Elefanten, Löwen, Tiger und – als diese rar wurden – vermehrt Bären kamen in die Arena und kämpften gegeneinander oder wurden einfach hingemetzelt. Hunde wurden ebenfalls nicht verschont, man liess sie beispielsweise gegen Bären antreten. Aber die moralischen Tiefen sind damit noch nicht erreicht. So wurden Menschen in die Kämpfe einbezogen, die berühmten Gladiatoren. Oder Christen wurden teilweise in Felle eingenäht und Tieren vorgeworfen. Viele der Opfer wurden so auch von Hundemeuten zerrissen.
Die Germanen brachten den Hunden ebenfalls grossen Respekt entgegen und übertrugen ihnen vielfältige Aufgaben – nicht zuletzt im Krieg, wie die Römer in einer Schlacht gegen den Stamm der Kimbern schmerzlich erfahren mussten. Letztere waren bereits tödlich geschlagen. Doch ihre Hunde setzten den Kampf fort und verteidigten ihr Lager noch, nachdem es von ihren Herren bereits aufgegeben worden war.
Im Mittelalter und bis in die Neuzeit fanden schwere Hunde in kämpferischer Mission noch regen Gebrauch bei der Jagd auf grosses und wehrhaftes Wild. Beliebt war die Sauhatz. Aber auch auf Bären, Bullen oder Hirsche wurden die starken Hunde gehetzt. Andere wiederum dienten als abschreckende Bewacher. Auch in Kriegsdiensten standen sie noch. Als die Normannen 1066 in England landeten, setzten ihnen die Verteidiger grosse Kriegshunde entgegen. Doch die normannischen Eroberer wussten, dass es sich dabei um Rüden handelte. So schickten sie Hündinnen vor, um die vermeintlich starken Hunde-Männer zu irritieren. Offenbar mit Erfolg, wie der Fortgang der Geschichte zeigt: Die Normannen rissen die englische Krone bekanntlich an sich. Auch noch viel später, bei der Eroberung Südamerikas, fanden Blut- und Kampfhunde Verwendung in einer äusserst traurigen Rolle als gnadenlose Menschenhetzer.
Der militärische Nutzen von Hunden sank jedoch zusehend. Je grösser die Reichweite der eingesetzten Waffen, desto wirkungsloser agierten die Kampfhunde. Im ersten und zweiten Weltkrieg wurden zwar noch zehntausende Hunde rekrutiert. Die Rote Armee setzte sie sogar zur Bekämpfung von Panzern ein. Man schnallte ihnen eine Sprengladung um und trieb sie unter die feindlichen Panzer, wo die Ladung gezündet wurde. Doch die neue Waffentechnik mit ihrer ungeheuerlichen Feuerkraft liess den Hunden an der Frontlinie moderner Kriege keine Chance. So leisteten sie ihre Dienste mehr im Rückwärtigen als Sanitäts-, Melde-, Transportoder Spürhunde. Und dies ist bis heute so geblieben.
England – die Heimat vieler aktueller Kampfhunderassen
Hundekämpfe waren auf den britischen Inseln seit alters her beliebt. So erstaunt es nicht, dass viele der heute noch existierenden Kampfhunde-Rassen auf England zurückgehen. Stiere, Wildschweine, Bären und andere Tiere waren die Gegner. Andrea Steinfeldt beschreibt die Kämpfe in ihrer Dissertation so: "Der erste verbürgte Bericht von einem Kampf zwischen einem Bären und sechs "Bärenhunden" stammt aus dem Jahr 1050 n. Chr. Zur Belustigung des englischen Adels wurden die wild lebenden Bären in Fallen gefangen und zum Kampf gegen die Mastiffs gestellt. Bald entstanden rund um London eigens für den Bärenkampf angelegte Arenen, sog. "bear garden", in denen Bullen, Bären oder andere Raubtiere für die Tierkämpfe gehalten wurden. Grosse Förderer der Tierkämpfe waren die englische Königin Elisabeth I und James I, der sogar im Tower zu London eine grosse Anzahl von Bären und Löwen hielt und dort mit ihnen züchtete. Während der Regierungszeit von Elisabeth I (1558 - 1603) verbot sogar der Gemeine Kabinettsrat alle anderen Veranstaltungen am Donnerstag. Dieser Wochentag wurde traditionell für die "baitings" freigehalten, damit jedermann die Tierkämpfe besuchen konnte." (S. 43-44)
Zwei Hundetypen sind als Vorfahren der heutigen Kampfhunderassen wichtig: Der englische Mastiff und der Bulldog. Wie die Mastiffs entstanden sind, lässt sich nicht mehr eindeutig nachweisen. Möglicherweise handelte es sich um einen autochtonen Hundetyp, der selbständig auf den britischen Inseln entstanden ist. Vielleicht wurden sie aber auch von Kontinentaleuropa nach Britannien gebracht, wobei nicht auszuschliessen ist, dass ihre Wurzeln sogar bis nach Indien oder sogar Tibet (Tibetdogge) zurückreichen. Als die Römer die britischen Inseln eroberten, stiessen sie auf den Widerstand von Mastiffs. Deren Kampfeskraft musste so beeindruckend gewesen sein, dass die Römer solche Hunde in ihre Heimat brachten, um sie in den Arenen im Kampf einzusetzen. Dort stieg der englische Mastiff in den Rang einer zweifelhaften Legende auf – als dem Bezwinger der römischen Molosser.
Der Bulldog wiederum war ein enger Verwandter des Mastiff. Wahrscheinlich bildete er sich als kleinerer, stämmigerer Abkömmling heraus und spezialisierte sich (selbstredend) auf das Hetzen und Beissen von Bullen. Erstmals wörtlich erwähnt wird das Wort "Bulldog" im Jahre 1630. Die Entstehung der Bullenkämpfe selbst war wahrscheinlich ein Zufall. Es gibt dazu eine Legende aus dem 13. Jahrhundert, und die geht so: Zwei Bullen haben sich auf einer Wiese um eine Kuh gestritten. Plötzlich kamen Hunde und haben einen der Bullen durch die ganze Stadt gehetzt. Der Besitzer der Bullen fand das äusserst lustig. Er übergab den Metzgern die Wiese zum Gebrauch. Als Gegenleistung mussten sie einmal pro Jahr einen Bullen bereitstellen, der von Hunden gehetzt wurde. Daraus entwickelte sich ein echter Volkssport. Höhepunkt der Bullenkämpfe war die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Bevor ein Bulle geschlachtet wurde, musste er stets von einem Bulldog gehetzt worden sein. Man glaubte, das Fleisch würde so zarter. Es soll sogar immer wieder vorgekommen sein, dass Metzger angeklagt wurden, weil sie ein Tier schlachteten, ohne es zuvor von einem Hund hetzen zu lassen.
Die Anatomie der heutigen Bulldogs lässt noch klar erkennen, dass sie auf den Kampf gegen Bullen hin gezüchtet wurden, wenngleich es in der modernen Zeit ganz klar zu züchterischen Exzessen kam. Die Tiere sind zu schwer, unbeweglich – und wohl kaum noch in der Lage, einen Kampf zu führen. Die kurze Schnauze ermöglichte ein Verbeissen in den Bullen, wobei die Hunde ihren Gegner meist an der Nase attackierten. So wurde kein wertvolles Fleisch zerbissen oder die ebenfalls begehrte Haut beschädigt. Der Hund näherte sich in möglichst geduckter Stellung dem Bullen, damit er nicht auf die Hörner genommen wurde. Deshalb wurden sie tief gezüchtet.
Die Bullenkämpfe waren brutal und folgten strikten Regeln. Die Stiere waren zwar meist angepflockt. Dennoch wussten sie sich zur Wehr zu setzen. Oftmals flogen die Hunde durch die Luft, brachen sich beim Aufprall die Knochen. Anderen wurde der Bauch durch die Hörner aufgeschlitzt. Für viele endete der Kampf tödlich. Die Kämpfe arteten immer mehr aus. Bullen wurden zum Teil die Füsse abgehackt. So verstümmelt wurden sie den Hunden vorgeführt. Perverser Höhepunkt war eine Geschichte aus London, als sich ein Mann in den Ring stellte, um gegen einen Hund zu kämpfen. Dem Mann soll dabei ein halbes Ohr abgebissen worden sein.
Das Verbot von Tierkämpfen und die Entstehung des Pitbulls
Ab dem 18. Jahrhundert wandelte sich jedoch die öffentliche Wahrnehmung. Tierkämpfe wurden zunehmend als vulgär und tierquälerisch wahrgenommen. 1835 wurden sie in England schliesslich durch das Gesetz verboten. Doch die Tierkämpfe fanden trotz Verbot weiterhin statt – jedoch in der Illegalität. Im Verborgenen konnte man aber keine grossen Tiere wie Bullen auftreten lassen. So kamen Kämpfe mit kleineren Tieren auf: Hunde traten etwa an gegen Ratten, Dachse, Hähne und natürlich andere Hunde. Diese Kämpfe beanspruchten weniger Platz und wurden in Hinterhöfen und Lagerhallen abgehalten, womit man das Verbot umgehen konnte. Aber die Ausrichtung auf den Kampf mit kleineren Tieren hatte auch einen sozialen Grund und setzte schon vor dem Verbot von Tierkämpfen ein. Denn die Einsätze bei den Bullenkämpfen wurden für die sozial schwächeren Schichten zu teuer. Kämpfe mit kleineren Tieren hingegen blieben für den armen Mann erschwinglich.
Nur brauchte man dazu leichtere ...