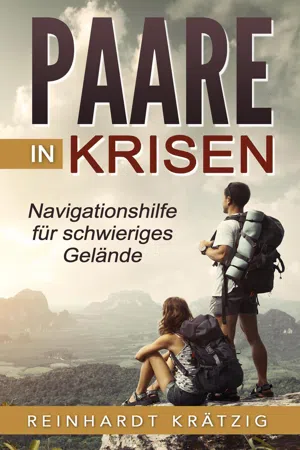![]()
TEIL 1
ICH-ANTEILE
Zustände innerer Beschränkung
Jeder Einzelne von uns hat großartige Fähigkeiten und könnte folglich viele Aufgaben des Lebens ganz allein bewältigen. Tun sich aber zwei Menschen als Paar zusammen, entsteht eine Gemeinschaft mit einem besonderen Potenzial an Möglichkeiten: Die Lebenserfahrungen und Fähigkeiten, das Können und Wissen von zwei Erwachsenen fließen hier zusammen. Allerdings tauchen auch Probleme auf, die ein Einzelner kaum hat. Bisweilen scheinen die beiden Menschen einfach zu komplex und zu verschieden, um problemlos miteinander leben zu können. Und wenn die zusammenfügende Kraft der Hormone beginnt nachzulassen, taucht die Frage auf, ob die Wahl nicht doch auf den falschen Partner bzw. die falsche Partnerin gefallen ist.
Paare, die sich für eine Paartherapie entscheiden, haben gerade wenig Zugang zu dem großartigen Potenzial ihrer Beziehung. Sie leiden stattdessen unter den permanenten Auseinandersetzungen, sie erleben das Miteinander als belastend und kommen auf ihrer Suche nach Lösungen nicht weiter. Oft geht der Kampf schon seit Wochen oder Monaten, manchmal schon seit Jahren. Es dominieren Streit und schlechte Gefühle. Das Miteinander erscheint eher als Beschränkungs- denn als Entfaltungsgemeinschaft. Manchmal ist nur einer der beiden Partner betroffen, oft aber beide: Beide erleben ihre gemeinsame Zeit als negativ und sind in engem Kontakt mit eigenem Leiden, Mangel und/oder eigener Not.
SZENE I
Sie: (beim Geschirrabwaschen) »Wieso bringst du eigentlich nie den Müll runter?«
Er: »Ich bin doch eben erst von der Arbeit gekommen.«
Sie: »Immer hast du eine Ausrede. Alles muss ich allein machen, nie bist du für mich da …«
Er: »Aber ich hatte doch schon gesagt, dass ich morgen zusammen mit dir aufräumen werde.«
Sie: »Morgen, morgen, immer nur morgen. Nie jetzt …«
Und so weiter und so fort. Wer von uns kennt solche Konfliktsituationen in einer Partnerschaft nicht? Für den einen fühlt es sich gerade so an, als wäre der andere auf einen sehr eingeschränkten Aspekt des Lebens fixiert. Dabei leidend, anklagend und überhaupt nicht offen für die eigenen Argumente …
SZENE II
Er: (abends im Bett, rückt in eindeutiger Absicht näher an sie heran)
Sie: »Nein, ich fühle mich nicht wohl, ich mag jetzt nicht.«
Er: (genervtes Seufzen)
Sie: »Was hast du denn? Wieso bist du gleich wieder beleidigt, ich habe doch gesagt, dass ich mich nicht wohl fühle. Das richtet sich doch nicht gegen dich.«
Er: »Heute fühlst du dich nicht wohl, morgen hast du Kopfschmerzen, übermorgen deine Tage. Danach keine Lust. Nein, das hat natürlich überhaupt nichts mit mir zu tun.«
Sie: »Komm, nun beruhige dich mal wieder.«
Er: »Ich soll mich beruhigen? Ich wüsste ein Mittel, um mich zu beruhigen, aber das interessiert dich ja nicht. Es interessiert anscheinend überhaupt niemanden, was ich will.«
Auch hier ist ein Partner in seiner Sicht der Dinge festgefahren und dabei nicht offen für irgendwelche Argumente oder gar Sichtweisen der anderen Seite. Alles Reden führt zu keiner Beruhigung, sondern eher zur Eskalation: Im ersten Beispiel wirft sie ihm vielleicht einen Teller vor die Füße; im zweiten zieht er mit seiner Bettdecke auf die Couch. Schlimmstenfalls verliert auch der zweite Partner seine ruhige Distanz – und es kommt zu einem heftigen Streit.
***
Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass beide Szenen einen Vorlauf haben. Vermutlich hat die Frau in Szene I schon seit längerem vergeblich versucht, ihren Partner zur Mithilfe im Haushalt zu bewegen. Und der Mann in Szene II hat offensichtlich schon mehrfach erlebt, dass seine Annäherungsversuche gescheitert sind.
Beide Szenen machen aber auch deutlich, dass es in dem Moment nur einen eingeschränkten Bezug zur Realität gibt: Der Abwaschenden ist es inzwischen vollkommen egal, dass er eben erst die Wohnung betreten hat; und der Mann im Bett ist für die Befindlichkeit seiner Frau überhaupt nicht zugänglich. Der Frau in Szene I geht es wie dem Mann in Szene 2: Beide sind in ihrem Erleben gefangen, fühlen sich persönlich nicht beachtet, und die Auseinandersetzung, die sie gerade führen, hat etwas Auswegloses. Was zudem auffällt: Das Timing für die Auseinandersetzung ist in beiden Fällen schlecht. Der Mann, der gerade von der Arbeit nach Hause kommt, wird sich wahrscheinlich nicht sofort den Mülleimer schnappen und voller Verständnis nach unten bringen. Und die Frau, die sich nicht wohlfühlt, wird kaum plötzlich Lust auf Sex haben.
In der Paartherapie kommen solche vordergründig banalen Situationen recht häufig vor. Durch Nachfragen lässt sich relativ einfach herausbekommen, um was es bei der Auseinandersetzung wirklich geht.
Die Frau, die gerade abwäscht, möchte, dass ihr Partner versteht, wie wichtig ihr hausfraulicher Arbeitsbeitrag ist. Sie will Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Sie will nicht immer die zweite Position in der leistungsorientierten Paarhierarchie innehaben.
In Szene II geht es dem Mann vordergründig um Sex, dahinter geht es aber in diesem Fall auch um die Würdigung seiner Arbeitsleistung. Er will ebenfalls gesehen werden und braucht die körperliche Gegenleistung seiner Partnerin als nonverbale Bestätigung seines Beitrags für die Familie. Da diese Bestätigung aus seiner Sicht schon zu lange ausbleibt, ist er entsprechend beleidigt und sauer.
Das Verhalten in beiden Beispielen ist offensichtlich nicht sehr zielführend. Vielmehr besteht die Gefahr, dass ein heftiger Streit entflammt – und das wichtige Ziel, Anerkennung für die eigene Person und Leistung zu bekommen, in weite Ferne rückt. Wieso aber reagieren denn zwei erwachsene Menschen mit solchen wenig dienlichen Hilfsmitteln?
***
Bisweilen erinnern diese Beispiele an das Verhalten einer ganz anderen Klientel, die eine psychotherapeutische Praxis aufsuchen: Angstpatienten. Hat ein Mensch zum Beispiel Angst davor, Fahrstuhl zu fahren, wird er diesen nicht benutzen, auch wenn sein Ziel im zehnten Stockwerk liegt. Vernünftigen Argumenten gegenüber ist diese Person in dem Moment überhaupt nicht offen. Ähnlich unflexibel wie die Protagonisten in den beiden obigen Szenen wird auch der Ängstliche auf seiner Überzeugung beharren, der Fahrstuhl sei ein gefährlicher Ort. Jedes wie auch immer geartete Argument wird einfach weggewischt. Die eigene (von anderen als eingeschränkt erlebte) Sicht auf die Realität setzt sich rigoros durch – auch wenn das eigentliche Ziel, zum Beispiel das zehnte Stockwerk, deshalb nicht erreicht werden kann.
Ebenso wenig ist ein Depressiver durch einen Hinweis auf die ihn umgebende Schönheit aufzuheitern oder der Zwanghafte von der Sinnlosigkeit seines zwanghaften Tuns zu überzeugen. »Du brauchst nicht noch einmal hineinzugehen, um den Herd zu überprüfen«, ist ein Satz, der vielleicht gehört, aber von dem Zwanghaften nie befolgt werden wird. Denn ist der Gedanke erst einmal da, dass der Herd womöglich noch nicht ausgeschaltet wurde, gibt es für den zwanghaft Misstrauischen keinen Ausweg mehr. Er bleibt der einmal in Gang gesetzten inneren Logik treu und wird frühestens dann wieder offen für andere Dinge dieser Welt sein, wenn er den Herd überprüft hat.
Bei all diesen Beispielen ist der Blickwinkel so sehr auf einen begrenzten Focus eingestellt, dass für die Wahrnehmungen und Gedanken anderer Menschen kein Raum bleibt … Derartige persönliche »Ausnahmezustände« sind die Ursache unendlich vieler Paarstreitereien. Dann muss der jeweils andere Partner ein großes Maß an Gelassenheit und innerer Ruhe aufbringen, um nicht sofort auf das angebotene Verhalten einzusteigen und selber »an die Decke zu gehen«.
Das »Steuerkind«
In einem Zustand innerer Beschränkung verhält sich die betroffene Person anders als sonst, sie sieht und empfindet anders und scheint auch anders zu denken. So, als wäre jetzt innerlich ein anderer Mensch am Steuer. Insofern scheitert dann auch jeder Versuch, einen »normalen« Kontakt herzustellen, denn dieser andere Teil hat kaum Zugang zu den Erfahrungen des normalen Alltags bzw. zu den Möglichkeiten erwachsenen Handelns; er agiert unflexibel und uneinsichtig. Irgendein Auslöser hat die Person in die Erlebenswelt der eigenen Kindheit eintauchen lassen. Zwar werden die Gegenwart und die dazugehörigen Personen noch wahrgenommen, doch ist nun alles so gefiltert, dass es wie einst als Kind erlebt wird. Es findet eine Realitätsverschiebung statt. In diesen Momenten ist der Mensch keineswegs fremdbestimmt, sondern mittendrin in diesem anderen Erleben. Alles, was gerade abläuft, wird von einer anderen Warte aus betrachtet. Wahrnehmung, Denken, Empfinden und Handeln unterliegen jetzt anderen Regeln und Bewertungsmustern. Es ist, als würde der Mensch plötzlich durch eine gefärbte Brille auf die Welt schauen: Manches ist nicht mehr zu sehen, anderes tritt besonders hervor. Nur, dass der Mensch nichts von der Brille auf seiner Nase weiß. Er ist davon überzeugt, nach wie vor dieselbe Realität wahrzunehmen. Wenn Sie jetzt versuchen würden, Ihrem Gegenüber beizubringen, dass er die Welt gerade verfremdet sieht, würde er Ihnen nicht glauben - schließlich wurde der Müll ja tatsächlich immer noch nicht runtergebracht … Die tiefergehende Veränderung des eigenen Erlebens ist für die betreffende Person zwar auch wahrnehmbar, wird aber als vollkommen stimmig und passend erlebt. Spricht die Person allerdings rückblickend über ihr Erleben in jenem Moment, ist sie von der Angemessenheit des Erlebens, Denkens und Handelns nicht mehr so uneingeschränkt überzeugt. Vielmehr erkennt sie, dass sie in einer besonderen Gemütsverfassung war, die nicht ihrem Normalzustand entspricht …
Im nächsten Abschnitt gehe ich etwas näher auf den theoretischen Hintergrund ein, kläre was ein Ich-Zustand ist, was ein kleiner und was ein erwachsener Ich-Anteil. Wen das weniger interessiert mag schnell durchblättern zur Seite →, zum Abschnitt: »So entstehen kleine Anteile«.
![]()
Kleiner Theorie-Exkurs
Teilpersönlichkeiten
Ich arbeite mit der Vorstellung, dass jede Person auch als Gruppe von Teilpersönlichkeiten beschrieben werden kann. Vermittele ich dieses Modell jemandem, der gerade – dabei vielleicht den Kopf schüttelnd - auf sein Erleben beim letzten Ehestreit zurückschaut, entsteht schon nach wenigen erklärenden Worten ein Konsens darüber, dass der jetzige Normalzustand von einer ganz anderen Teilpersönlichkeit gelebt wird, als es in jenem Streitzustand der Fall war. Auch die Bezeichnung als kleiner Anteil wird gerne akzeptiert.
Lassen Sie mich noch vorwegschicken, dass es sich bei den »Teilpersönlichkeiten« lediglich um eine Metapher handelt, die sich als nützlich erwiesen hat, um damit komplexe Prozesse im Menschen leichter erfassen und beschreiben zu können. Jochen Peichl sagt über Persönlichkeitsanteile, die er in seinem Ansatz als Ich-Zustände bezeichnet, dass diese lediglich »theoretische Konstrukte über die Funktionsweise unseres Gehirns darstellen«. Sie sind »eine Beschreibung der Funktion und der Organisationsstruktur des Ichs oder Selbst« und als solche »nicht subjektiv erfahrbar.«2 Bei jedem Menschen lassen sich somit etliche verschiedene Persönlichkeitsanteile – also verschiedene Erlebens-, Denk- und Verhaltensmuster – ausmachen. Das hat nichts mit Schizophrenie oder multipler Persönlichkeit zu tun. Bei diesen Krankheitsbildern wird zwar auch von Persönlichkeitsanteilen gesprochen, diese sind aber kein »integraler« Bestandteil der Person, sondern von dieser mitunter komplett abgespalten.
In der psychotherapeutischen Tradition wird seit langem mit der Idee gearbeitet, verschiedene Aspekte einer Person getrennt voneinander zu betrachten. So arbeitet schon Sigmund Freuds Modell vom Ich, Es und Über-Ich mit einer Unterteilung der komplexen menschlichen Persönlichkeit. Und Eric Berne, der gemeinsam mit Thomas A. Harris in den 1960er Jahren die Transaktionsanalyse als psychotherapeutisches Verfahren entwickelte, unterschied drei Ich-Zustände: Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich.3 Friedemann Schulz von Thun wiederum arbeitet mit dem Modell eines inneren Teams mit dem übergeordneten »Ich« als Teamleiter.4
Vermutlich ist Ihnen auch schon mal der Begriff »inneres Kind« begegnet. In diesem drückt sich die Vorstellung aus, das »innere Kind« existiere als unabhängiger Teil in der Person und müsse entsprechend angesprochen und behandelt werden. Auf dem Konzept, des inneren Kindes beruhen viele psychotherapeutische Ansätze5, unabhängig voneinander und aufeinander aufbauend, etwa seit den 1990er Jahren. Im Kern haben wir es hier mit zwei Anteilen der Person zu tun. Dem inneren Kind und einem erwachsenen Anteil, der die Aufgabe bekommt, dieses innere Kind wahrzunehmen, anzunehmen und in die Person zu integrieren. Die verschiedenen Ansätze formulieren das für sich aber jeweils anders und fügen je nach Betrachtungsweise andere Komponenten oder Aspekte hinzu. Therapieansätze, die ein Teile-Modell der Psyche in ihren Konzepten nutzen, zählt zum Beispiel Jochen Peichl auf.6 Aus dieser Liste möchte ich hier lediglich die Gestalttherapie und die Ego-States-Therapie anführen.
Ich selbst bin mit den Modellannahmen von Teilpersönlichkeiten in der Gestalttherapie bzw. einem Nachfolgeansatz, der Integrativen Therapie7, in Berührung gekommen. Dabei waren der »heiße Stuhl« und der »innere Stellvertreter« ebenfalls Ansätze mit verschiedenen Anteilen einer Person.
Ein grundlegendes Anliegen aller Ansätze, die mit einem Teile-Modell arbeiten, ist es, einen verstehbaren und handhabbaren Zugang zu dem komplexen Geschehen innerer Prozesse zu bieten. Auch Laien soll damit die Möglichkeit gegeben werden tiefenpsychologische Erkenntnisse in gewissem Maße für sich selbst zu nutzen. Auch wenn die komplexe Verschränkung von unbewusster und bewusster Psychodynamik damit oft nur ansatzweise erfasst werden kann, rechtfertigt der praktische Nutzen diese Vereinfachungen. Auf die Ego-States-Therapie möchte ich im Folgenden etwas näher eingehen, da ich ein ähnliches Grundverständnis habe und entsprechend ähnliche Begriffe in meiner Arbeit.
Ego-State-Therapie
Die Ego-State-Therapie (ego, lat.: ich: state, engl.: Zustand) ist ein jüngerer psychotherapeutischer Ansatz, dessen Grundlagen um 1980 von den US-Amerikanern John und Helen Watkins, zwei Pionieren der Hypnotherapie, entwickelt wurden. Sie griffen dabei ein Energiemodell von Paul Federn, einem Schüler Sigmund Freuds auf, das von verschiedenen Ego-States (Ich-Zuständen) innerhalb des Egos ausging. Die Ego-State-Therapie gewinnt aktuell insbesondere dank ihres Zugangs zu traumatherapeutischen Problemen wieder viele Interessenten. In Berlin wurde kürzlich das Institut für klinische Hypnose & Ego-State-Therapie gegründet. In der Ego-State-Therapie werden die verschiedenen Anteile der Person als Ich-Zustände beschrieben. Bisweilen ist auch von Ich-Anteilen die Rede. Dabei sind mehr als 6 Ich-Zustände eher die Regel als die Ausnahme. Ziel der Arbeit mit diesem Ansatz ist es, die Kooperation zwischen den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen zu verbessern. Dahinter steht die Erfahrung, dass seelische Probleme entstehen, wenn diese innere Kooperation gestört ist.
Definition: Ich-Zustand
Auf der Suche nach einer passenden Definition könnte man tief in die Theorie einsteigen, was ich aber vermeiden möchte. Ich beschränke mich daher auf mein Verständnis davon. Für unsere Fragestellung brauchen wir nicht mehr. Unter dem Ich (oder Ego) verstehe ich: «die von jedem Menschen selbst empfundene und als persönliche Einheit erlebte Summe aller geistigen und körperlichen Vorgänge«. Das was man als Ich benennt hängt also mit dem zusammen, was man e...