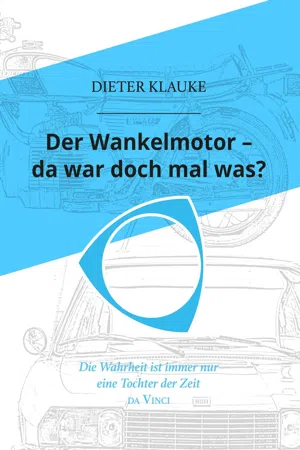
eBook - ePub
Der Wankelmotor - da war doch mal was?
Die Wahrheit einer Erfindung ist eine Tochter der Zeit
- 100 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der Wankelmotor - da war doch mal was?
Die Wahrheit einer Erfindung ist eine Tochter der Zeit
Über dieses Buch
Dieter Klauke war nach dem Studium Maschinenbau/ Kraftfahrzeugbau von 1965 an zwölf Jahre lang mit der Entwicklung von Wankelmotoren beschäftigt- zunächst als Versuchs-Ingenieur, dann als Versuchsleiter, anschliessend als Entwicklungsleiter. Später war er zehn Jahre Geschäftsführer von BRABON GmbH & Co KG in Bonn. BRABON unterstützt weltweit private Erfinder auf den Gebieten Energie- und Antriebstechnik. Wankel arbeitete lange an einem Motorkonzept, bei dem die Vorteile des 4-Takt-Hubkolbenmotors und die Vorteile der Gasturbine kombiniert werden sollten. Zur Anwendung kam der Kreiskolbenmotor, Wankelmotor genannt. Der große Markterfolg blieb seiner Erfindung jedoch verwehrt- warum eigentlich? Diese Frage beantwortet das vorliegende Buch.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Der Wankelmotor - da war doch mal was? von Dieter Klauke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Technik & Maschinenbau & Maschinenbau Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Erfinder und Erfindungen
Heureka! –ich habe gefunden! Wer hat`s gefunden? Die Schweizer? Ricola? Nein, das ist nur Werbung. Es war Archimedes bei den alten Griechen, der in der Badewanne den Zusammenhang zwischen Wasserverdrängung und Auftrieb gefunden hatte und vor lauter Euphorie splitternackt durch Syrakus gelaufen und „Heureka, Heureka“ gerufen haben soll. Seit dem gilt das Wort „Heureka“ als klassischer Ausruf von allen, die etwas Neues entdeckt oder erfunden haben. Oder die eine schwierige Aufgabe erfolgreich gelöst haben. Und diese Menschen nennt man Erfinder. Einer von ihnen war Felix Wankel, der Erfinder des nach ihm benannten Wankelmotors.
Der klassische Erfinder und sein Werk
Erfinder lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Da ist zunächst der angestellte Erfinder, der im Rahmen seines Aufgabengebietes z.B. als Konstrukteur oder Versuchsmann ständig nach neuen, besseren technischen Lösungen sucht. Hat er eine solche tragfähige Lösung gefunden, kann er in der Patentabteilung, wenn es sich um ein größeres Unternehmen handelt oder von einem Patentanwalt bei kleineren Firmen, ein Schutzrecht anmelden lassen. Bei Nutzung seiner dann patentrechtlich geschützten Erfindung erhält der angestellte Erfinder vom Arbeitgeber für seine außergewöhnliche Leistung eine Arbeitnehmer-Erfindervergütung. Das alles ist im Arbeitnehmererfindungsgesetz in der Fassung von 1957 geregelt. Die Erfindung gehört dem Arbeitgeber.
Die zweite Erfinder-Kategorie sind die freien Erfinder. Hat jemand eine phänomenale Idee zur Lösung eines bestehenden Problems oder einer Aufgabe, kann er diese durch eine Schutzrechtsanmeldung schützen lassen. Dazu bedient er sich eines Patentanwalt- Büros. Alles weitere macht und organisiert der Patentanwalt gegen Bezahlung, soweit es sich um die Formulierung, Verwaltung des Schutzrechtes, Gebrauchsmuster oder Patentes handelt. Die Erfindung gehört dem anmeldenden Erfinder oder, bei mehreren Erfindern, den Erfindern anteilig.
Ein Erfinder, so auch Felix Wankel, ist ein Mensch, der auf Grund seiner persönlichen Eigenschaften eine schöpferische Leistung vollbringt, die darin besteht, eine vorher nicht bekannte Lösung für ein bestehendes z.B. technisches Problem zu ersinnen, die es vorher nicht gegeben hat. Das kann bei weitem nicht jeder. Genauso wie nicht jeder gleich gut Fußball spielen kann wie Messi oder Ronaldo, so kann auch nicht jeder gleich gut neue technische Lösungen erdenken.
Ähnlich weit liegt die Kunst auseinander, erfolgreich neue, bisher unbekannte technische Lösungen zu ersinnen. Es gibt Menschen, die können das eigentlich wenig oder kaum. Zumindest gemessen an denen, die die wahren Genies auf dem Gebiet des Erfindens sind. Erfinder stehen bei weitem nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses wie Fußballer oder Künstler. Es sei denn, es gelingt ihnen, dem erfundenen Produkt ihren Namen zu geben. Z.B. der Fischer-Dübel, der Otto-Motor, Diesel-Motor. Aber wer kennt schon Blanchard, den Erfinder des Fallschirms? Oder wer weiß, dass Markoni den heute überall verwendeten Funk-Verkehr erfunden hat? Oder dass Klauke das beschleunigungsfeste Sicherheitsgurte-Schloß für Schloßstrammer erfunden hat? Genauso wie der Durchschnitts-Klavierspieler oder der Durchschnitts-Fußballer so blieben und bleiben auch die meisten Erfinder seit eh und je in der Öffentlichkeit unbekannt. Nicht so Felix Wankel.
Aber was ist denn ein Erfinder? Welche Stärken, Schwächen, besondere Eigenschaften zeichnen ihn aus, kennzeichnen ihn? In zehn Jahren direkter Zusammenarbeit mit Dutzenden von Erfindern würde ich „den Erfinder“ wie folgt beschreiben (Ausnahmen bestätigen die Regel):
Kreativität – Zunächst einmal muß er kreativ sein. Aufgeschlossen für alles Neue ist er bereit und neugierig genug, über den bestehenden „Tellerrand“ (das ist der Stand der Technik) hinauszuschauen. Er stellt bestehende Lösungen in Frage, ersinnt neue.
Logik – Er ist in der Lage, analytisch, systematisch und logisch zu denken. Dabei hilft ihm sein bildliches Vorstellungsvermögen, mit dessen Hilfe er auch neue, bisher nicht bekannte Funktionsabläufe geistig nachvollziehen kann.
Konzentration – Dabei ist er bereit und in der Lage, sich voll und ganz auf die Sache, von der er überzeugt ist, zu konzentrieren – bis hin zur Besessenheit. Er ist fixiert auf eine Idee, die die Lösung einer bestimmten Aufgabe darstellt, beschäftigt sich geistig mit ihr, Tag und Nacht. Ein Erfinder ist alt, wenn er morgens nicht mit einer neuen Idee aufwacht. Alles dreht sich bei ihm um diese erfinderische Idee, sie ist äußerst wichtig für ihn. Sehr häufig überschätzt er den Wert seiner erfinderischen Idee und ist überzeugt davon, dass die Menschheit nur auf diese seine Erfindung gewartet hat. Und er wird eines Tages ganz viel Geld damit verdienen. Glaubt er.
Mißtrauen – er behütet seine Idee, seine Lösung, sorgfältig wie die Glucke ihre Küken. Dutzende von Malen läßt er eine Vertraulichkeits-, Geheimhaltungs-Erklärung unterschreiben, selbst von Personen, die er zur Realisierung seiner Idee dringend braucht. Wie eine fixe Idee glaubt er, dass die ganze Welt nicht nur auf seine Erfindung gewartet hat, nein, ganz sicher will man sie ihm bestimmt heute oder morgen stehlen.
Hartnäckigkeit und Sturheit – dazwischen sind die Grenzen fließend. Sturheit – Erfinder beharren stur auf der Richtigkeit ihrer Ideen. Obwohl sie sehr oft vom eigentlichen Fachgebiet wenig verstehen, also Autodidakten sind, wissen sie ganz genau, dass nur sie eine Sache richtig sehen, obwohl sie keine oder nur selbst angelernte Vorbildung auf dem Gebiet ihrer Erfindung haben – oder gerade deshalb. Warum ist dem so? Weil Insider von vornherein viele denkbare Lösungsansätze aus Kenntnis der Sachzusammenhänge als ungeeignet verwerfen. Nicht so Autodidakten, also auf dem bestimmten Gebiet Ungebildete. Der wahre Erfinder sieht nichts für unmöglich an. Hartnäckigkeit ist die Vorstufe der Sturheit und, im Gegensatz zur Sturheit, äußerst wichtig für den Erfolg einer Erfindung.
Diplomatie – ist für die meisten Erfinder ein Fremdwort. Sehr oft sind Erfinder die absoluten Un-Diplomaten. Es gibt gar nicht so viele Fettnäpfchen, in die der Erfinder nicht immer wieder gern tritt. In vielen Fällen, in sehr vielen Fällen, scheitert eine gut brauchbare Erfindung an diesem diplomatischen Ungeschick. Immer wieder verprellt er ernsthaft interessierte Unternehmer derart, dass diese zum Schluss entnervt sagen: „… alles gut und schön. Und wir würden ja gern … aber dieser Herr … unmöglich, nein danke“. Das ist sehr oft so. Deshalb braucht ein Erfinder auch jemanden, der ihn führt.
Management – dieser Punkt gehört ein wenig zum vorigen Punkt. Einem Erfinder mit einer guten technischen Lösung für ein bestehendes Problem kann nichts besseres passieren, als dass er zufällig oder mit Absicht jemanden findet, der ihm seine Erfindung abnimmt, um sie an Unternehmen und – je nach dem – in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn der Erfinder die Kraft und Einsicht aufbringt, das zu akzeptieren und der Manager gut ist, erhöhen sich die Erfolgschancen sofort ganz erheblich.
Öffentlichkeitsscheu – ist durchaus bei vielen sehr ausgeprägt, aber längst nicht bei allen.
Geld – und dann sind da noch die ganz wichtigen Finanzen. Bevor nämlich ein Erfinder mit seiner Erfindung Geld verdient, hat der liebe Gott einiges an Investitionen gesetzt. Arm, oft verschuldet, das kennzeichnet viele Erfinder. Von der erfinderischen Idee bis zum Serienprodukt ist es meist ein sehr sehr langer Weg. Das durchschaut der Erfinder meist nicht, weil ihm die Kenntnis fehlt. Schon mit der Schutzrechtsanmeldung wird der Erfinder unverhofft mit einem vierstelligen €-Betrag konfrontiert – nur für den Anfang! Spätere Folgekosten für Auslandsanmeldungen, Prüfungskosten ect. ergeben gern einen fünfstelligen €-Betrag. Und dann entstehen ja auch noch Kosten für Funktionsmusterbau, Prototypen und und und. Höchst selten „kauft“ ein interessiertes Unternehmen eine „Idee“. Im Regelfall möchten Lizenznehmer am liebsten ein serienreifes Produkt kaufen. Das Mindeste aber ist, dass der potentielle Lizenznehmer die Serientauglichkeit nachgewiesen haben will. Und was das alles kostet!
Gern wird dieser Zusammenhang in einfachen Worten so beschrieben: 1-2% des Aufwandes für die Umsetzung einer Erfindung ist Inspiration – d.h. das Erfinden an sich – und 98 – 99% ist Transpiration. Damit ist die Arbeit und der Aufwand gemeint, die bzw. der notwendig ist, um „im Schweiße des Angesichtes“ (Transpiration) aus der Erfindung ein verkaufsfähiges Produkt zu machen. Diesen Zusammenhang sieht der Erfinder gern ganz anders. So ist für ihn die Erfindung das Wesentliche. Der Rest bis zum Serienprodukt, na ja, das muß halt auch noch gemacht werden. So wird bei der Umsetzung einer technischen Idee in ein Produkt als erstes, oft schon bei der Schutzrechtsanmeldung und beim Bau eines Funktionsmusters oder Prototyps, das Geld knapp. Also sucht er Förderer und Geldgeber, die, nachdem sie seine Schulden bezahlt haben, ihn finanziell und organisatorisch unterstützen. Oft nicht zu deren Nachteil. Denn erstens dauert immer alles länger als man denkt und zweitens wird immer alles teurer als man denkt.
Erfinder neigen dazu, in immer wieder neuen Endlosschleifen des Erfindens eines bestimmten Produktes einzutreten – im Bestreben der ständigen Weiterverbesserung der Erfindung. Oft findet er kein Ende. Da ist er gut beraten, wenn Außenstehende einen Schnitt machen. Und ihn davon überzeugen, dass das einfach notwendig ist, um nicht ins Uferlose zu geraten.
Es war einmal eine Erfindung ...
Es ist einfach nicht möglich, ein Datum für eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte zu bestimmen. Aber sehr gut nachvollziehbar in Sachen Definition einer Erfindung, sehr gut verständlich und sehr gut zum Wankelmotor passend, ist die Erfolgsgeschichte und deren ungeheure Tragweite für die Menschheit: die Erfindung des – Rades.
Das ursprünglich zu lösende Problem bestand darin, für das Transportieren von Lasten – Menschen, Waren, usw – bisher mit den hin und her gehenden und dabei tragenden Beinen von Lebewesen – Mensch und Tier – eine bessere Lösung zu finden. Wer das Genie war, dem als Lösung dieser Aufgabe das Rad einfiel, ist heute nicht mehr festzustellen. Ein Patentamt gab es noch nicht und mit dem Schreiben auf Pergament war es auch noch nicht weit her. Vielleicht findet man irgendwann einmal im westlichen Afrika, da, wo auch Luzie gefunden wurde, der Wiege der Menschheit also, einmal eine Steintafel, auf der der geniale Erfinder das erste Rad skizziert hat. Und vielleicht sind dann dabei auch irgendwie die üblichen Reaktionen des ursprünglichen Homo Sapiens vermerkt, die sich auch heute noch jeder Erfinder immer wieder anhören muß: „Geht doch sowieso nicht.“ Zumindest in diesem Punkt hat sich wohl über Jahrtausende wenig geändert.
Worin bestand also die Lösung dieser Aufgabe? Stand der Technik war, Lasten auf menschlichen Schultern zu tragen, bestenfalls auf einer Trage oder in Form einer Sänfte. Die erfinderische Idee bestand nun darin, aus einer Geh-Bewegung mit hin und her gehenden Gliedmaßen eine Drehbewegung zu machen, die Drehbewegung des Rades. Statt des Gehens von Mensch und Tier unter der Last des zu tragenden Gewichtes, wurde die Last nun mit Hilfe der Drehbewegung von Rädern auf einem Karren transportiert. Eine wirkliche Problemlösung bis zum heutigen Tage. Man denke nur an unsere Autos, die heute noch nach dieser genialen Idee funktionieren.
Die Erfindung „Verbrennungsmotor“
Das Rad als Beispiel für eine geniale Erfindung wurde in unserem Zusammenhang aus einem bestimmten Grund gewählt. Und dieser Grund heißt Wankelmotor. Denn im Gegensatz zum Hubkolbenmotor, bei dem die Drehmoment erzeugenden Bauteile wie Kolben und Pleuel ebenfalls hin und her gehen – letztendlich der Dampfmaschine nachempfunden – ist es beim Wankelmotor die ausschließliche Drehbewegung aller an der Erzeugung des Drehmomentes beteiligten Hauptteile. Alles dreht sich – nichts geht hin und her. Letztendlich der Turbine nachempfunden.
Tatsächlich besteht ein Verbrennungsmotor, im Gegensatz zum Rad in unserem Beispiel für eine Erfindung, aus einer Vielzahl von Funktionen. Das Auf- und Abgehen des Kolbens, das Übertragen des Verbrennungsdrucks im Verbrennungsraum über Kolben und Pleuel auf die Kurbelwelle, ist dabei nur eine dieser vielen Funktionen. Oder dem vorgeschaltet die Steuerung des Frischgasstroms über das Einlaßventil nach Menge und Zeit. Direkt vergleichbar mit der Steuerung und das Ausschieben des Abgases durch das Auslaßventil. Das alles sind Neben-Funktionen, die notwendig sind, die eigentliche Schlüsselfunktion, die Basisfunktion des Verbrennungsmotors, möglich zu machen. Nämlich die direkte Umwandlung von chemischer Energie im Kraftstoff-Luft-Gemisch durch dessen Verbrennung im Brennraum zunächst in thermische Energie, dabei in Druckenergie und letztendlich in mechanische Energie. Und auf diesem letzten funktionalen Schritt, nämlich der Umwandlung von Druckenergie in mechanische Energie, bietet Felix Wankel eine andere, neue, erfinderische Lösung an: Statt des hin und her gehenden Kolbens und einem Pleuel, das diesen Kolben mit der Kurbelwelle verbindet und die Druckkraft auf den Kolben in eine Drehkraft, das Drehmoment, auf die drehende Kurbelwelle überträgt, bietet die Wankel`sche Lösung die direkt vergleichbare Funktion mit nur mehr drehenden Bauteilen an. Diese bestehen aus einem dreieckigen, über eine Verzahnung geführten Kolben und der Exzenterwelle, die man auch Kurbelwelle nennen könnte.
Aber ist die Lösung, die hin-und-her-gehenden Bauteile durch ausschließlich drehende Bauteile zu ersetzen, Selbstzweck? Oder gilt es nicht, auch andere Funktionen in diese Betrachtung mit einzubeziehen? Z.B. die Thermodynamik mit der damit verbundenen Wärmeabfuhr beim so unwirtschaftlichen Verbrennungsverlaufs eines Verbrennungsmotors, bei dem von 100% Wärmeenergie im Kraftstoff gerade mal 0 (Leerlauf) bis max ca. 40% (bester Punkt nach Last und Drehzahl beim Diesel-Motor) genutzt wird, während der Rest als störende Wärmeenergie anfällt, die irgendwie b...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Motto
- Vorwort
- Prolog
- Erfinder und Erfindungen
- Systemvergleich Hubkolbenmotor (Benzin) vs. Wankelmotor
- Kostenvergleich 4-Takt-Hubkolbenmotor vs Wankelmotor
- Wertung der Erfindung „Wankelmotor“
- Epilog
- Impressum