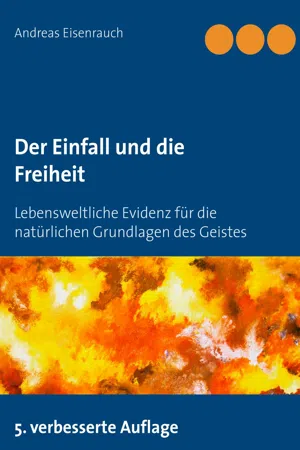![]()
II. Teil: Folgerungen
1. Intuitionen und Illusionen
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!
(Weiche dem Übel nicht aus, sondern gehe nur noch wagemutiger dagegen an! Vergil, Aeneis 6, 95)
Es ist bisher die verbreitete Auffassung, dass wir aus der Beobachtung unserer Lebenswelt, insbesondere aus der Art und Weise, wie wir entscheiden und agieren, die Intuition gewinnen könnten, wir hätten so etwas wie die Fähigkeit, bewusst und frei darüber zu entscheiden, was wir wollen und was wir zukünftig tun werden. Wir beobachten an uns, dass uns an den zahllosen Zeitpunkten unseres Lebens, an denen von uns Entscheidungen verlangt werden, zumeist mehrere Möglichkeiten bewusst werden und dass wir jeweils auch um einige Gründe wissen, die für und wider jede dieser Möglichkeiten sprechen. Wir meinen, an uns beobachten zu können, dass wir durch „Überlegen“ unsere Gründe miteinander vergleichen, sie gleichsam gegeneinander abwägen, um herauszufinden, welchen Gründen wir im konkreten Falle das höchste Gewicht einräumen müssen. Und tatsächlich, in den meisten Fällen, wenn wir uns entschieden haben, weist die Entscheidung sichtlich einen starken Bezug auf die Erfahrungen auf, die wir im Laufe unseres Lebens zu dem jeweiligen Thema gemacht haben: Der oder die besten Gründe haben meistens die Entscheidung begründet.
Hinzu kommt noch das „Erlebnis der Effizienz“. Wir erleben, dass wir zumeist sehr schnell und inhaltlich angemessen auf die meisten Herausforderungen der Lebenswelt eingehen, die von uns Handlungen und den Handlungen vorgängige Entscheidungen heischen. Solche Leistungsfähigkeit wird gemeinhin als weiteres Indiz für eine – zumindest im Kern- gehirnunabhängige Entscheidungsinstanz aufgefasst, weil der Materie weder die Schnelligkeit noch die Kapazität zur Bewältigung der lebensweltlichen Datenmengen zugetraut werden89 (siehe in Abschnitt 1.6 Heidelbergers Zweifel an einer materiellen Verwaltung der vielen Formen der Menschen, einander zu grüßen).
Als wesentliche Eigenschaften einer solchen abwägenden, freien Willensbildung werden daher zumeist die selbstbestimmte Urheberschaft der entscheidenden Person genannt, und in diesem Zusammenhang die Kontrolle über die Gründe und über deren Abwägung, über das gesamte Überlegen, das zu dem finalen Willen führt, der im Folgenden durch Wort und Tat ausgedrückt werden kann. Die Rede von „Überlegen“, „Abwägen“ und ähnlichen Tätigkeiten suggeriert Aktivität und Autonomie, ja geradezu Autokratie im Reich der eigenen Erfahrungen und Gründe.
Im Gegensatz zu dieser gängigen Meinung zeigt jedoch die unvoreingenommene Beobachtung der menschlichen Lebenswelt, dass beide Kriterien nicht erfüllt sind. Denn der Freiheitsintuition steht die lebensweltliche Tatsache der Existenz der Einfälle entgegen. Die elementarsten Ereignisse unseres Denkens, finden in der Form von Einfällen aller unserer Gedanken statt. Die Einfälle haben ihren Ursprung außerhalb des Bewusstseins, sie lassen sich nicht aus dem Bewusstsein heraus beeinflussen und sie entstehen eben nicht durch selbstbestimmte, kontrollierte Urheberschaft der bewussten Person. Wenn man bereit ist hinzusehen, ist es lebensweltlich unübersehbar, dass damit auch keine bewusste Kontrolle über Gründe vor Entscheidungen und über die Entscheidungen selbst ausgeübt wird. Kontrolle über die Gründe setzte überdies voraus, dass bekannt sei, wo und wie über diese verfügt werden könnte, in welcher Form sie existieren, wie sie miteinander verknüpft sind. Nichts von alledem ist uns lebensweltlich bekannt, keine dieser Operationen führen wir bewusst und kontrolliert durch90. Kein Einfall und kein Vergessen ist das Ergebnis einer bewussten Aktion. Und solange ein Gedanke nicht „von selbst“ einfällt, ist er überhaupt nicht existent und es kann kein solcher Gedanke gedacht werden, er wird nicht Gegenstand in den Vorstellungen von Überlegungen und Abwägungen.
Diese Sachverhalte haben selbst auch den Status einer Intuition, denn unsere gewachsene Sprache nimmt ganz selbstverständlich die Unfreiheit im „Umgang“ mit unseren Gedanken in den Begriffen um den Einfall, das Einfallen und Entfallen in ihr Vokabular auf. Sie bestätigen die verbreitete Auffassung, dass wir alle unsere Begriffe „gemacht oder erfunden haben, um unsere Erfahrung von der Welt und von uns selbst zu artikulieren“91.
In den Status einer Intuition gelangt diese Unfreiheit jedoch vollends dadurch, dass sie aus der eigenen Erfahrung eines jeden Individuums selbst stammt. Viele Einwände gegen die naturwissenschaftlich begründeten Thesen zur Entscheidungsfreiheit haben den Kern, dass die Ergebnisse der Beobachtung von Menschen durch die Naturwissenschaftler immer Beschreibungen aus der „Dritte-Person-Perspektive“ sind, welche die Phänomene, die allein aus der „Erste-Person-Perspektive“ bekannt sind, die also nur durch Sätze in der „Ich“-Form vollständig ausgedrückt werden könnten, prinzipiell nicht erreichen können. Die Intimität der mentalen Zustände und kognitiven Leistungen erlaubte demzufolge nicht einmal die Definition dessen, was überhaupt beobachtet werden soll92.
Es ist aber unsere eigene Selbstbeobachtung, unser persönliches Erleben aus der „Erste-Person-Perspektive“ wenn wir einräumen müssen, dass uns etwas nicht einfällt oder dass uns etwas entfiel, ohne dass wir es wollten. Wir erleben, dass wir darauf warten müssen, dass von uns bewusst nicht zu beeinflussende Prozesse uns unsere Gedanken bewusst werden lassen. Wir erleben, dass wir unseren Gedankenstrom nicht frei gestalten können. Diese erlebte Erkenntnis ist nicht von der eventuell voreingenommenen Beschreibung durch Dritte abhängig und nicht durch experimentelle Messfehler gefährdet. Das „Ich kann mich nicht erinnern (obwohl ich es will)“ und das „Ich weiß nicht, warum mir X gerade eingefallen ist“ sind die auch für philosophische Erörterungen unhintergehbaren, lebensweltlichen Tatsachen, weil sie auch den Verteidiger der Freiheit treffen, der selbst nicht die Freiheit hat, seinen Gedankenstrom zu beeinflussen.
Es wäre wohl wünschenswert, wenn das, was uns in der Form von Einfällen bewusst werden muss, willkürlich und im Zuge rationaler, alle Gründe einbeziehender Abwägung herbeigeführt werden könnte.
Aber dann stünden am Anfang solcher Vorkommnisse Aufrufe -und wir würden sie auch so benennen- was lebensweltlich kontrafaktisch ist und hoffentlich bald auch allgemein als kontraintuitiv anerkannt wird. Nach unserer Analyse müssen die Begriffe des Fühlens, Denkens, Abwägens und Entscheidens den Begriff des Einfalls mit umfassen, beziehungsweise von ihm abgeleitet werden, denn es gibt kein Denken ohne Einfall. Würden wir unsere Gedanken aufrufen, dann würden wir für alles, was uns in Wahrheit einfällt, intuitiv auch den Begriff des Aufrufs anwenden. Alle anderen Begriffe wie sehr sie sich auch auf Erfahrung beziehen, bezeichnen Vorkommnisse und Phänomene, die erst eingetreten und wahrnehmbar sind, erlebt werden, nachdem sie eingefallen sind. Unsere Sprache spiegelt gewiss getreulich alle Erscheinungen wider, über die wir sprechen müssen. Aber das Vorhandensein verheißungsvoller Begriffe zu aktiv-bewussten Interventionen in der Gedankenwelt liefert aber beileibe keine Gewissheiten darüber, in welchen Abhängigkeiten die begriffenen und bezeichneten Phänomene untereinander stehen. In der Sprache sind die Bezeichner zu diesen Begriffen alle gleichwertig in Sätzen einsetzbar; als Phänomen ist das, was mit dem Begriff „Einfall“ verbunden ist, ursächlich für die Phänomene, mit denen alle Begriffe des Denkens und der geistigen Arbeit assoziiert sind. Obwohl sicherlich schwer verdaulich für Menschen, die sich gerne für über die Natur erhaben halten möchten, ist somit die Intuition der Unfreiheit die fundamentale Intuition, denn sie widerlegt die essentiellen Annahmen, die der Intuition der Freiheit der Entscheidung und des Willens zugrunde gelegt werden: Aktives, selbstbestimmtes Denken und Entscheiden einer wie auch immer gearteten bewussten Person! Dem Einfall gebührt hier zweifellos der Primat. Der Einfall ist aber der lebensweltliche Indikator der Unfreiheit.
Und mehr noch: Auch alle mentalen Zustände, die uns bewusst werden, die nichts mit erlernten, sprachlichen Inhalten zu tun haben, werden uns auch nur als Einfälle bewusst. Schmerz, Hunger, Zorn und Sympathie, die sprichwörtliche „Liebe auf den ersten Blick“ überfallen uns, ohne dass wir irgendetwas am Vorgang ihres Einfallens oder Vergehens ändern können. Diese mentalen Zustände und alle sie begleitenden Qualia sind keine Gewähr für unsere geistige Freiheit, auch wenn sie wissenschaftlich nie zu erklären sein werden. Sie entstehen ebenfalls in unbewussten „Tiefen“ und entziehen sich auch jeder bewussten Steuerung, denn wer beispielsweise Ängste hat, dem kann man sie vielfach nicht einmal durch gute Gründe nehmen.
Es handelt sich bei alledem nicht um eine Ohnmachtsintuition aus missverstandener Begrifflichkeit, wie von Bieri vorgestellt93. Die Ohnmacht ist ein ganz real spürbarer Teil unserer Lebenswelt: Wir können die Abfolge unserer Gedanken und Entscheidungen de facto nicht bewusst beeinflussen. Die Gedankengänge, deren wir als Überlegen gewahr werden, die einigen Menschen die Gewissheit94 zu geben scheinen, einen freien Willen zu haben, sind keine Serie von durchgeführten Abwägungen, an deren Ende ein Wille so beeinflusst wurde95, dass er einen von der abwägenden Person gewünschten Inhalt annimmt. Stattdessen haben wir Serien von Einfällen, in denen zunächst eher Gründe bewusst werden, dann aber auch die Ergebnisse von Entscheidungen, die wir den Willen nennen96. Es gibt in unserem Bewusstsein keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem „Überlegen“ und dem „Willen“, in dem Sinne, dass jenes ein Akteur wäre, der Einfluss ausüben könnte und dieses dessen Objekt, das nach Belieben aus- und umgeformt werden könnte. Beiderlei Erscheinungen sind gleichermaßen einfallende Gedanken mit lediglich unterschiedlichem Inhalt. Sie fallen ein, wenn das Gehirn in einen entsprechenden Zustand eintritt, und sie vergehen wieder, wenn sich ein anderer Gehirnzustand einstellt. Freiheit wurde von Bieri unter anderem so definiert: Der „aus Freiheit Wollende erlebt seinen Willen nicht wie eine Lawine, [...], gegen die er aber nichts auszurichten vermag“97. Aber ein normaler Mensch, der nicht umhin kann, seine Gedanken als Einfälle zu erleben, kann wirklich nichts anderes „tun“, als seinen Willen und jeden anderen Gedanken zu erwarten und so zu erleben, wie er kommt, und er kann tatsächlich nichts dagegen ausrichten. Wenn wir nun Bieris Definition von Freiheit mit der Wirklichkeit unserer Einfälle vergleichen, erkennen wir ganz genau, dass wir unsere Entscheidungen nicht bewusst treffen, und wie abhängig unser Wollen von Ursachen ist, über die wir keine Macht haben. Wir sehen, dass der Wille demnach nicht mit dem Überlegen variiert98, sondern das Überlegen selbst und der Wille variieren mit dem „Cuncta fluunt...“ unserer unwillkürlichen Einfälle. Für die Freiheit des Entscheidens bedeutet das ganz eindeutig: Meine Überlegungen sind Einfälle, also bin ich nicht frei -nicht frei vom Wirken der Entität, die den Gedankenstrom generiert.
Die plausibelste Antwort auf die Frage, wer oder was denn nun das Denken und den Willen erzeugt, modifiziert und gegebenenfalls wieder auslöscht, lautet eben, dass diese Vorgänge die Begleiterscheinungen der Aktivitäten der Gehirne sind. Die Thesen der Hirnforscher –aus deren Experimenten abgeleitet- für sich genommen wurden als nicht ausreichend eingestuft, um das gängige Selbstbild der Menschen zu modifizieren, der lebensweltlichen Evidenz hingegen können sich die Kritiker der Hirnforscher nun nicht mehr entziehen.
Beim Zusammenzählen der Fakten ergibt sich, dass die ganze Person, die „Ich“ sagen kann, letztlich die Summe der behaltenen sinnlichen Wahrnehmungen ihres Körpers ist, der das Gehirn umgibt und erhält99. Sie entsteht im wahrsten Sinne des Wortes automatisch und in jedem Falle selbstorganisiert, als das Ergebnis der lebenslangen Aufnahme von Sinnesdaten. Mit Rücksicht auf die lebensweltliche Präsenz der Indikatoren der Unfreiheit ergibt sich daraus eine andere Sicht auf grundlegende Eigenschaften der Menschen und auf einige bisher vertretene philosophische Konzepte. Deren Erörterung sollen im Wesentlichen die folgenden Kapitel dienen. Insbesondere der Charakter der Person als ein virtuelles Konstrukt, das Epiphänomen seiner konstituierenden Daten und Historie, wird weiter unten noch in einem eigenen Kapitel ausführlich erläutert100. Die Einfälle aller Vorstellungen und Entscheidungen sind permanente, kontinuierliche und vor allem simultane Begleiterscheinungen der selbstorganisierten, bewusstlosen Abläufe im Gehirn. Die Einheit unserer Person und unsere Urheberschaft sind durch...