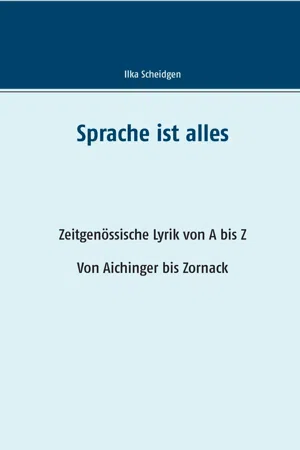![]()
Eva Strittmacher
Davon können die meisten Lyriker nur träumen, mit Gedichtbänden ein Millionenpublikum zu erreichen. Das hat sich die am 8. Februar 1930 in der Fontanestadt Neuruppin als Eva Braun geborene, spätere Ehefrau des schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft in den frühen 50er Jahren berühmten Schriftstellers Erwin Strittmatter auch lange nicht vorstellen können.
Denn sie veröffentlichte ihren ersten Gedichtband mit dem für sie so sprechenden Titel „Ich mach ein Lied aus Stille“ erst 1973.
Künstlerehen sind zumeist problematisch. Meistens herrscht ein Ungleichgewicht zwischen den Partnern, so auch bei Eva und Erwin Strittmatter.
Eva, die in einem kulturfernen Elternhaus aufwuchs – ohne ein Buch, „nicht mal die Bibel“, wie sie sagt – hat sich aber schon als Kind den Besuch des Gymnasiums ertrotzt.
Sie machte 1947 ihr Abitur und studierte anschließend an der Humboldt-Universität Germanistik und Pädagogik. Das Gespür für Poesie, für den Klang und Rhythmus war tief in ihr angelegt, erste Gedichte schrieb sie schon mit zwölf Jahren, das Studium hinderte und blockierte erst einmal auf Jahre ihr Ausdrucksvermögen, weil sie sich die Frage stellte, was kannst du dem noch hinzufügen .
Auch als sie anfing, literaturkritische Aufsätze für die Zeitschrift „Neue Deutsche Literatur“ zu verfassen, war sie beherrscht von einem Gefühl der Unsicherheit und Vermessenheit.
Umso erstaunlicher, wie diese bescheidene Frau, die es nicht liebte, im Mittelpunkt zu stehen oder in der Öffentlichkeit aufzutreten, zu einer der meistgelesenen
Autorinnen der DDR, vor allem aber zur meistgelesenen Lyrikerin zu werden. Es war die fast klassische Schönheit und Einfachheit ihrer Gedichte, vielfach Volkliedern ähnelnd und durch ihren Reim und Klang sehr eingängig, die ihr ein so großes Lesepublikum bescherten.
Ich mach ein Lied aus Stille
Und aus Septemberlicht.
Das Schweigen einer Grille
Geht ein in mein Gedicht.
Der See und die Libelle.
Das Vogelbeerenrot.
Die Arbeit einer Quelle.
Der Herbstgeruch von Brot.
Der Bäume Tod und Träne.
Der schwarze Rabenschrei.
Der Orgelflug der Schwäne.
Was es auch immer sei,
Das über uns die Räume
Aufreißt und riesig macht
Und fällt in unsre Träume
In einer finstren Nacht.
Ich mach ein Lied aus Stille.
Ich mach ein Lied aus Licht.
So geh ich in den Winter.
Und so vergeh ich nicht.
Sie stünde in der Tradition eines Heinrich Heine, einer Droste-Hülshoff oder Rilke wurde ihr nachgesagt. Wesentlicher noch für die große Resonanz ihrer Gedichte sind die große Ehrlichkeit, die man aus jeder Zeile spürt, eine übergroße Sensibilität, eine Genauigkeit und Lebendigkeit im Ausdruck, im Schaffen von Bildern, die im Gedächtnis haften bleiben.
Und immer sind es die großen Themen, die überpersönlich sind: Liebe und Leid, Trauer und Hoffnung, Angst und Scham. Eva Strittmatter hat besonders einfühlsame Naturbilder geschaffen. 1996 hat sie rückblickend erkannt, „was die Konstante meines Lebens ist: Das Verhältnis zur Natur, die Rührung über ihre Erscheinungen“.
„Leben ist immer eine Kraftprobe, und die eigentliche Leistung des Dichters ist die Bejahung des Irdischen, seine rücksichtslose Benennung und dennoch schlackenlose Verbrennung zu Sprache und Licht“, hat sie einmal gesagt. Pathos war dieser Dichterin fremd, sie mochte nicht den hohen Ton. Die Stille, das Licht, die Bäume, das Gras – diese simplen Dinge hatten für sie eine kosmische Dimension.
Rühr mich an, Gras, sprich mit mir.
Graues Gras des falben Sandes.
Waldgras, Raingras sprich zu mir
Ohne Worte des Verstandes.
In der Gesprächsbiografie mit Irmtraud Gutschke „Leib und Leben“ (2008) gibt Eva Strittmatter offen Auskunft über ihr Leben an der Seite des 18 Jahre älteren Ehemanns Erwin mit seinen Höhen und Tiefen.
Wie sie ihr Leben doch zuvorderst in seinen Dienst stellte, vier Kinder und einen Hof versorgte im ländlichen Schulzenhof, weitab von der Großstadt Berlin, in der sie zuerst als freie Schriftstellerin und Lektorin beim Deutschen Schriftstellerverband gearbeitet hatte.
Sechs Jahre lang traute sie sich nur heimlich Gedichte zu schreiben. Sie bewunderte zwar die Sprachkraft ihres Mannes, der als „Staatsdichter“ mit Werken wie „Der Laden“ , „Der Wundertäter“ und „Ole Biedenkopf“, in denen er einen proletarischen oder bäurischen Realismus kultivierte, berühmt und zum Nationalpreisträger geworden war. Sie bewunderte an seinen Romanen, wie er es vermochte, „aus dem Lebensmaterial etwas so zu verdichten, dass eine andere Welt entsteht, eine andere Sichtweise, eine Gegenwelt zu der tatsächlich gelebten.“
Aber sie wollte sich auch selbst ausdrücken. Auf ihre Weise. Und das war die Poesie, nicht die Romanform. Sie wollte nicht nur Bäuerin sein. Das alles zu bewältigen, muss oft schwer für sie gewesen sein. Bis für sie klar war: „Ich muss etwas tun, ich muss eine Schale sprengen. Ich kann mich nur befreien durch Sprache, nur durch Worte kann ich mich befreien. Nur so kann ich mich ins Gleichgewicht bringen, dieses Gefühl von Unglücklichsein, von Spannung abwerfen: durch das Spiel der Worte:“
Persönliche Erfahrungen, ein ständiges Horchen in die Stille und Schauen in die Natur und immer wieder ein schonungsloses Befragen und Bloßlegen innerster Gefühle und Gedanken kristallisierten sich in ihren Versen zu wahrhaftiger Schönheit, zu einer Vollkommenheit im Einfachen.
Und das erkannten ihre vielen Leser, zuerst in der DDR, nach der Wiedervereinigung auch in Westdeutschland, wo sie bis dahin fast unbekannt war.
2006 brachte der Aufbau Verlag ihre „Sämtliche Gedichte“ heraus. Von ihren Lesern wurde sie geliebt für so aufrichtige Gedichte voller Weisheit wie dieses:
Werte
Die guten Dinge des Lebens
Sind alle kostenlos:
Die Luft, das Wasser, die Liebe.
Wie machen wir das bloß,
Das Leben für teuer zu halten,
Wenn doch die Hauptsachen kostenlos sind?
Das kommt vom zu frühen Erkalten.
Wir genossen nur damals als Kind
Die Luft nach ihrem Werte
Und Wasser als Gewinn,
Und Liebe, die unbegehrte,
Nahmen wir herzleicht hin.
Nur selten noch atmen wir richtig
Und atmen Zeit mit ein,
Wir leben eilig und wichtig
Und trinken statt Wasser Wein.
Und aus der Liebe machen
Wir eine Pflicht und Last.
Und das Leben kommt dem zu teuer,
Der es zu billig auffasst.
In ihnen kann sich wohl jeder wieder finden. Diese „Aufmerksamkeit für das Leben“, wie sie sie nannte, im Schmerz noch „eine Art Lebensfreudigkeit“ zu bewahren, ist ein großer Vorzug ihrer Lyrik. Und doch ist sie, wie sie bekennt, durch viele Verzweiflungen gegangen. Mit der Poesie hat sie versucht, „Kräfte und Gegenkräfte ins Gleichgewicht zu bringen“.
Nach dem Tod ihres Mannes 1994 ordnete sie seinen Nachlass und gab seine letzten Schriften heraus. Seit vielen Jahren war sie selbst...