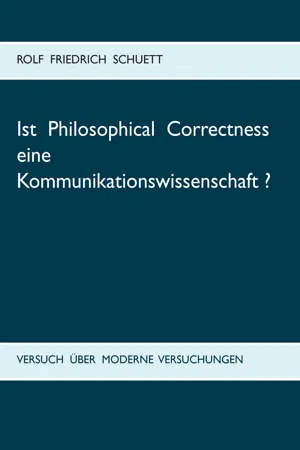![]()
Es ist nicht gerade ein Kellerloch wie von Dostojewskij ausgedacht, aber mehr kann er sich nicht leisten, ohne mehr im Leben zu leisten, um eine Wohnung zu mieten, die diesen Namen verdienen würde. Sicher, die Zeiten sind schlechter geworden und das Leben teurer, aber so wie er muß niemand leben, den er je gekannt hat. Viele sind nur vor hohen Mieten in Eigenheime und Eigentumswohnungen geflüchtet, wenn die Familie schon mit zwei Kindern zu groß wurde. Mit den Jahren hat es noch jeder von denen, die gleichzeitig mit ihm den Lebenslauf starteten, weitergebracht als er. Will er nicht oder kann er nicht, fragen sich die wenigen, die sich überhaupt noch fragen, wenn sie ihn sehen. Seine 50-qm-Heimat läßt sich gerade genug heizen, um sich ohne Mantel in ihr aufzuhalten und die Heizung bezahlen zu können. Läßt es das Wetter auch nur halbwegs zu, ist er ohnehin im Freien. Könnte er nicht mehr seine Beine benutzen, wäre das ein größtes Unglück. Es ist ja nicht so, daß nichts ihn mehr treffen könnte, obwohl er im Laufe der Jahre alles darangesetzt hat, die Angriffsfläche denkbar klein zu halten für das Schicksal, das andere Menschen ihm bereiten könnten, ob sie es wollen oder nicht, seine Mit - und Gegenmenschen, die durch das, woran sie ihr Herz gehängt haben, viel leichter als er wie an einem Mühlstein in die Tiefe gezogen werden können, wie er sich einbildet. Da er es nie anders zu versuchen wagte, weiß er allerdings nicht, ob diese Vermutung eine bloße Illusion ist, die es ihm erlaubt, sich gelegentlich in einiger Sicherheit zu wiegen, in Sicherheit auch vor der Gefahr, daß ihm ein zu großes Glück zustoßen sollte. Das ist der Preis, den er zu zahlen glaubt für seine verhältnismäßige Unangreifbarkeit.
Ins Büro geht er morgens, als ginge er nicht dorthin. Er weiß kaum, welcher Teil von ihm die Arbeit tut. Je weniger Freude der Dienst macht, umso drückender wird er, aber Gewohnheit ist ein unfehlbares Betäubungsmittel ohne alle Nebenwirkungen und auch Gegenindikationen. Zuweilen dehnt sich der Achtstundentag, der umso mehr auffrißt, je weniger die Seele mit ihm zu schaffen hat, zum Vierzehnstundentag des vergangenen Jahrhunderts, und viel mehr Vergangenheit gesteht er sich nicht zu. Er hat nicht den falschen Beruf. Das Falsche ist, daß er einen Beruf hat. Der Leib braucht Speise und Trank, Kleidung und ein warmes Dach überm Kopf und hat auch schon B gesagt, wo er A sagen muß. Über seinen Körper ist er mit der übrigen Welt verbunden, nicht mit seinem Herzen und seinen Gedanken. Wie soll er die Liebe zu seinem Körper nicht hassen, durch den er erpreßbar ist. Ist das der Grund der Arbeitsteilung zwischen Leib und Seele, Hand und Kopf?
Der Zwang, Geld zu verdienen mit Tätigkeit, die anderen nützlich ist, macht puritanisch. Durch diesen anspruchsvoll anspruchslosen Körper gehört er der Welt. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen ihm und seinen Art- und Zeitgenossen. Der Leib verbindet, der Geist trennt. Man hört es immer umgekehrt. Also hält er den Körper kurz, gewöhnt ihn an billige Sonderangebote vom Grabbeltisch der großen Warenhäuser, an geringe Temperaturen, an Saisonobst und Gemüserohkost. Die Betriebskantine versorgt ihn stets mit ernährungswissenschaftlich ausgewogenem Mittagessen, Zwischenmahlzeiten gibt es aus Schokoladentafeln, honigsüßer Haferflockenmilch. Kein Rauchen und kein Trinken, nur schwarzer Tee und abwechselnd heiße und kalte Duschbäder, ein Hartschwamm reibt den Körper rot auf. Der einzige Sport sind Spaziergänge und Eilschrittpromenaden und etwas schweißtreibende Zimmergymnastik, Übungen aus den Turnstunden der Schulzeit. Kein Auto, kein Telephon und kein Fernseher, aber Waschmaschine und Kühlschrank sind vorhanden. Ein solches Asketenleben setzt eine florierende kapitalistische Wirtschaft voraus. Nur der Wohlstand von Hochindustriegesellschaften erlaubt doch diese mutwilligen Enklaven und wirft Brocken ab vom großen Kuchen für freiwillig Arme. Er weiß, wie abhängig von den Konjunkturen seine ganze Unabhängigkeit ist. Es ändert wenig, ob er sich weniger oder mehr anstrengt, seine wirtschaftliche Grundlage abzusichern oder zu verbessern. Irgendwie hat er den kindlichen Traum, daß eines Tages die Roboter alles Lebensnotwendige gratis oder spottbillig liefern werden. Wer mehr will, wird dann arbeiten müssen dafür. Aber sicher ist er nicht, daß die gute Mutter Natur in den Robotern wieder auferstehen wird und ihr verschwenderisches Füllhorn… Da bleibt ein Stachel. Bis dahin ist eine überlegene und rationelle Haushaltsführung nötig, die Zeit und Geld und Nerven spart.
Er hätte gern gelebt nach der Regel: Wer weniger nehmen will, muß weniger geben. Je mehr er sich verausgabte, umso weniger bekam er, und je mehr er bekam, desto weniger hatte er zu geben. Also gilt es, warme Nischen zu finden, in die sich drücken läßt. Beziehungen zu haben und dafür spielen zu lassen, ist ihm verwehrt; er ist zu ungeschickt, zu stolz. Gibt es Fluchtlöcher nur 'nach oben'?
Und die Menschen um ihn herum? Mit Mühe und Not, mit Ach und Krach lösen sie sich von ihren Eltern und Nestern. Und wozu die ganze Anstrengung? Einmal ihrer Herkunft ledig und aus ihren Familien ausgebrochen, haben sie nichts Eiligeres zu tun, als eigene Familien zu gründen, eben genau die gleichen wie die, aus denen sie kommen. Sie sind gerade noch stolz darauf, an ihren Kindern nicht die gleichen groben Schnitzer zu wiederholen, die ihre Eltern und Erzieher an ihnen verübten. Nun tun sie das Gegenteil, also dasselbe in Grün. Kann man sich von seinen Eltern nicht lösen, ohne selbst Eltern zu werden? Frei von der Familie durch die Familie für die Familie? Er tätschelt das Baby, das sie ihm stolz entgegenhalten: Das haben wir geschaffen und geschafft! Sie brauchen es ja so, daß dieses winzige gefräßige Ungeheuer sie braucht und ihr Leben mit Haut und Haaren packt und knetet und walkt und in Dienst nimmt. Dieses Opfer für diese Freß- und Kack-und Schreimaschine, die das Gleiche ist wie sie und doch etwas anderes, dieses Opfer ordnet sie ein in die heilige Kette des Lebens, immer dasselbe und zugleich wieder etwas ganz Neues. Es ist ihr Glied in der Kette der Geschlechter und weist ihnen ihren Platz zu im großen Weltenplan. Sie tun es für sich selbst und für die Menschheit zugleich, und das ist das Poetische daran.
Das Kind ist dafür da, daß sie dafür da sein können. Und sie sind dafür da, daß es ganz für sie da ist; so ist allen geholfen. Das Kind gibt ihnen gerade dadurch alles, daß es ihnen noch nichts geben kann. Demütig nehmen sie von ihm entgegen, daß es alles von ihnen entgegennimmt, was sie ankarren und sich dafür ausdenken. Dafür geht Er morgens zur Arbeit, dafür geht Sie morgens nicht zur Arbeit, oder umgekehrt oder beide teilen sich darin oder… Vater, Mutter und Kind. Daß Es Wachs in IHREN Händen ist, ist Wachs in SEINEN Händen? Ihr eigen Fleisch und Blut und doch schon sternenweit weg von ihnen, ihre Einheit in einer Person, die nicht mit ihnen zusammenfällt; sie staunen immer wieder über dieses Wunder, das sie sind: Eins plus Eins ergibt Ein Fleisch und ein drittes. In ihm werden sie sich selbst überleben, es ist die Zukunft ihrer eigenen Zukunft, das küssbare und mit Händen greifbare Unterpfand ihrer Unsterblichkeit, die über sie hinwegrollt. Was sie ihren Kindern tun, tun sie sich selbst, und sie können nichts für sich selbst tun, ohne etwas für ihre Kinder zu tun. Der Geist der Gattung arbeitet mächtig in ihnen, und beflissen schwitzend tun sie ihre vergnügliche Pflicht und vergnügen sich pflichtschuldigst.
In dieser Selbsterhaltung liegt eine seltsame Selbstlosigkeit. Sie kommen nie zu dem eigenen Leben, von dem sie dauernd reden und das darin besteht, ihrem Kind zu einem Leben zu verhelfen, das seinerseits damit vergeht, einem eigenen Kinde… Eltern von Kindern zu werden, um nicht Kinder von Eltern zu bleiben, ja schön, aber wozu das Ganze, wenn jeder sein Leben auf sein Kind verschiebt, das sein Leben auch nur wieder auf sein Kind verschieben wird… Gibt es denn gar nichts zwischen diesen Extremen, solche Kinder in die Welt zu setzen oder gar keine? Sie glauben, ihr eigenes Leben zu führen, wo sie nur den Gattungsauftrag erfüllen. Die Gesellschaft der Menschen überlebt mit Hilfe und auf Kosten aller ihrer Glieder. Wo ist das Leben, um dessen willen das alles veranstaltet wird? Überall dieser verschwenderische Rohstoff, aus dem niemand das macht, was doch… Von den Eltern empfängt jeder mehr, als er ihnen zurückerstatten kann. Die Schuld macht er an seinen Kindern gut. Jeder gibt weiter, was ihm gegeben wird: Ein ungerechter Tausch? Ach, schon der gerechte Tausch von Nehmen und Geben ist ungerecht. Warum nicht an den Brüsten der Roboter liegen und Milch und Honig einsaugen? Erst die Mutter, dann die Maschine, die Fortsetzung der Mama mit materiellen Mitteln, und alles gratis: Liebestechnik. Was würden sie nur tun, wenn sie nichts mehr zu tun hätten? Es würde ihnen fehlen, daß ihnen etwas fehlt. Wenn es Not und Mangel nicht gäbe, sie würden das alles erfinden. Immer puzzeln sie an etwas herum, ihr ewiges Schnüffeln und Wittern amüsiert ihn. Kritisch, sensibel, aufgeschlossen und kommunikationsfreudig stecken sie ihre Nasen aus ihren Angelegenheiten hinaus, in Kehrichthaufen wühlend. Ihm selbst ist etwas schon dadurch verleidet, daß ein anderer es gut leiden kann.
Diese misanthropischen Anwandlungen leistet er sich aber nur, solange es ihm gut geht und er keine Hilfe nötig hat. Geht es ihm schlecht, denkt er nach ihren Köpfen, um nicht aus der Solidargemeinschaft herauszufallen ins unwirtliche Abseits. Nur ein Schönwetteraußenseiter ist er, der andere dafür haßt, daß er sie um etwa angehen muß. Verbunden mit seinesgleichen fühlt er sich erst am tiefsten, solange er sie sich vom Leibe halten kann. Was er bei ihnen sucht und zuweilen auch findet, scheint ihm eher Tribut an seine vegetative Plattform als an seine peinlichen Bedürfnisse. In sehr schwachen Stunden kosmischer Verlassenheit sucht er Unterschlupf in seinem Stammhirn.
Von einer Minute zur anderen kann Hoffnung in Verzweiflung und Angst in Zuversicht umschlagen, wie aus dem Nichts. Ein Grund findet sich immer, und alles kann zu einem Grund werden. Für manche Menschen wird es nicht erst schlimm, wenn Ärzte ihnen nicht mehr helfen können, sondern schon, wenn sie ärztliche Hilfe überhaupt brauchen. Ein Nichts kann sie in Panik versetzen und ihren Verstand außer Kraft setzen.
Menschen, die auf ihr Glück oder auf die Wissenschaft bauen, haben das Glück, so sorglos zu sein, daß sie nichts mehr wissen, aber der Ängstliche läßt sich nur in seltenen Augenblicken zu einem Mutigen machen, der Held jederzeit zum Hasenfuß.
Seine Empfindlichkeit muß er als Marschgepäck in Kauf nehmen, als Mitgift, die die Art der Prüfungen bestimmt, denen er ausgesetzt ist. Die Starken haben keineswegs die Kraft, stark zu sein, sondern nur eine Schwäche für ihre Kraft, für die sie nichts können. Der Starke freut sich, wenn er geheilt wird; der Schwache freut sich, wenn er gesund bleibt.
Der Starke holt sich sein Recht; der Schwache tut alles, um die Hilfe der Gerichte nicht zu brauchen. Aber wer ist schon dankbar genug dafür, daß er um die Erfahrung herumkommt, dankbar sein zu müssen, wenn er seine Gesundheit und sein gutes Recht zurückbekommt?
Einmal Klassenprimus, immer Primaner? Die Quelle der Freuden kann Quelle der Leiden werden: Die Freude, der Erste zu sein, wird lebenslange Sucht, nicht der Zweite zu werden. Was bleibt von so einem noch übrig, wenn er sich nicht mehr aufspielt und hervortut? Er kann den Bescheidenen mimen, um seine Arroganz vor sich wie vor den anderen verbergen, von denen er immer bewundert werden will; im Herzen ist er nur froh, wenn er andere ausgestochen hat. Aber er wird seiner Schadenfreude nicht froh, weil sie Angst vor Strafe ist. Er wird ein ewiges Kind bleiben, und die Sätze, mit denen er angibt, bleiben ungedeckte Schecks. Bekannte, die er beneiden müßte, sind ihm erspart geblieben, Bekannte, die ihn beneiden könnten, aber ebenso.
Mancher Schriftsteller entwirft Welten, in denen er gar nicht leben könnte. Er schreibt über seine Verhältnisse. Seine Werke sind nur Gedankenexperimente, die von den Lesern auszuwerten sind. Der Leser muß selbst entscheiden, was daran ist, der Künstler übernimmt nicht die Verantwortung für seine Figuren.
Ganz still im Sessel sitzen oder auf dem Sofa liegen und sich nicht bewegen, sondern zusehen, wie Wolken vor dem Fenster vorüberziehen: Nicht träumen und nicht sabbern. "Des Daseins süße Wollust" von Mörike, ganz ohne Magenbeschwerden, Herzrasen und Gelenkschmerzen. Lass die Karawane an dir vorüberziehen, du versäumst nichts. Werde nichts als ein Blick, der sich auf die Welt wirft und nichts von ihr will. 'Blühe im Verborgenen', halte dich abseits und aus allem raus. Bleibe für dich und schließ dich nicht an, wenn dir dein Leben lieb ist. Allein ist der Schwache am stärksten.
Die Gemeinschaft mit diesen Leuten ist der Tod zu Lebzeiten. Das Immunsystem muß mit solchen Erregern und Erregungen fertig werden. Sei ein bloßer Blick mit einem Körper dran, über den du mit dem Weltall schon genug verbunden bist. Der Kopf sollte frei bleiben: Er ist jener Teil des Körpers, der mehr ist als dieser Körper. Laß sie alle doch reden und vergiß nicht, daß das Wesen des Menschen im Denken liegt: Im Gedanken ist gerade das Gefühl am besten aufgehoben, sagt mir das Gefühl. Schau aus dem Fenster in den Garten der anderen, bis da aus heiterem Himmel dieses Gefühl ohne Vorwarnung heiß in dir aufschießt: Alles, alles ist möglich. Aufbruch und Aufschwung ohne Maß, und eine neue Welt will sich durch dich in die Welt setzen, und du merkst etwas davon.
Nur für Minuten oder Sekunden hält das an, dann wieder bleiernes Dösen und verdrossenes Stieren wie immer – bis zu einem neuen Blitz durch alles hindurch. Keine traumtänzerische Vision von alten Schwarmgeistern, aber auch kein unvergrübelt weltläufiger Sinn für strohpraktische Nüchternheit. Eher ein göttlicher Überschuß und ein verspielter Übermut ist das.
Schaufel dich leer, bagger dich aus und sieh dich um, die Dinge bluten aus. Stich in dich hinein und sieh, daß es nur ein aufgeblasener Ballon ist. Seine Form ist die Form der Dinge, die du siehst: Alles nur heiße Luft, die zischend entweicht. Ein verschrumpeltes Gummihäutchen bleibt auf dem Boden der Tatsachen liegen. Du staunst das an. Das ganze Problem besteht nur darin, wie du aus dem Vollen deiner Leere schöpfen sollst. Das heißt schöpferisch sein, ohne erschöpft zu sein. Es gibt eine Sitzung auf einem stillen Örtchen und die körperliche Entleerung, es gibt auch ein geistiges Pendant dazu.
Die Dinge sind nicht das, was sie dir erscheinen und wie sie dir vorgemacht werden. Sie sind nichts – von all dem. Viel Lärm um nichts, much ado nothing und alles nur heiße Luft, und Bohnenstroh im Kopf. Du sitzt vor dem dunklen Theatervorhang deines Inneren, aber es wird nicht gespielt: Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Du wirst dich enttäuschen müssen.
Hast du mehr von dir erwartet? Da kommt nichts, da kam niemals etwas, und da wird nie etwas kommen. Gewöhnliche Menschen finden sich damit ab. Da kannst du drücken und pressen, bis sie grün und blau werden und ein Tröpfchen der ätherischen Essenz aus sich herausgequetscht haben. Stich dich an und laß die edlen und die eklen Säfte abfließen. Laß den Bewußtseinsstrom ablaufen, bis du nicht einmal mehr ein leerer Behälter bist, der nur irgendwo im leeren Behälter des Weltraums herumsteht. Dann warte, ohne einzuschlafen, auf das Wunder. Wenn nur das zurückkehrt, was du gerade hinausgeworfen hast, dann fang wieder von vorn an.
Wenn du vor dir sitzt und es passiert rein gar nichts, dann kannst du es auf nichts und niemanden abschieben. Niemand dreht dir heimtückisch den Hahn zu oder tritt dir fest auf den Schlips. Niemand gräbt dir das Wasser ab, polt deine Gedanken um, zapft sie ab oder überflutet dich mit kosmischen Strahlen. Von nichts kommt nichts, heißt es. Dann funktioniert die Methode eben nicht, oder du hast Pech gehabt oder bist eine taube Nuss. Dein Menschenrecht, es noch einmal und wieder und wieder zu probieren, bleibt davon natürlich ganz unberührt: Neues Spiel, neues Pech. Mesdames et messieurs, faites votre jeu de maximes! Du bist dann nur dazu verurteilt, von den produktiven zu den reproduktiven Künstlern überzuwechseln, von den Spielern zu den Kiebitzen und von den Könnern zu den Kennern. Kein Grund zur Panik, ein verdorbenes Leben ist nicht ungenießbar. Die Reproduktion der Gattung in den Familien und die Produktion in den Fabriken sind für jene, die Kreationen nur als Modeschöpfungen kennen.
Wenn er schon für seinen Lebensunterhalt arbeiten mußte, dann wollte er keine Berufskarriere, sondern nur einen Job. Wenn er schon nicht ganz allein sein konnte, dann wollte er wenigstens keine Familie gründen, sondern nur eine Lebensgefährtin finden. War die "Große Verweigerung" von Beruf und Familie schon selbst die chronische Krankheit, die ihn mit fünfzig Jahren treffen sollte? Die proletarischen Eltern hatten seine Eigenart so gut geschützt, wie sie konnten, und waren ebenso stolz gewesen wie er selbst, daß er von der ersten bis zur letzten Schulklasse der Primus blieb. Spätestens mit 17 Jahren wurde ihm klar, daß es ihm immer schwer fallen würde, sein Geld zu verdienen, weil er sowohl die proletarischen wie die gutbürgerlichen Brotberufe haßte. Er wußte nicht, welche Berufe ihn mehr abstießen, kaufmännische oder technische, soziale, politische oder kulturelle. Einige Jahre lang träumte er von einer wissenschaftlichen Laufbahn, aber dann entdeckte er, daß alles, was ihn an der Naturwissenschaft anzog, ein Mißverständnis war. Als Künstler oder Intellektueller auf den freien Markt zu gehen, ist ein Widerspruch in sich: Das einzige, was geistige Arbeit wertvoll macht, ist die Distanz zum Betrieb. Er war kein Faulpelz und kein Träumer, sondern las und schrieb mehr als alle Gleichaltrigen, die er kannte, aber verdiente lieber Geld, um schreiben zu können, als daß er nun schrieb, um Geld zu verdienen. Die langjährige Psychoanalyse war ein Teil der Neurose, die sie heilen sollte. "Arbeits- und Genußfähigkeit" waren wiederherzustellen? Er konnte für sich arbeiten, aber wollte nicht für andere arbeiten, und das genoß er.
Weder die mehrjährige Einzeltherapie noch die ebenso mehrjährige Gruppentherapie befreite den proletarischen Autodidakten von all seinen Selbstzweifeln, die als "depressive Neurose" diagnostiziert wurden. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, wußte er, und wollte sich vom ökonomischen Moloch doch nicht auffressen lassen. Am Tage gab der Leib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und am Abend gab sich die Seele, was ihr frommte. Aber das riß ihn schließlich in der Mitte durch, Körper und Geist fielen psychosomatisch auseinander. Allzulange war er stolz gewesen, sein Geld zu verdienen wie alle, wenn auch ein bißchen weniger als sie, und gleichzeitig ein Werk zu schaffen, das mehr war als alles, was andere schafften. Wer beides zugleich will, erreicht am Ende das eine so wenig wie das andere. Die Psychotherapie hatte nur das eine Gute, daß sich ein Mensch jahrelang intensiver mit ihm beschäftigte, als es heute selbst unter Familienmitgliedern üblich ist. Früher war der Ehepartner mein Psychotherapeut, heutzutage bin ich mit meinem Psychotherapeuten gegen meinen Ehepartner verbündet. Die Therapeutin glaubte sich mit ihm einig, daß die Seele eine Familie gründen wollte und nur nicht konnte, aber nach Hunderten von Couch-Stunden litt der Patient immer noch nicht genug unter seiner Eigenbrötelei, um seine Neurose gegen ein glückliches Berufs- und Familienleben einzutauschen.
Seinen Eltern blieb er immer sehr dankbar, daß sie ihn eine höhere Schule besuchen ließen, obwohl er sie nicht besuchte, um eine bürgerliche Berufsausbildung als Facharzt, Lehrer oder Rechtsanwalt vorzubereiten, sondern eine brotlose Allgemeinbildung als proletarischer Intellektueller. Ein Vierteljahrhundert lang ging er jeden Morgen in einen Industriebetrieb, als ginge er nicht dorthin. Er fühlte sich als Arbeitsloser, der zufällig Arbeit hat. Von Kafka hatte er weniger die Begabung als den Zwiespalt zwischen Schreibkräften und Angestellten. Sein sehr bescheidener Stolz beschränkte sich darauf, eher ein programmierender Schriftsteller als ein schriftstellernder Computer-Programmierer zu sein. Vor dem eigenem Arbeitsplatz hatte er so viel Angst wie vor eigenen Kindern. Er wußte nicht, welche Angst größer war, die Angst um den Arbeitsplatz oder vor dem Arbeitsplatz. Sein Fluch bestand darin, Kindersegen als Fluch zu fürchten. Er hatte nicht nur das Leben, das er verdiente, wie Sartre von Baudelaire schrieb, sondern im Grunde, alles in allem genommen, sogar das unverdiente Leben, das er ja immer gewollt hatte – wenn diese chronische Krankheit nicht gewesen wäre. Oder war das Leben, das er sich immer gewünscht hatte, auf dem Sofa mit einem Haufen von dicken Büchern, von Anfang an schon ein Kompromiss mit seiner später diagnostizierten Immunschwäche gewesen? Was wollte der Eigenbrötler aber nun eigentlich mit dieser chronischen Unwilligkeit, ein Berufs- und Familienleben zu führen? Dieser Hinterhof-Sokrates bewies uns allen, daß sie die Weisheit, die er selbst nicht hatte, auch nicht gepachtet ha...