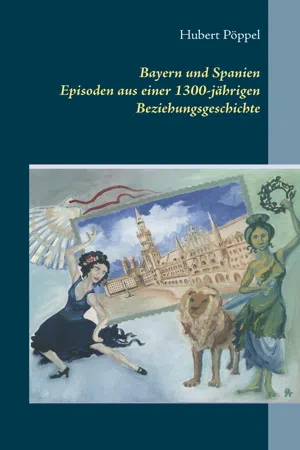
- 292 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Von den Agilolfingern bis heute spannt sich die Geschichte der Begegnungen zwischen Bayern und Spaniern. Kaiser und Könige wie Karl der Große, Karl V. und Ludwig I. haben daran mitgewirkt, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Doch sie und die große Politik bilden nur den Hintergrund. Im Mittelpunkt des Bandes Bayern und Spanien stehen die Geschichten der Menschen, die die Geschichte der bayerisch-spanischen Beziehungen geschrieben haben. Dabei kommen viele kuriose, ja skurrile Begebenheiten, einige traurige, aber auch einige wahrhaft unterhaltsame und spannende Episoden aus 1300 Jahren ans Licht.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Bayern und Spanien von Hubert Pöppel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Medienwissenschaften. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
König Ludwig I. und die spanische Sprache:
der Briefwechsel mit Lola Montez und das Theaterstück Recept gegen Schwiegermütter
Italien, Griechenland und Frankreich sind gemeinhin die Länder, die man mit König Ludwig I. von Bayern verbindet. Dass er auch eine besondere Beziehung zur spanischen Sprache gepflegt hat, gerät hingegen oft aus dem Blick. Dabei beschäftigte er sich in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens intensiv mit dem Spanischen.
Ohne Zweifel war der Auslöser dafür seine „spanische“ Geliebte, die Irin Lola Montez, mit der er, sonderbar genug, ausschließlich auf Spanisch korrespondierte. Doch auch nach dem Ende dieser Affäre, als König im Ruhestand, ließ ihn die Faszination für Spanien und seine Literatur nicht mehr los. So kam es, dass er 1864 die eher seichte Komödie Recetas contra las suegras unter dem Titel Recept gegen Schwiegermütter ins Deutsche übersetzte und damit durchaus Erfolge auf den Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum feiern konnte.
Bevor wir aber zu diesen beiden bayerisch-spanischen Episoden des Königs kommen, sei ein kurzer Überblick über die Entwicklung der deutschen und bayerischen Beziehungen zu Spanien bis zu Ludwig vorausgeschickt. Denn die Einstellung gegenüber dem fernen Land hinter den Pyrenäen war in Deutschland seit der Frühneuzeit gespalten, und die Verteilung von positiven und negativen Spanienbildern spiegelte, wenig überraschend, ziemlich genau die Konfessionsgrenzen wider.
Das Spanienbild in Deutschland und Bayern zur Mitte des 19. Jahrhundert
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts überwog im protestantisch geprägten Teil Deutschlands das Bild eines feindlichen und rückständigen Spaniens. Wenige kannten das Land, seine Sprache und seine Kultur aus eigener Anschauung. Stattdessen gab es Vorurteile und Klischees zuhauf. Sie haben ihre Ursache im Aufstieg Spaniens zur Weltmacht im 16. Jahrhundert, in der selbst zugeschriebenen Rolle als Bollwerk des Katholizismus in Europa sowie dem Eingreifen Spaniens in den Dreißigjährigen Krieg.
Dieses negative Bild bekam dann zusätzlich durch die französische Aufklärung neue Nahrung. Lange Zeit musste Spanien in der sogenannten Leyenda negra, der schwarzen Legende, als Hort aller Übel herhalten: Arbeitsscheu seien sie, die Spanier, dabei über die Maßen stolz, fanatisch im Krieg, grausam gegenüber den Indios in Amerika, und zu allem Überfluss unterdrücke die Inquisition folternd und brennend jegliche Freiheit.
Mit der Romantik setzte spätestens an der Wende zum 19. Jahrhundert eine echte Umwertung Spaniens ein. Der Blick auf die Geschichte und auf Landschaften veränderte sich, und die Intellektuellen machten sich zunehmend mit spanischer Literatur vertraut. Was vorher finster und mittelalterlich war, wurde nun phantastisch und romantisch; was vorher heiße, öde, lebensfeindliche Landstriche waren, wurde jetzt weit, lichterfüllt und exotisch.
Um diese Faszination Spaniens zu spüren, brauchten die Dichter und Denker ebenso wenig Landeskenntnisse aus eigener Anschauung wie die scharfen Kritiker zuvor. Kaum jemand machte sich die Mühe, nach Spanien zu reisen. Wobei prominente Ausnahmen wie Wilhelm und Alexander von Humboldt die Regel bestätigen. Die meisten begnügten sich damit, die spanische Literatur zu lesen und zu übersetzen.
Vor allem im intellektuellen Zentrum jener Zeit, in Weimar und Jena, wurde Spanien Mode. In den spanischen Romanzen fanden die Romantiker beispielsweise ihre Vorbilder für wahrhaft volkstümliche Dichtung. Der Don Quijote stieg zu dem paradigmatischen Roman schlechthin auf. Selbst Calderón de la Barca, der so streng katholische Autor von Fronleichnamsspielen, wurde zu dem großen, dem unvergleichlichen Theaterautor hochstilisiert und von Goethe zum nationalsten aller Dramatiker ernannt, dem Gegenstück zur nun deutlich abgewerteten französischen Klassik.
Im katholischen Bayern fand naturgemäß die Umwälzung des Spanienbildes und die neue Spanieneuphorie wenig Niederschlag, denn hier hatte es vorher schlicht und ergreifend das protestantisch-aufklärerische Feindbild nicht gegeben. Spanien gehörte ganz selbstverständlich zum eigenen Kulturhorizont.
Zwar waren im Laufe der Zeit die engen bayerisch-spanischen Bindungen etwa aus der Zeit Karls V. oder des Dreißigjährigen Krieges deutlich schwächer geworden. Spanien war mit dem Niedergang seiner Hegemonialstellung aus dem Zentrum des Interesses gerückt. Auch das Spanische hatte seine Rolle als eine der wichtigsten, wenn nicht der wichtigsten Sprache Europas an das Französische abgegeben. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit über die Konfession bestand aber weiterhin.
Daher waren es vor allem die Ordensgemeinschaften, die den Kontakt weiterhin aufrecht hielten, allerdings nicht so sehr mit Spanien selbst als vielmehr mit seinen Kolonien in Amerika. Wie Hartmann und Schmid in ihrem Sammelband belegen, entsandten insbesondere die Jesuiten beständig bayerische und fränkische Missionare über Spanien nach Lateinamerika, bis der Orden in den Zeiten der Aufklärung 1767 in Spanien und 1773 in Bayern aufgehoben wurde.
Als 1799 mit Herzog Maximilian Josef von Pfalz-Zweibrücken eine Seitenlinie der Wittelsbacher die Nachfolge des Kurfürsten Karl Theodor antrat, war Spanien also weiter von Bayern entfernt als in den vorangegangenen 300 Jahren. Und daran änderte sich nach der Jahrhundertwende, von der Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 über den Wiener Kongress 1814/15 bis zur Krönung Ludwigs I. 1825 wenig.
Erst 1846 wurde ein gutes Jahrhundert der ganz besonderen Beziehungen der Wittelsbacher zu Spanien eingeläutet. Es begann mit der Affäre Lola Montez und der Liebe Ludwigs zur spanischen Sprache. Danach folgten drei wittelsbachisch-bourbonische Hochzeiten in drei Generationen und am Ende, schon in den 1950er Jahren, eine heikle diplomatische Mission. Darauf werden wir in den nächsten Kapiteln eingehen, denn die Verwandtschaftsbeziehungen der Wittelsbacher mit der spanischen Königsfamilie stehen beispielhaft für die Verdichtung der bayerisch-spanischen Beziehungen von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
Zunächst jedoch soll König Ludwig I. im Mittelpunkt stehen, der (auch) wegen einer Spanierin den Thron verlor, die keine Spanierin war, und der trotzdem über sie zur spanischen Sprache fand.
Lola Montez: die „spanische“ Geliebte des bayerischen Königs
Mitte der 1840er Jahre bereicherte Prosper Mérimée mit seiner Novelle Carmen von Frankreich aus das in Europa kursierende Spanienbild um ein weiteres, bis heute nachwirkendes Klischee. Zur gleichen Zeit bahnte sich in München ein ganz reales Drama an, das die nachfolgenden Generationen mindestens ebenso fasziniert hat wie Mérimées Erzählung über die heißblütige andalusische Arbeiterin einer Zigarettenfabrik.
Anfang Oktober 1846 erfuhr König Ludwig I., gerade 60 Jahre alt geworden, dass eine in Sevilla geborene, 24-jährige spanische Adelige namens Maria de los Dolores Porris y Montez, kurz Lola Montez, den Antrag gestellt hatte, im Hoftheater tanzen zu dürfen. Ludwig gewährte ihr Audienz und scheint ihr vom ersten Augenblick an verfallen zu sein.
Nicht nur gestattete er den spektakulären öffentlichen Auftritt, er ließ sie auch für seine Schönheitsgalerie malen und richtete ihr wenige Monate später sogar ein eigenes Haus ein. Wann neben der Bewunderung für ihre Schönheit auch sexuelle Aspekte in dieser Beziehung eine Rolle gespielt haben, ist nicht von Belang. Dass sie es taten, lässt sich jedenfalls aus intimen und intimsten Details des Briefwechsels zwischen den beiden erschließen.
Dies war allerdings nicht der entscheidende Punkt. Ludwig hatte zuvor schon diverse Affären gehabt, ohne dass dies zu größerem Aufsehen geführt oder gar seine Stellung als König berührt hätte. Doch mit Lola Montez änderte sich dies, denn sie begnügte sich nicht mit der Rolle der mehr oder weniger heimlichen Geliebten, sie wollte Anerkennung und Reputation. Kaum eine Gelegenheit ließ sie aus, um sich in den Mittelpunkt zu stellen.
Ihr Auftreten muss so anmaßend, provozierend, herrschsüchtig und exzentrisch gewesen sein, dass sie langsam aber sicher selbst wohlmeinende Zeitgenossen vor den Kopf stieß. Hinzu kam, dass sie es sich herausnahm, dem König politische Ratschläge zu geben. Vor allem solche, die sich gegen die Vertreter des politischen Katholizismus in Bayern richteten. Sie tat dies, obwohl sie kein oder kaum Deutsch sprach und in München langsam aber sicher Berichte über die Skandale einliefen, die sie auf ihren Reisen durch halb Europa schon verursacht hatte.
Eigentlich hätte sie längst ausgewiesen werden müssen, denn bei ihrer Ankunft hatte sie, die angebliche Spanierin, die in Wirklichkeit Irin war, weder einen Pass noch eine Geburtsurkunde vorgelegt. Doch statt sich diesbezüglich mit der Protektion des Königs zufrieden zu geben, forderte sie von ihm bald einen bayerischen Adelstitel. Dadurch wuchs sich die Affäre Lola Montez zur Staatsaffäre aus.
In einem ersten Schritt musste sie nämlich zunächst eingebürgert werden. Dabei setzte sich der König über das Votum des Staatsrats hinweg, mit der Folge, dass sein Kabinett im Februar 1847 geschlossen zurücktrat – ein halbes Jahr nach der Ankunft der angeblichen Spanierin. Der alternde Ludwig hatte sich verrannt. Er ließ einem Skandal seinen Lauf, der inzwischen durch Karikaturen, Flug- und Schmähschriften in der breiten Öffentlichkeit verhandelt wurde.
Dann kam es wegen der Maßregelung eines Professors der Universität im Zusammenhang mit der Regierungskrise zu einem Studentenaufstand. Gleichzeitig stiegen wieder einmal die Lebensmittelpreise, was die ärmere Bevölkerung Münchens auf die Straße trieb. Beide Protestbewegungen fanden schließlich in der in Saus und Braus lebenden Lola Montez ihr bevorzugtes Feindbild. Nur das persönliche Eingreifen Ludwigs verhinderte im Frühjahr 1847 einen Angriff auf sie.
Im Sommer ernannte der König seine Geliebte zur „Gräfin von Landsfeld“, worüber nicht nur der alteingesessene bayerische Adel murrte, auch in der neuen Regierung brodelte es. Nach nur neun Monaten ersetzte Ludwig sie im Herbst durch die nächste, die bald als „Lola-Ministerium“ verspottet wurde. Doch auch ihr gelang es nicht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Lola Montez provozierte unbeirrt weiter.
Anfang Februar 1848 kam es zur Eskalation. Angesichts der protestierenden Studenten hatte Ludwig die Schließung der Universität verfügt, die einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellte. Es kam zu tagelangen Unruhen, bis schließlich Lola Montez am 11. Februar aus der Stadt getrieben wurde. Die Macht des Königs reichte nicht mehr aus, sie zu schützen.
Damit war die Staatsaffäre Lola Montez jedoch nicht vorbei. Ende Februar brach in Frankreich die Revolution aus, die sehr bald nach Deutschland und Bayern übergriff. Die protesterprobten Münchner gingen wieder auf die Straße. Nur das mutige Einschreiten von Prinz Karl, dem Bruder des Königs, verhinderte am 4. März Blutvergießen. Zwei Tage später musste Ludwig der Beratung über weitreichende Reformen zustimmen. Die angestrebten Verfassungsänderungen hätten zwar nicht seiner Herrschaft, wohl aber, wie es Gollwitzer formuliert, seinem autokratischen Regierungsstil ein Ende gesetzt. Ob das alleine ausgereicht hätte, ihn zu seinem Thronverzicht zu bewegen, muss offen bleiben.
Allerdings beging Lola Montez in diesen aufgeheizten Tagen eine beispiellose Dummheit. Von der Schweiz aus, wohin Ludwig sie geschickt hatte, kehrte sie am 8. März inkognito nach München zurück. Sie wurde entdeckt und auf eine Polizeiwache geschleppt, wo sie vom König persönlich befreit und in eine Kutsche Richtung Schweiz gesetzt wurde. Die Gerüchte darüber, dass sie sich wieder oder immer noch in Bayern aufhielt, verstummten jedoch ab da nicht mehr.
Um den neuerlichen Unruhen Herr zu werden, zwang der Interims-Innenminister, der Regensburger Bürgermeister Gottlieb von Thon-Dittmer, seinen König am 17. März, die Einbürgerung der „Gräfin von Landsfeld“ zu annullieren. Eigenmächtig und ohne Rücksprache setzte er darüber hinaus einen Fahndungsaufruf unter den entsprechenden Erlass. Zwei Tage später gab Ludwig seiner Familie den Entschluss zur Abdankung bekannt. In der öffentlichen Erklärung vom 20. März begründete er seinen Rücktritt damit, dass die angestrebten Reformen Bayern in eine Richtung führen würden, die er nicht mehr verantworten wolle, nachdem er 23 Jahre zum Wohle des Landes regiert habe.
Es deutet also einiges darauf hin, dass Ludwig nicht allein wegen Lola Montez auf den Thron verzichtet hat. Aber er tat es eben auch wegen seiner „spanischen“ Geliebten, die zu einer Zeit des politischen Umbruchs in sein Leben getreten war. Für uns stellt sich jedoch nicht die historisch sicherlich wichtige Frage, warum der König abdankte. Im Kontext unserer Betrachtungen zu den bayerisch-spanischen Beziehungen interessiert viel mehr, wie der welterfahrene Ludwig sich in dem Gestrüpp von Lügen der geborenen Irin verheddern konnte.
Der „spanische“ Briefwechsel zwischen Ludwig und Lola
Die erste und entscheidende von Lolas Lügen bestand darin, dass sie sich als Spanierin ausgab. Dies scheint Ludwig von Beginn an gefesselt zu haben, und möglicherweise hat er nie wirklich begriffen, dass sie aller Welt eine Märchengeschichte über ihre Herkunft aufgetischt hatte. Denn schier unglaublich mutet es an, dass er mit ihr über vier Jahre hinweg, von 1847 bis 1850/51, einen mehrhundertseitigen Briefwechsel in spanischer Sprache führte, obwohl sie beide des Spanischen nur sehr eingeschränkt mächtig waren.
Ludwig hatte von Kind auf Französisch gelernt, auch wenn er sich beständig gegen die frankreichfreundliche Ausrichtung seines Vaters auflehnte. Spätestens seit seinem erzwungenen Aufenthalt am Hof Napoleons im Jahr 1806 beherrschte er es perfekt. Seine Latein- und Griechischkenntnisse waren zunächst deutlich schwächer, doch in seiner Kronprinzenzeit arbeitete er mit gutem Erfolg daran, sie zu verbessern. Italien war ihm seit seinem ersten Besuch 1804/05 vertraut, mit der italienischen Sprache scheint er sich aber erst 1807 eingehender beschäftigt zu haben. Der dafür angestellte Sprachlehrer brachte ihm auch Spanisch bei, wobei er über den Erwerb von Grundkenntnissen kaum hinausgekommen sein dürfte.
Spanien hatte er übrigens nach den sieben Monaten im ungeliebten Paris im Herbst 1806 kennenlernen wollen, doch er war auf dem Weg dorthin nach München zurückgerufen worden. Das Land hinter den Pyrenäen sollte für ihn bis zu seinem Lebensende ein immer wieder aufgeschobenes Reiseziel bleiben. Möglicherweise stammt aus dieser unerfüllten Sehnsucht seine positive Einstellung gegenüber der spanischen Sprache, die er in Bezug auf das Englische nicht in gleicher Weise hatte. Gollwitzer berichtet davon, dass seine Kenntnisse in der Muttersprache von Lola Montez zumindest auf dem Wiener Kongress noch unzureichend gewesen seien.
Lola Montez wurde 1821 in Irland als Elizabeth Rosanna Gilbert geboren, verbrachte ihre Kindheit bis 1827 in Indien, bevor sie von ih...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Lex Baiuvariorum: Bayern und Westgoten im Frühmittelalter
- Der spanische Adoptianismus auf der Regensburger Reichssynode Karls des Großen
- St. Afra und Sant Narcís: Eine mittelalterliche Heiligenpartnerschaft zwischen Augsburg und Girona
- Santiago – St. Jakob in Bamberg: Geschichten um den niederträchtigen Bischof Hermann, drei irische Mönche und eine Fegefeuervision
- Bayerische Herzöge auf dem sizilianischen Königsthron: Eine gescheiterte Bewerbung in Barcelona
- Reiseberichte des Spätmittelalters: Ein Spanier in Nürnberg, Nürnberger in Spanien
- Bayerische Konquistadoren in Hispanoamerika: Ulrich Schmidl und Philipp von Hutten
- Danubio, río divino: Der spanische Dichterfürst Garcilaso de la Vega auf der Donauinsel
- Barbara Blomberg: Geliebte des Kaisers, Heldenmutter und eigensinnige Frau unter spanischer Aufsicht
- Bayern und Spanien im Dreißigjährigen Krieg: Das Tagebuch des Abtes von Andechs und die seltsame Kampfschrift eines spanischen Gesandten
- Eine kurze und tragische Episode: Prinz Joseph Ferdinand von Bayern, designierter König Spaniens
- Johann Kaspar von Thürriegel: Die deutschen Kolonien in Südspanien
- König Ludwig I. und die spanische Sprache: Der Briefwechsel mit Lola Montez und das Theaterstück Recept gegen Schwiegermütter
- Das Wirken der Infantin María de la Paz in Bayern und die ersten Autofahrten nach Spanien
- Adalbert von Bayern: Erster Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Spanien
- Spanien auf dem Weg nach Europa: Das Techtelmechtel der spanischen Opposition in München
- Die spanische Arbeitsmigration in Bayern: Die Rolle des Bayerischen Rundfunks und eine Auswandererkomödie
- Zum Abschluss: Ein katalanischer Dichterwettbewerb in Bayern
- Bayern und Spanien: Nachwort
- Impressum