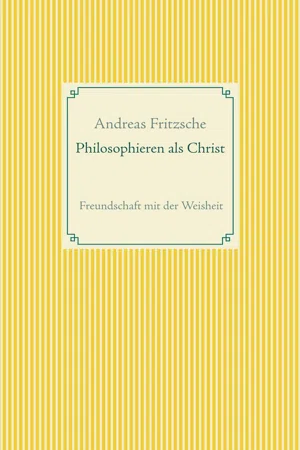
- 536 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Was ist wirklich wichtig im Leben?Was ist Liebe?Was ist Schönheit?Was ist Glück?Warum können wir Wirklichkeit verstehen?Kann man Gott denken?Wo liegen unsere Grenzen?Finden wir Sinn oder machen wir Sinn?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Philosophieren als Christ von Andreas Fritzsche im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
VI. Praxis der Philosophie
Macht und Moral
Landläufig wird die Meinung vertreten, dass Politik und Moral, Wirtschaft und Ethik nichts miteinander zu tun haben. Die Meinung wird insbesondere von Menschen vertreten, die in Politik und Wirtschaft Verantwortungspositionen innehatten. Seit der Renaissance findet diese Meinung auch theoretischen Ausdruck. Mit seiner Schrift „Der Fürst“ schlägt Niccolo Machiavelli eine neue Richtung der politischen Philosophie ein, indem er die seit der Antike übliche Zusammengehörigkeit von Politik und Ethik aufbricht.
„Viele haben sich Republiken und Fürstentümer vorgestellt, die nie jemand gesehen oder tatsächlich gekannt hat; denn es liegt eine so große Entfernung zwischen dem Leben, wie es ist, und dem Leben, wie es sein sollte, dass derjenige, welcher das, was geschieht, unbeachtet lässt zugunsten dessen, was geschehen sollte, dadurch eher seinen Untergang als seine Erhaltung betreibt; denn ein Mensch, der sich in jeder Hinsicht zum Guten bekennen will, muss zugrunde gehen inmitten von so vielen anderen, die nicht gut sind. Daher muss ein Fürst, wenn er sich behaupten will, die Fähigkeit erlernen, nicht gut zu sein, und diese anwenden oder nicht anwenden, je nach dem Gebot der Notwendigkeit.“437
Dieser Amoralismus der politischen Praxis widerspricht dem Anspruch des Aristoteles: Praxis, auch politische Praxis, zielt auf ein gemeinsames und öffentliches Gut (bonum commune), welches er das „gute Leben“ nennt; und eben die Sorge um das gemeinsame gute Leben rechtfertigt die Herrschaft von Menschen über freie Menschen. Die „Politik“ des Aristoteles legt die Grundlage jeglicher politischen Philosophie – bis in die Gegenwart hinein, zum Beispiel bei Martha Nussbaum, die sogar vom sozialdemokratischen Aristotelismus438 spricht. An dieser Sicht der Politik orientiert sich auch Machiavelli und setzt sich zugleich radikal von ihr ab.
Macht – was ist das?
Ein erster Gedankengang beschreibt, wie wir gegenwärtig das Wort Macht gebrauchen: Im Deutschen hat Macht eine negative Konnotation, wogegen „power“ im Englischen positiv besetzt ist. Mit Macht sind Tätigkeiten verbunden: führen, über Menschen bestimmen, Verantwortung tragen oder übertragen, delegieren und andere einspannen, kontrollieren, Gewalt ausüben, ordnen und herrschen. Die Frage stellt sich, wer wirklich die Macht hat. Das Volk, die Wirtschaft, die Medien, NGO’s, Banken oder Politik? Macht gibt es in verschiedenen Sphären: Naturgewalten und physikalische Gesetze, Geld, Wohlstand, Geschlechter. Macht bewirkt Einflussnahme, Kooperation, Abhängigkeiten, Verantwortung und gestaltet den Charakter einer herrschenden Person – Charisma, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Autorität und auch Verlustangst. Wie entsteht Macht? Ist Macht für das Zusammenleben notwendig? Gehört zur Macht auch die Macht über sich selbst, die Selbstbeherrschung?
Dieser erste Gedankengang zeigt, dass im Deutschen das Wort Macht eine negative Konnotation hat, und nach Willkür, Tyrannei oder Demütigen schmeckt. Will jemand die Macht erlangen, wird er das Wort Macht nicht in den Mund nehmen, sondern betonen, dass er Verantwortung übernehmen und tragen will. Derweil übt jede Lehrerin439 in der Klasse Macht aus, weil sie die Richtlinienkompetenz hat und mit Noten bewertet. Will sie allerdings nicht wahrhaben, dass sie als Lehrerin Macht ausübt, dann ist dem Machtmissbrauch Tür und Tor geöffnet. Wahrnehmen, annehmen und sehenden Auges ausüben – das kann der gute Weg sein.
Der Gedanke, den das griechische „arche“ und lateinische „potentia“ nahelegen, fasziniert: Anfang, Herrschaft, Vermögen im Sinne von Möglichkeit und Macht sind ein Wort. Dahinter steckt doch die Vermutung, wer den Anfang kennt, kenne auch das herrschende „Prinzip“. Wer ist der Erste im Staat? Wer hat damit angefangen? Was war am Anfang? Wer hat die Kraft, das Mögliche Wirklichkeit werden zu lassen?
Die erste Frage der Moral stellt sich aufgrund der Asymmetrie, des Gefälles: Der Herrschende führt, ordnet, verfügt, richtet und urteilt über andere Menschen; er genießt Privilegien sowie Autorität und übt Herrschaft – ggf. Gewalt – über andere aus. Was rechtfertigt die Herrschaft von Menschen über Menschen? Was rechtfertigt die Herrschaft von Menschen über freie Menschen? Sind die Verweise auf Chaosvermeidung, Sicherheitsbedürfnis, Schutz und Ordnung ausreichende Begründungen? Warum benötigen erwachsene Menschen Orientierungen und Grenzziehungen? Sie können sich doch ihres Verstandes bedienen und als autonome Subjekte selbst ein Urteil fällen.
Die klassische Position sagt, die Herrschenden tragen Sorge um das Gemeinwohl, um das gute, gemeinsame Leben. Machiavelli stellt diese Frage nicht; bei ihm ist Macht einfach da, und diese gilt es zu ergreifen, auszubauen und zu festigen. Ganz Unrecht hat Machiavelli mit seiner Unbefangenheit nicht, denn faktisch üben Menschen immer Macht aus, wenn sie zusammenleben. Was soll dann die Fragerei? Es gibt nun mal Stärkere und Schwächere; der eine hat die Macht, der andere habe sich zu fügen.
Die zweite Frage der Moral will das regulierende Prinzip der Machtausübung kennenlernen. Recht und Gerechtigkeit formen die Machtausübung, weil der Herrschende einer in der Gemeinschaft ist, wie der Kapitän einer der Schiffsleute ist, und weil es sich um eine Gemeinschaft freier Menschen handelt. Dabei ist Gerechtigkeit nicht nur eine soziale Institution, sondern in erster Linie die persönliche Eignung440 des Herrschers. Bei Machiavelli gibt es kein regulierendes Prinzip, an dessen Stelle tritt eine erfolgreiche Technik der Machtausübung.
Aristoteles: Das gute Leben als Gemeinwohl.
Die klassische Position, welche die griechische Antike und auch das christliche wie islamische Mittelalter teilen, finden wir zusammengestellt bei Aristoteles in der Politik. Ein Mensch kann nicht isoliert Mensch sein, denn er braucht nicht nur andere, sondern auch die Gemeinschaft, um überhaupt Mensch441 zu sein:
- Mensch – das gemeinschaftsbezogene Lebewesen (zoon politikon)442.
- Mensch – das Lebewesen, welches Worte hat (zoon logon echon).
- Mensch – das Lebewesen, welches um Gut und Böse weiß.
Damit gehört Politik, also die aktive Sorge um das Gemeinwesen, von Natur aus zum Menschen und kennzeichnet ihn als freien Menschen, gestaltet sein Leben. Freilich wird Politik bei Aristoteles nicht als Parteipolitik, sondern als aktives Gestalten der „Stadt“ (polis), der Gemeinschaft freier Menschen, verstanden. Aufgabe, Zweck und Ziel der Polis liegen im „guten Leben“ der Gemeinschaft. Ist die Polis in guter Verfassung, dann kann das Leben einer älteren Bürgerin sowie auch eines Kindes oder Gastarbeiters gelingen. Im „guten Leben“ (eu zein)443 geht es nicht um „dolce vita“, sondern um das Gelingen, um das Glücken eines Lebens – und zwar eines menschlichen Lebens.
Die gute Verfassung eines Gemeinwesens, seine Gesetzgebung, setzt sozusagen den Rahmen, der notwendig, aber noch nicht ausreichend ist. Aristoteles ist der Meinung, dass Zusammenleben noch nicht ausreicht. Die Menschen benötigen Freundschaftsbeziehungen444 zum gelingenden Leben, und damit „kann man einen Staat machen“. Damit aber Menschen Freundschaft leben können, müssen sie gut und tugendhaft werden.
Gute Staatsformen haben das Gemeinwohl (bonum commune) im Blick: Königsherrschaft, Aristokratie, Politie. Sie respektieren die freien Bürger und beteiligen sie. Schlechte Staatsformen haben den Eigennutz (bonum privatum) der Herrschenden im Blick: Tyrannis, Oligarchie, Demokratie445. Darum missachten diese Staatsformen die freien Bürger. Wenn es um die Verteilung von Gütern, Besitz, Rechten und Privilegien sowie von Lasten, Pflichten und Aufgaben geht, kommt es nicht nur auf die Legitimität, sondern vor allem auf das Ziel der Machtausübung an. Heißt der Zweck Gemeinwohl, gelingt Herrschaft, heißt der Zweck Eigennutz der Machtbesitzer entartet sie zur Unterdrückung und Ausbeutung. Dann werden Menschen als freie Bürger missachtet und instrumentalisiert.
Der Kontrapunkt – die schlechte, entartete Staatsform – soll abschließend beschrieben werden. In deren Zentrum steht der Eigennutz der Herrschenden, welche die ursprünglich freien Bürger als Untertanen behandeln. In den Beherrschten werden die Gefühle der Einsamkeit, Bedrohung und ständigen Kontrolle gezüchtet. Angebliche Bedrohungen rauben den Untertanen nicht nur Eigentum, sondern auch die Muße, weil sie zur besinnungslosen Arbeit gedrängt werden. An die Stelle der Freundschaft untereinander tritt die Ergebenheit gegenüber den Herrschenden.446
Staat – Polis – Politie
Das Wort Politik kommt von „Polis“. Wie kann man „Polis“ übersetzen? Gewöhnlich wird das mit „Staat“ getan, was nicht ganz genau zutrifft. In der Tat geht es um die Verfassung des Gemeinwesens, wie es sich mit Rechtsprechung, Institutionen sowie Aufgabenverteilung darstellt. Doch einen wesentlichen Unterschied zwischen der antiken Polis und dem modernen Staat gibt es: die Größe. Überschaubar sollte die Polis sein, so dass die freien Bürger – wie in einer modernen mittleren Stadt – einander kennen und miteinander befreundet sein können. Unseren anonymen Staat mit institutionalisierten Verteilungsmechanismen hätte ein Polisbürger nicht verstanden.447 Die Polis, wie auch die mittelalterliche freie Reichsstadt, beruhte auf persönlichen Beziehungen wie Kultvereinen und Berufsgenossenschaften. Darum spielte die Moralität, sprich Tugend, der Bürger eine große Rolle.
Die schlechten Staatsformen – Tyrannis, Oligarchie und Demokratie – leben einfach davon, dass es nahezu nur Reiche und Arme gibt, dass es im Grunde genommen zwei Staaten in dem einen Staat sind: den Staat der Reichen und den Staat der Armen. Beide sind feindlich aufeinander eingestellt und belauern sich. Letztlich herrscht latenter Krieg, Bürgerkrieg, zwischen beiden. Gute Staatsformen stützen sich auf die Mitte448 der Gesellschaft, auf die bürgerliche Mitte, und bemühen sich, die Ränder der Gesellschaft flach zu halten. Anders gesagt: Mit wem ist ein Staat zu machen? Nicht mit den Reichen, auch nicht mit den Armen, sondern mit den Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen und die Anderen in den Blick nehmen.
Güterlehre
Das gute Leben der freien Bürger ist Dreh- und Angelpunkt in Aristoteles’ Politik. Wie kann das „gute Leben“ beschrieben werden? Durch Erreichen eines Gutes449. Die Güter können und müssen noch einmal differenziert werden, wenn eine Güterabwägung notwendig ist:
- die äußeren Güter
- die körperlichen Güter
- die Güter der Seele.
Die äußeren Güter, wie öffentliche Anerkennung, Wohlstand oder Frieden, und die körperlichen Güter, wie Gesundheit, sind klar und danach streben auch die modernen Staaten. Die Güter der Seele überlässt die Moderne in der Regel der persönlichen Privatsphäre. Darum seien sie von Aristoteles beschrieben.
Erziehung
Erziehung wird in der Politik ein Thema, weil nur mit guten Bürgern ein guter Staat zu machen ist. Darum bringt Aristoteles an dieser Stelle seine Anthropologie und Tugendethik in Kompaktform450. Ziel der persönlichen wie politischen Ethik ist das gute Leben, das Aristoteles am Ende seiner Politik als ein Leben in Tugend und Muße benennt.
„Weil aber das Ziel ein und dasselbe zu sein scheint sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft unter den Menschen und weil es für den besten Mann und die beste Staatsverfassung ein und dieselbe Bestimmung geben muss, so müssen offenbar die auf die Muße Bezug nehmenden Tugenden vorhanden sein. Denn das Ziel ist, wie schon oft erörtert, der Friede als das des Krieges und die Muße als das der Beschäftigung. Von den Tugenden sind hinsichtlich der Muße und der Lebensweise diejenigen nützlich, bei denen in der Muße ein Werk entsteht, als auch jene, bei denen es ein...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Eingang
- II. Kosmos und nicht Chaos
- III. Platon
- IV. Aristoteles
- V. Klarheit
- VI. Praxis der Philosophie
- VII. Zum Weiterdenken: Fragen & Baustellen
- VIII. Was bleibt.
- Impressum