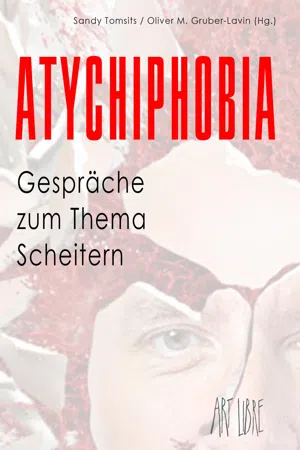![]()
Konrad Paul Liessmann
(Philosoph)
VOM LUXUS UND
KORREKTIV DES DENKENS
Womit beschäftigen Sie sich gerade?
Mit dem nunmehr zweiten Band, den ich gemeinsam mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier schreibe. Da wird es um zentrale Themen und Fragen des Lebens gehen. Michael Köhlmeier wählt dazu Geschichten aus. Aus der Mythologie, der Bibel, aus dem Sagen - und Märchenschatz, und ich versuche dies dann philosophisch zu interpretieren... Für mich eine sehr faszinierende Aufgabe.
Das Bildungsthema...
...ist nach wie vor präsent, ich habe dazu jetzt drei Bücher geschrieben und möchte kein Weiteres mehr darüber schreiben.
Das Fernseh-Interview mit Ihnen und Andreas Salcher über das Bildungssystem und seine Reformen war sehr konfrontativ geführt. Ich habe mich gefragt, warum arbeiten die beiden nicht zusammen?
Weil es einfach unterschiedliche Zugänge und Positionen gibt.
Es gab - zumindest im TV-Interview - nicht einmal eine gemeinsame Sprache.
Nein, er weiß auch, wo die Unterschiede liegen. Es war nie mein Anspruch Bildungssysteme zu reformieren. Es ist vielleicht das, wo Philosophen erst gar nicht scheitern wollen. Ich wollte nie Bildungsberater sein. Immer wenn Philosophen versucht haben, praktisch tätig zu sein, ist das ganz schlimm gescheitert. Man soll als Philosoph bei dieser reflektierenden, kritischen, kontemplativen Haltung bleiben.
Als Gegenposition zur Politik?
Oder als Unterstützung! Korrektur! Wir sind halt auch Wesen, die die unglaubliche Möglichkeit und Chance der Reflexion haben, des Widerspiegelns, des Nachdenkens über Dinge, und zwar nicht nur im Hinblick auf: Was kann ich ändern? Sondern mit Blick darauf: Was passiert hier eigentlich? Ich habe prinzipiell ein Misstrauen Menschen gegenüber, die glauben, sie haben den einen Schlüssel zur Lösung aller Probleme. Gerade in der Bildungsdebatte haben wir sehr viele solcher Gurus, die sagen, wenn wir nur den Frontalunterricht abschaffen, wenn wir nur die Pausenordnung abschaffen... Das halte ich für einen unglaublich naiven Zugang.
Digitalisierung ...
...ist natürlich ein Thema, das mich nicht nur aus bildungspolitischer Perspektive interessiert... Künstliche Intelligenz: Was ist eigentlich intelligentes Verhalten, Bewusstsein, Selbstbewusstsein? Was unterscheidet uns von kybernetischen Maschinen? Oder ob man über die Auswirkung der Digitalisierung auf die Arbeitswelt spricht, auf das Kommunikationsverhalten, auf die Medien, auf die Frage: Wahrheit oder Lüge? Was ja die Urfrage der Philosophie ist. Die findet man heute in jeder Regionalzeitung. Da offensichtlich die Fake-News beunruhigende Ausmaße angenommen haben, was den Philosophen natürlich nicht weiter erschüttert. Es haben die Menschen immer mehr gelogen, als die Wahrheit gesagt. Heute haben wir nur zusätzliche Möglichkeiten zu lügen.
Stichwort: Veröffentlichte Meinung und öffentliche Meinung...
Es klafft hier auseinander: ein bestimmtes Verständnis von veröffentlichter Meinung, wie sie eher in den Leitmedien, in den zentralen, liberalen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien kursiert und dem, was dann weite Teile der Bevölkerung denken. Wenn man den Boulevard studiert, oder privaten Fernsehsendern folgt, dort ist auch veröffentlichte Meinung. Die sieht aber dann anders aus. Die moderne Medienwelt hat mit sich gebracht, dass es diese Trennung von veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung ja nicht mehr gibt, weil alles öffentlich ist. Alles, was früher eine private Meinungsäußerung am Stammtisch war, wird heute gepostet und ist für alle einsehbar, also veröffentlicht. Was verloren gegangen ist, ist ein politisch strukturierter Begriff von Öffentlichkeit, in dem Sinne, dass diese Meinungen auch als Bestandteil eines politischen Diskurses von Bürgern verstanden wird.
Neue Medien als Spaltpilz für die Gesellschaft?
Ich bin kein Anhänger der These, dass unsere Gesellschaft stärker gespalten ist als früher...Gemessen an dem, was 1934 in Österreich passiert ist, ist von einer gespaltenen Gesellschaft heute überhaupt keine Rede...Es hat nie eine Gesellschaft von absolut Gleichen gegeben. So eine Gesellschaft halte ich auch gar nicht für wünschenswert. Entscheidend ist, wie diese weltanschaulichen Gegensätze verhandelt und ausgetragen werden, ob halbwegs zivilisiert oder nicht. Dass gleich die Gespaltenheit der Gesellschaft und die Gefahr für die Demokratie ausgerufen wird, nur weil andere Positionen artikuliert werden, halte ich für problematisch. Gleichzeitig ruft man zum Respekt für anders Denkende auf. Wenn man genau nachfragt, kommt man drauf, die anders Denkenden sind eh immer die, die genauso denken, wie ich selber, während man wirklich anders Denkende nicht aushält. Das ist nur ein Indiz für geistige Beschränktheit.
Ich hätte vor einem chinesischen Modell mit dem Erwerben von Sozialpunkten Angst, das in Algorithmen ausgelagert wird. Habe aber gehört, dass es in China wohl sehr beliebt ist. Wie denken Sie darüber?
Das ist eine interessante Frage, denn das chinesische Modell funktioniert in Ansätzen bei uns auch. Und offensichtlich haben die Menschen keine Angst davor. Sie wissen, welche Daten sie weitergeben und bekommen auch die Kontrolle darüber, weil sie ja mit Werbung konfrontiert werden, die nur auf sie personell zugeschnitten werden kann, weil eben Daten weitergegeben wurden. Jeder, der mit seiner Krankenversicherung einen Vertrag abschließt, dass die Versicherung die Möglichkeit hat, den Gesundheitslebenslauf anhand einer Fitnessuhr und deren Daten zu verfolgen, macht das eigentlich. Das große Versprechen, das diese Kontrollsysteme machen, ist: Bequemlichkeit und Sicherheit.
Verbunden mit dem Trugschluss: Ich habe ja nichts zu verbergen.
Vielleicht gibt es auch eine Sehnsucht von Menschen in einer Gesellschaft zu leben, in der sie gar nicht mehr in die Lage kommen, etwas verbergen zu müssen. Ich möchte in einer solchen Gesellschaft nicht leben. Es haben offensichtlich viel mehr Menschen Angst vor der Klimaerwärmung. Aber die Frage: Werden meine Kinder in einem vollkommen digitalisiertem System leben? Das scheint junge Menschen nicht zu Massendemonstrationen zu bewegen...
Gratiszeitungen für jedermann - sehen Sie da eine Gefahr einer nicht zu kontrollierenden Meinungsmanipulation?
Das ist auf der einen Seite vollkommen richtig, aber es hat auch zu anderen Zeiten genau diese kollektiven Erregungen gegeben, wo Menschen aufgehetzt worden sind. Die Hexenverfolgungen des Mittelalters sind allein durch Predigten zustande gekommen. Allein die Kirche etwa war bis zum 18.Jahrhundert das zentrale Medium und die Predigt war genau jene Stimme, die heute von Gratiszeitungen übernommen wird. Auf der anderen Seite haben wir heute die Möglichkeit doch sehr viel überprüfen zu können. Ich hab‘ da ein bissl mehr Vertrauen in die Menschen als viele Pessimisten.
Untersuchungen zeigen, dass die etwas pessimistische Prognose, dass Menschen heute nur noch in ihrer Filterblase eingekapselt sind, so nicht stimmt, sondern dass sehr viele Menschen auch andere Quellen nutzen und nicht nur die, die ihrem Milieu entsprechen. Ich bin noch in einem Haushalt aufgewachsen, wo völlig klar war, dass der sozialdemokratische Großvater nur die Arbeiterzeitung liest und sonst nichts. Ich als ehemaliger, linker Student hätte nie die Presse gelesen, das war Klassenverrat. Also von wegen ,,Filter-Blase“! Tun wir doch nicht alle so, als wären wir früher so offen gewesen gegenüber allen anderen.
Als wir anlässlich der Präsentation von Michael Ley’s Buch ,,Tötet sie, wo ihr sie trefft: Islamischer Antisemitismus“ bei der Podiumsdiskussion mit H.C. Strache und Henryk Broda waren, hörte ich von anderer Seite: Wie kannst du dort hingegen?
Ja klar.
Weil ich mir ein Urteil bilden möchte, ganz einfach.
Aber es stößt in bestimmten Milieus auf Unverständnis. Es ist nochmal ein sichtbarer, demonstrativer Akt, wenn man dort hingeht. Was etwas anderes ist, als wenn Sie sich im Internet auf der Facebook-Seite vom Strache herunterhypen, um auf ihrer eigenen dann zu schreiben: Bin jetzt mit Strache befreundet... Das wird vielleicht nicht so gut kommen. Es gibt schon Milieu-Abkapselungen. Wenn man dann etwa die falsche Veranstaltung besucht, kommt man unter Rechtfertigungsdruck. Aber es wäre auch zu meiner Studentenzeit unmöglich gewesen, zu einer Burschenschaft zu gehen, um sich über diese nur rein zu informieren. Als linker Student wäre der einzige Kontakt zu Burschenschaften gewesen, dass man sich mit denen prügelt. Eine argumentative Auseinandersetzung? - Undenkbar!
Angesichts der ewigen Wiederkunft des Gleichen: Ist das Neue an sich eine Illusion?
Das ist eine schwierige Frage. Weil, auch wenn das Gleiche wiederkehrt, dann wiederholen sich bestimmte Konstellationen, bestimmte Grundkonflikte, aber die Gestalt ändert sich schon. Es ist ein Unterschied, ob man die Auswahl zwischen drei Zeitungen hat, oder 500 Internetportalen. Das macht sowohl von der Quantität, als auch von der damit verbundenen Technologie einen Unterschied. Die spannende Frage ist: Was ist eine Wiederkehr? Was hält sich durch? Was ist wirklich nicht neu? Und das sollte man auch so benennen, um nicht in diesen „Alarmismus“ einer gespaltenen Gesellschaft zu verfallen. Und dann zeichnet man eine Vergangenheit, die man längst vergessen hat, als Idylle, K.u.K.- Nostalgie, linke Nostalgie... Da hat man sehr viel verdrängt, was es damals an Konflikt und Auseinandersetzung gegeben hat. Auf der anderen Seite muss man ein Sensorium dafür entwickeln, wo etwas geschieht, was in der Art und Weise vielleicht wirklich neu ist und uns mit etwas konfrontiert, was wir nicht abschätzen können. Wenn man wirklich vor etwas Angst haben darf, dann vor dem Neuen. Denn das wirklich Neue ist das absolut Unbekannte. Sonst wäre es ja nicht neu. Und das Unbekannte muss notwendigerweise Angst auslösen. Ich halte nichts davon zu sagen: Es ist zwar alles unbekannt für mich, ich sehe dem aber mit großer Freude entgegen... Kein Mensch - sonst wären wir Gott - ist so souverän, dass er mit allem Unbekannten gleicher Weise angstfrei umgehen könnte.
Wären wir wieder bei der Digitalisierung...
Wir wissen nicht, was kommen wird, aber viele sagen, es ist in etwa so etwas wie die erste industrielle Revolution. Das heißt, wir machen sofort aus allem Unbekannten etwas Bekanntes, sonst könnten wir damit gar nicht umgehen. Die Motive dahinter kennen wir. Ein Unternehmer digitalisiert sein Unternehmen nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil er seinen Profit erhöhen will. Die Methoden und Technologien sind vielleicht neu. Die Konsequenzen sind solche, die wir uns so nicht denken können, obwohl, wenn man genau hinschaut, es noch für die radikalsten Utopien, die im Zuge der Digitalisierung freigesetzt werden, Beispiele aus der Vergangenheit gibt. Wie mein Kollege Richard David Precht sagt: Die Digitalisierung erlaubt uns jetzt, genau jene Gesellschaft zu errichten, von der Marx geträumt hat.
Aber solange wir nur den Menschen besteuern, wird das schwierig werden.
Ich war immer schon ein Anhänger der Wertschöpfungsabgabe. Wenn die Produktivität auf Automaten übergeht, dann muss sich das auch im Sozialsystem und im Steuersystem widerspiegeln.
Wie denken Sie über das bedingungslose Grundeinkommen?
Das hat viele Facetten. Vernünftig argumentieren kann ich es nur, wenn ich eben davon ausgehe, dass die Automatisierung einen materiellen Reichtum erzeugt, der es nicht mehr notwendig macht, dass alle Menschen gleichermaßen in Erwerbsarbeitsverhältnissen sein müssen und der auf der anderen Seite trotzdem Verhältnisse voraussetzt, in denen Güter gekauft werden müssen von Menschen, die kein Erwerbseinkommen mehr haben. Das ist ein Widerspruch. - Ein anderes Modell wäre, man muss soviel erzeugen, dass man das verteilen kann. Solange nicht klar ist, ob wirklich die entscheidenden Dimensionen von Wertschöpfung an Maschinen delegiert werden können und auf menschliche Arbeitskraft und Zeit verzichtet werden kann, wird das bedingungslose Grundeinkommen Diskussionsthema bleiben. Ich bin der Überzeugung, wenn der technologische Fortschritt so anhält, werden wir um irgendeine Form des bedingungslosen Grundeinkommens nicht herumkommen.
Woran kann ein Philosoph scheitern?
Beim Philosophen stellt sich nicht die Frage woran, sondern er weiß, dass er nur scheitern kann. Weil das, was einen Philosophen interessiert, nämlich die Wahrheit, bleibt ein unerreichbares Ziel. Der letzte Philosoph, der geglaubt hat, er wäre in diesem Punkt nicht gescheitert, war Hegel. Heute wissen wir, er ist trotzdem gescheitert. Aber es ist natürlich eine Form des Scheiterns, die uns weiterbringt. Jede Annäherung an die Wahrheit, jeder Versuch, die Methoden der Erkenntnisfindung zu schärfen, bringt uns vielleicht ein Stück näher. Oder auch nicht. Wir müssen ja auch ständig die Kriterien überprüfen, nach denen wir unsere Ziele hier setzen. Es gibt Phasen in der Philosophie, da wird man sehr bescheiden und sagt sich: Es geht gar nicht mehr um Wahrheit, es genügt, wenn wir einfach die Sprache untersuchen, die wir verwenden. Wir haben eigentlich keine wirklichen Kriterien dafür, wann jemand echt gescheitert ist, oder nicht. Wovon wir Philosophen geglaubt haben, das interessiert jetzt wirklich niemanden mehr, interessiert uns irgendwann dann plötzlich wieder brennend.
Was wäre dann existentielles Scheitern beim Philosophen?
Wenn man im Zuge der Wahrheitsfindung oder der Lebensentwürfe, an denen man arbeitet und diese bedingungslos ernst nimmt, dann die Erfahrung machen muss: So geht’s nicht. Oder die Wirklichkeit ist störrischer als unsere Ideen sich das vorstellen. Das ist dann kein Spiel. Da geht es um Leben und Lebensentwürfe. Vor allem in der politischen Philosophie, in der Ethik- und Moralphilosophie geht es um das Leben der anderen.... Scheitern ist, wenn ein ganzes Konzept sich nicht umsetzen lässt. In der praktischen Philosophie ist das relevant. Ist Emanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ gescheitert? - Theoretisch hat er den klar, luzide und sauber abgeleitet und begründet. Praktisch hält sich fast kein Mensch an den kategorischen Imperativ. Was heißt das jetzt? - Umso schlimmer für die Menschen, wenn sie das nicht machen? - Heißt das, dass man hier theoretisch jetzt was entworfen hat, was von Menschen - weil wir eben so widersprüchliche, fehleranfällige, egoistische, triebgesteuerte Wesen sind - einfach nicht ei...