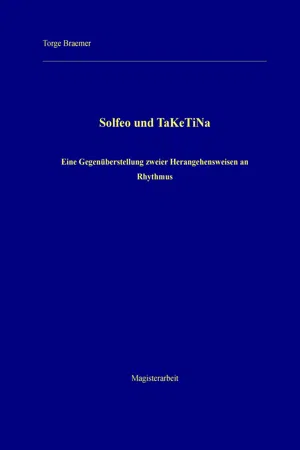
Solfeo und TaKeTiNa
Eine Gegenüberstellung zweier Herangehensweisen an Rhythmus
- 232 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Solfeo und TaKeTiNa werden in dieser Magisterarbeit anhand einer umfangreichen qualitativen Forschung unter den Aspekten "Gebrauch der Stimme", "Körperbewegungen" und "Disziplin" analysiert. Dazu habe ich in Spanien und Deutschland zahlreiche Interviews mit Hochschullehrern, Lehrern, Studenten und Schülern des Conservatorio Superior de Música de Madrid, des Conservatorio de Música de Palencia, des Colegio Internacional de Valladolid, des Conservatorio de Música de Valladolid, des Conservatorio Superior de Música de Huesca und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg durchgeführt und ausgewertet. Die Interviews sind hier im Original und als strukturierte Übersetzungen wiedergegeben. Die von Encarnación López de Arenosa zum solfeo rítmico ausdifferenzierte Tonwortlehre Solfeo und die von Reinhard Flatischler entwickelte ganzkörperliche Rhythmuspädagogik TaKeTiNa stehen im Fokus der Betrachtung. In beiden Herangehensweisen an Rhythmus geht es um die Abstimmung verschiedener Ebenen wie Stimme, Hände und Füße. Solfeoschüler beschäftigen sich als Musiktheoretiker, die Rhythmusanalyse betreiben, TaKeTiNa-Teilnehmer arbeiten körperlich, um das Urphänomen Rhythmus zu erfahren. TaKeTiNa kann zur Persönlichkeitsbildung beitragen und menschliche und soziale Werte vermitteln. Dazu gehört der bewusste Umgang und die Nutzung eigener musikalischer Ressourcen, die Förderung der eigenen Sensibilität und der Wahrnehmungsmöglichkeiten sowie die Schulung des inneren Pulses und die Koordinierung mehrerer rhythmischer Ebenen. Mit Solfeo können Grundlagen der allgemeinen Musiklehre sowie das Instrumentalspiel und die Gehörbildung praxisnah unterrichtet werden. Die Errungenschaft des Solfeos ist ein effektiv bildender Unterricht. Der Erfolg des TaKeTiNa ist die Verbindung des Fachlichen mit dem Sozialen. Der Kombiweg aus der Tonwortlehre Solfeo und der stimmlichkörperlichen Rhythmusarbeit TaKeTiNa ist eine attraktive Grundlage musikalischer Bildung und bietet viele Anreize für einen fortschrittlichen Musikunterricht.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1. Einleitung - Problematik
1.1 Ziel und Anspruch dieser Arbeit
- Ich will die Wirklichkeit der Herangehensweisen an Rhythmus von Solfeo und TaKeTiNa möglichst vielseitig erfassen. Deswegen werde ich die Methoden, Rhythmuslehrende und Rhythmuslernende recht ausbalanciert betrachten und Lebensgeschichten besonders berücksichtigen.2
- Leser sollen über Unterschiede der Lehrziele, der Unterrichtsorganisationen, der Entstehungsgeschichten, des Unterrichtsvorganges sowie über Gedanken und Erfahrungen der Teilnehmer informiert werden.
- Eine Wirklichkeitsverzerrung in der Darstellung soll durch pädagogische, soziologische, philosophische und psychologische Betrachtung möglichst vermieden werden.
- Schüler und Lehrer sind musizierende Menschen, die ihr Bemühen sinnfällig aufeinander beziehen. Die Bedeutungen ihres Bemühens für die Musik, mit den vielfältigen fachlichen und sozialen Beziehungen, sollen in meiner wissenschaftlichen Betrachtung in den Vordergrund treten.
1.2 Ein traditioneller und ein experimenteller Weg in der Musikausbildung?
1.3 Selbsterfahrung der zwei Herangehensweisen durch mein Musikstudium in Palencia und Oldenburg
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Problematik
- 2. Darstellungen der Konzepte „TaKeTiNa“ und „Solfeo“
- 3. Erörterung der empirischen Materialien unter ausgewählten Aspekten
- 4. Schlussgedanken
- 5. Musiksoziologische Forschungsarbeit mit Interviews zum Thema Solfeo
- 6. Präsentation des empirischen Materials zu Solfeo
- 7. Präsentation des empirischen Materials zu TaKeTiNa
- 8. Verzeichnis der verwendeten Literatur
- 9. Illustrationen
- Erklärungen
- Impressum