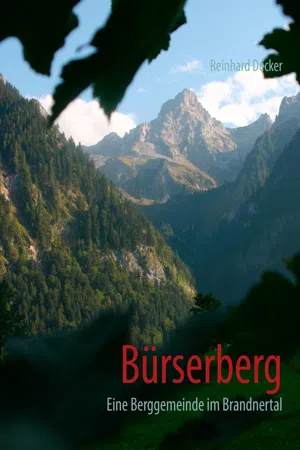![]()
Geschützte Biotope in Bürserberg
Daleu (Süd- und Nordhang)
Der zentrale Bereich des Biotops sind die Spirkenwälder in der schroffen Südflanke des Daleu bzw. Burtschakopfs. Sie stehen als Natura 2000-Gebiet (Spirkenwälder Brandnertal) unter besonderem Schutz. In seiner Gesamtheit umfasst das Biotop die gesamte Südflanke bis zur Gemeindegrenze von Brand - hier setzen sich die Spirken- und Föhrenwälder fort - sowie die von lichten Weidewäldern bedeckte Nordflanke. Im Osten wird das Biotop vom Zugswald begrenzt. Die Spirke (Pinus uncinata) bleibt als konkurrenzschwache Lichtbaumart auf Extremstandorte beschränkt, die sich zahlreiche limitierende Faktoren (Nährstoffarmut, Wasserarmut, extreme Trockenheit, hohes Lichtangebot, etc.) auszeichnen. Die Spirkenwälder sind den Winterheide-Spirkenwäldern zuzuordnen. Dieser spezielle Waldtyp tritt außerhalb der kontinentalen Innenalpen (z.B. im Schweizer Nationalpark am Ofenpaß) nur sehr selten auf und hier sein einziges Vorkommen in Vorarlberg. Nach unten hin werden die Spirkenbestände von artenreichen Winterheide-Föhrenwäldern abgelöst, wobei diese großteils bereits auf Brandner Gemeindegebiet gelegen sind.
Entsprechend der lichten Verhältnisse zeigen die Spirken- und Föhrenwälder einen sehr dichten Unterwuchs mit einer reichen Trockenrasenflora. Eine Verjüngung der Spirke erfolgt auf diesem Standort nur sehr spärlich. Auf dem beweideten Daleusattel vermischt sich die anspruchslose Spirke mit Fichte (Picea abies) und Latsche (Pinus mugo) und bildet mit ihnen lockere Bestände auf stark bemoostem Dolomitblockwerk, das nach Norden zuerst schroff dann sanft über Dolomitfelsriegel und kleine Schutthalden abfällt und über einen schmalen Latschengürtel in einen offenen Lärchen-Fichtenwald übergeht. Spirke und Latsche stehen hier in engem Kontakt und bilden fließende Übergangsformen. Die nicht bewaldeten schroffen Dolomithänge und Schutthalden sind von einer typischen Kalkrasenund Schuttpionierflora besiedelt. Initialstadien der Polsterseggenrasen und Blaugrashalden sind ineinander verzahnt und stabilisieren gemeinsam mit Zwergstrauchgehölzen und Alpen-Gänsekressefluren sowie mit Silberwurz- (Dryas octopetala) und Schildfarnfluren (Polystichum lonchitis) das lockere Schuttmaterial. Die Kalkspaltengesellschaften der offenen Felsriegel setzen sich aus Fragmenten der Blasenfarnfelsflur mit Grünem Streifenfarn (Asplenium viride), Lanzen- Schildfarn (Polystichum lonchitis) und Felsenfingerkrautfluren (Potentilletum caulescentis) zusammen.
Die Spirkenwälder des Daleu sind bedingt durch die extremen Standortbedingungen ausgesprochene Pionierwälder von absoluter Ursprünglichkeit. Es handelt sich um eine Dauerwaldgesellschaft und nicht um ein Sukzessionsstadium, da eine Abfolge von Besiedlungsstadien aufgrund der lokalklimatischen Bedingungen nicht möglich ist. Durch die steile Lage ist eine Bringbarkeit gänzlich ausgeschlossen und menschliche Eingriffe in Form von Aufforstungsund Pflegemaßnahmen sind zwangsläufig unmöglich. Auch die Vegetation offener Dolomit-Felsstandorte setzt sich aus natürlichen bis ursprünglichen Komponenten zusammen. Auf der Südflanke sind lediglich die talnäheren Bereiche bei Tschappina, am Nordhang der Lärchen-Fichtenwaldkomplex durch extensive Holznutzung bzw. der Nutzung als Weidegebiet verändert und geprägt worden.
Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt
Vorkommen der stark gefährdeten Arten Schneerose (Helleborus niger), Amethystschwingel (Festuca amehtystina) sowie der gefährdeten Arten Niedrige Segge (Carex humilis), Glanz-Labkraut (Galium lucidum), Finger-Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Rauhgras (Achnatherum calamagrostis) und Schwalbenwurzenzian (Gentiana asclepiadea).
Entsprechend der extremen Lage ist die Tierwelt - besonders die Kleintierwelt – mit Sicherheit von derselben Reichhaltigkeit wie die Vegetationsdecke des Gebietes. Mit einer spezialisierten thermophilen Fauna ist zu rechnen. Aufgrund der Abgeschiedenheit und Unzugänglichkeit ist der Südhang des Daleu ein idealer Wildeinstand; besonders für die Gemse (Rupicapra rupicapra) die hier in großer Dichte auftritt.
Obere Burtschamähder
Bei den Oberen Burtschmähdern in den Hangverebnungen am Ostfuß des Loischenkopfs handelt es sich um einen außergewöhnlich großen und höchst vielfältigen Hangmoorkomplex mit verschiedenen Pflanzengesellschaften der Kalkflachmoore (vor allem Davallseggenrieder, teils mit Zwischenmooranklängen), Moosquellfluren, Magerwiesen und deren Brachen sowie ausgedehnten Gebüschbeständen in den Bachgräben der Quelläste des Schesabachs. Die Vermoorungen liegen im Einzugsgebiet der gipshaltigen Raibler Schichten auf lockerem Moränenschutt. Das aus naturschutzfachlicher Sicht höchst schützenswerte Gebiet ist Lebensraum zahlreicher seltener und gefährdeter Arten.
Die ausgedehnten, leicht geneigten Flachmoore setzen sich je nach Vernässungsgrad aus verschiedenen Gesellschaftstypen zusammen. Landschaftsprägend sind vor allem die großen Davallseggenmoore mit Schilf, die sich über die gesamte Fläche ziehen. Die Quellabflussgerinne bedecken üppige rmleuchteralgengesellschaften.
Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt
Vorkommen der stark gefährdeten Arten Kriech-Weide (Salix repens), Einknolle (Herminium monorchis) und Floh-Segge (Carex pulicaris) sowie der gefährdeten Arten Sumpf-Baldrian (Valeriana dioica), Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris), Schwalbenwurz-Enzian (Gentiana asclepiadea), Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Kiel-Lauch (Allium carinatum), Saum-Segge (Carex hostiana), Blasen-Segge (Carex vesicaria), Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis) und Grauweide (Salix cinerea).
Flachmoore sind ein überaus wichtiger Lebensraum für Kleintiere, wie auch die kleinen Fließgewässer ein Teil- oder Ganzlebensraum für eine spezialisierte Lebewelt sind. An Vögeln kommen unter anderem vor: Baumpieper, Wasserpieper, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Zilpzalp, Winter-Goldhähnchen, Tannenmeise, Singdrossel, Ringdrossel, Misteldrossel, Buchfink, Zitronengirlitz, Zeisig, Gimpel.
Dunza-Ried
Der weitläufige Moorkomplex der Dunza liegt auf der durch Moränenwälle gegliederten Hochstufe bzw. Hangverebnung westlich der Tschengla; er ist zur Gänze Teil der Weideflächen der Rona-Alpe. Teile des Moorkomplexes wurden als Detailbiotope ausgeschieden, so die Gipsquellmoore im Westen, das Davider Moor und das Flachmoor bei der “Säga“ im Osten. Neben der durch das Relief vorgegebenen Gliederung ist der Moorkomplex durch die Güterwege auf die Rona- und die Burtscha-Alpe in mehrere Teile aufgegliedert.
Es handelt sich um einen ausgedehnten und ausgesprochen vielfältigen Moorkomplex mit verschiedensten Flach- und Zwischenmoorgesellschaften, Quell- und Gewässerlebensräumen, der Lebensraum einer Vielzahl seltener und teils stark bedrohter Moorarten ist. Bei den vorherrschenden Pflanzengesellschaft handelt es sich um Davallseggenrieder. In ihrer typischen Ausbildung ist diese Gesellschaft der Kalkflachmoore in den Hangfußbereichen ausgebildet. In den Hangverebnungen zeigt sich dagegen in zunehmenden Maß ein gewisser Zwischenmoorcharakter, was durch das verstärkte Auftreten von Rasenbinse (Trichophorum cespitosum) und anderen Säurezeigern zum Ausdruck kommt. Diese Kleinseggenrieder nehmen eine “intermediäre“ Stellung zwischen den Kalkflachmooren und jenen der sauren Standorte ein. Den stärksten Zwischenmoorcharakter besitzt der zentrale, vom Rest der Weide abgezäunte Bereich des “Rieds“. Die Vegetationsverhältnisse sind hier extrem komplex und stellen ein quasi unentwirrbares Mosaik aus verschiedensten Moorgesellschaften dar. Von einem Meter zum anderen entspricht die Vegetation einmal mehr den Kopfbinsenriedern, dann wieder den Davallseggenbeständen, den “intermediären“ Kleinseggenriedern oder den Rasenbinsenmooren. Zudem finden sich stellenweise Ansätze zur Bildung von Torfmoosbulten und kleine Schlenkenstrukturen. Das Vegetationsmosaik spiegelt neben einem kleinräumig stark wechselnden Kalkgehalts auch ganz unterschiedliche Vernässungsgrade wieder; seine Ausbildung ist eventuell mit der ehemaligen Beweidung in Zusammenhang zu bringen. Gegenwärtig wird die Fläche nicht mehr genutzt und liegt brach, als Folge davon ist die Vegetation stellenweise stark verfilzt, stellenweise beginnen Gehölze aufzuwachsen (u.a. Birke, Fichte, Grauerle) und im östlichen Teil beginnt sich Schilf (Phragmites australis) auszubreiten. Der Zustand des Moorkomplexes ist aus naturschutzfachlicher Sicht als sehr kritisch zu bezeichnen. Er ist durch die intensive Beweidung mehr oder weniger stark beeinträchtigt, Teile des zentral gelegenen “Rieds“ (vgl. Flurnamenkarte) sind aufgrund der Nutzung als Koppel für das Weidevieh und durch die Anlage eines Fischteichs stark beeinträchtigt bzw. weitgehend zerstört. Weitere Beeinträchtigungen sind durch Nährstoffeinträge (in randlichen Teilen wohl auch Andüngung), randliche Meliorierungen und Drainagegräben gegeben.
Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt
Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Arten Sumpf-Straußgras (Agrostis canina) und Sumpffarn (Thelypteris palustris-große Population), der stark gefährdeten Floh-Segge (Carex pulicaris), Einknolle (Herminium monorchis) und des Manna-Schwadens (Glyceria fluitans) sowie der gefährdeten Arten Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris), Saum- Segge (Carex hostiana), Sumpf-Ständel (Epipactis palustris), Rostrote Kopfbinse (Schoenus ferrugineus), Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Schwalbenwurz-Enzian (Gentiana asclepiadea), Sumpf-Weidenröschen (Epilobium palustre), Alpen-Haarbinse (Trichophorum alpinum) und Kleiner Knöterich (Persicaria minor).
Der Tümpel ist ein ausgesprochen wichtiger Biotop für Amphibien. Zudem kommen zahlreiche Libellen vor.
Zugswald
Der Zugswald stockt in nord- bis ostexponierten Rücken- und Hanglagen zwischen dem Daleu im Süden und dem Gaschierakopf im Norden. Im oberen Teil grenzt er an die Alpweideflächen der Burtschaalpe, bzw. Richtung Gaschierakopf an die Murabbrüche des Schesatobels, im unteren Bereich an die Mähder und Weideflächen des Weilers Zugs südlich Tschapina.
Bemerkenswert ist das Vorkommen der Schneerose (Helleborus niger), ein absolutes Unikat der Flora und Vegetation Vorarlbergs. Die Schwerpunktverbreitung der Schneerose liegt in den Gebirgen Südosteuropas, das Auftreten in Vorarlberg ist extrazonal und auf lokalklimatische Zusammenhänge zurückzuführen. Die Wälder zeigen entsprechend der geologischen Verhältnisse und der Höhenstufe eine sehr schöne Zonierung, wobei allen im Folgenden genannten Waldtypen eine charakteristische Beimischung von Rotföhre (Pinus sylvestris) und Lärche (Larix decidua) zu eigen ist. Dies ist zumindest im Bezug auf die Föhre als Hinweis auf die klimatischen begünstigten Verhältnisse zu werten. Daneben ist das Waldbild aber auch von der Nutzung geprägt, abgesehen von der Holzentnahme wurden weite Teile der Wälder ehemals beweidet (sowohl bei Zugs als auch von der Burtschaalpe aus). Abgesehen von der veränderten Alters- und Bestandesstruktur der Wälder zeigt sich dies etwa auch in einem erhöhten Anteil der Fichte (Picea abies). Im nördlichen Teil zeigen die Wälder eine Abfolge vom typischen Kalk-Buchen-Tannenwald zum leicht wärmegetönten Kalk-Tannen-Fichtenwald mit Weißsegge und Reitgras (Calamagrostis varia). Im südlichen Bereich - der Ostflanke des Daleu - findet sich dagegen noch Hauptdolomit, der etwa an den Felsabbrüche der Weißen Wand eindrucksvoll zu Tage tritt; unterhalb dieser sind die Hänge von Dolomitschutt überdeckt. Hier findet sich eine Abfolge vom ehemals beweideten und forstlich etwas stärker überprägten Reitgras-Fichtenwald mit Weißsegge am Hangfuß über einen wärmegetönten Kalk-Buchen-Tannenwald mit Weißsegge im mittleren Hangbereich, welcher nach oben hin wiederum von einem Reitgras-Fichtenwald abgelöst wird. In der Weißen Wand und den darunterliegenden Schutthalden selbst stockt ein Spirkenwald.
Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt
Vorrkommen der stark gefährdeten Schneerose (Helleborus niger) in großen Populationen sowie der gefährdeten Arten Tanne (Abies alba) und Finger-Knabenkraut (Dactylorhiza maculata).
Gaschieramähder
Die Mähder liegen in den ost- bis südostexponierten Steilhängen unterhalb des Gaschierakopfs oberhalb des Weilers Tschapina. Die steilen Gaschieramähder sind ein eindrucksvolles Zeugnis der alten Bergbauernkultur. Ab den 1960er Jahren wurde die Nutzung sukzessive aufgegeben, kleinere Bereiche werden aber auch gegenwärtig noch gemäht. Derartige, speziell in den steilsten Bereichen von Bäumen bestandene, parkartige Mähder sind charakteristische Landschaftselemente der Sonnenhänge des Brandnertals und somit aus landschaftspflegerischer Sicht höchst erhaltenswert. Zudem ist dieser Biotopkomplex extrem artenreich und Standort zahlreicher seltener und geschützter Arten. Bei den Magerwiesen handelt es sich um Sterndolden-Trespenwiesen, die aufgrund der über Würm-Moräne entstandenen, von Natur aus recht reichen, tiefgründigen und wasserzügigen Lockersedimentbraunerden ausgesprochen wüchsig sind. Ihre enorme Artenfülle ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, so etwa das Zusammentreffen von wärmeliebenden Arten der tieferen Lagen mit solchen der hochmontan-subalpinen Stufe und die reiche Differenzierung an Kleinstandorten, die sich zum einen aus dem Relief ergibt (Buckelwiesen, Felsblöcke und anstehendes Gestein), aber auch aus den durch den Menschen geschaffenen Strukturen (Lesesteinhaufen, Mauern, Baumbestockung, etc.). Ein wesentliches Element der Mähder sind verschiedenste Gehölze. Neben teils sehr alten Bergahornen (Acer pseudoplatanus), Eschen (Fraxinus excelsior) sowie vereinzelt Buchen (Fagus sylvatica) und Fichten (Picea abies), zeigen speziell die sehr steilen Hangpartien eine dichtere Baumbestockung. Diese ehemals gemähten “Laubhaine“ sind gegenwärtig allerdings mehr oder weniger vollständig verwachsen.
Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt
Vorkommen der stark gefährdeten Arten Kleinblütiger Fingerhut (Digitalis lutea), Tauben- Skabiose (Scabiosa columbaria) sowie der gefährdeten Arten Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata), Kiel-Lauch (Allium carinatum), Arznei-Schlüsselblume (Primula veris), Finger-Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Echtes Labkraut (Galium verum), Schopf-Kreuzblume (Polygala comosa), Kriech-Hauhechel (Ononis repens), Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor) und als gefährdete Gehölzart der Feldahorn (Acer campestre).
Der gesamte Biotopkomplex aus Wiesland, Bracheflächen, Lesesteinhaufen, Gebüsch-, Baumgruppen und Einzelbäumen bietet zahlreiche Nischen und optimale Lebensbedingungen für eine reichhaltige Tierwelt (Kleinsäuger, Vögel, Schmetterlinge, Insekten u.a. Kleintiere).
Tschapina-Halda...