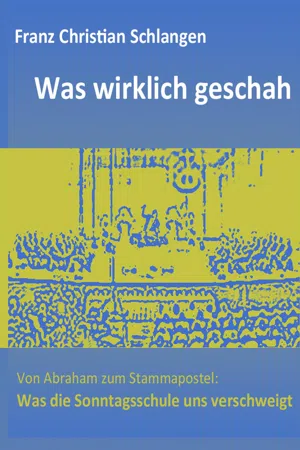![]() Anhang
Anhang![]()
Glossar
Soweit nicht anders angegeben, stammen die nachstehenden Definitionen aus der „großen Brockhaus-Enzyklopädie in 30 Bänden", 21. Aufl. ersch. 2005 bei Verlag wissenmedia, Gütersloh, ISBN: 978-3765341403:
Abbasiden (127): die zweite Kalifendynastie; zwischen 750 und 1258 herrschten insgesamt 37 Mitglieder der Dynastie. Ihre Herkunft führten sie auf al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib (um 573–653) – einen Onkel des Propheten Mohammed – zurück. Nach dem Sturz ihrer Vorgänger, der Omaijaden, beherrschten sie ein Weltreich zwischen Mittelasien und Nordafrika und behielten auch nach dessen Auflösung bzw. dem zunehmenden Verlust realer Macht die nominelle Oberherrschaft. Ihr Zentrum bildete der heutige Irak, wo der Kalif Mansur 762 Bagdad als neue Residenzstadt schuf; von 836 bis 883 residierten die Abbasiden in Samarra. Ihre frühe Zeit war durch energische und tatkräftige Herrscher wie Mansur, Harun ar-Raschid (Harun) und Mamun geprägt; später gerieten sie zunehmend in Abhängigkeit türkischer (Seldschuken) und iranischer (Bujiden) Herrscher. Einen letzten Höhepunkt erlebten sie unter dem Kalifen an-Nasir (1180–1225). Nach der Einnahme von Bagdad durch die Mongolen (1258) lebte eine Zweiglinie der Abbasiden als Kalifen am Hof der Mamluken in Kairo (1261–1517). – Zur künstlerischen Tätigkeit unter den Abbasiden islamische Kunst.
Abiogenese (17): [griechisch] die, -, die Urzeugung. Die spontane, elternlose Entstehung von Lebewesen aus anorganischen (Autogonie) oder organischen Substanzen (Plasmogonie); im Gegensatz zu Tieren, die von einem Muttertier geboren werden (Animalia vivipara) oder die aus einem abgelegten Ei schlüpfen (Animalia ovipara).
Eine neue Phase der Untersuchungen zur Entstehung des Lebens begann mit den Überlegungen von A. O-parin 1924, die später durch Experimente von S. L. Miller und H. C. Urey (1953) sowie M. Calvin und Mitarbeitern bestätigt wurden.
In Abwandlung des ursprünglichen Oparin-Modells der Entstehung hochmolekularer Biomoleküle nimmt man heute an, dass sich Eiweiß, Polysaccharide, Nukleinsäuren und Phospholipide nicht in einer ozeanischen Ursuppe, sondern unter der katalytischen Wirkung von Mineralen am Meeresgrund gebildet haben, wie sich aus Experimenten der Woods Hole Oceanographic Institution in den 1960er-Jahren ergeben hat (geochemisches Modell). Gestützt wird diese Theorie durch Forschungsergebnisse, die an heißen untermeerischen Schwefelquellen (Schwarze Raucher) gewonnen wurden. An der Oberfläche von Mineralbrocken aus den heißen Quellen konnte die Synthese von organischen Molekülen aus Kohlendioxid und Wasserstoff beobachtet werden, wobei die für die Reaktion nötige Energie aus der Bildung des schwefelhaltigen Minerals Pyrit stammt. Zudem wurden in diesen heißen Quellen Archaebakterien gefunden, die nach vergleichender Untersuchung des genetischen Materials als sehr ursprünglich eingestuft werden.
Ablass (134): lateinisch Indulgentia, katholisches Kirchenrecht: der »Nachlass zeitlicher Strafen vor Gott für Sünden, deren Schuld schon getilgt ist« (CIC: Can. 992 ). Er wird formal außerhalb des Bußsakraments gewährt und ist an folgende Bedingungen gebunden: Taufe, Freisein von Exkommunikation und die Absicht, Ablass zu erlangen, sowie Beichte, Kommunion, Gebet und die Erfüllung des mit dem Ablass versehenen Werkes. Die Gewährung kann als Teilablass oder vollkommener Ablass erfolgen, je nachdem, ob der Ablass teilweise oder ganz von der zeitlichen Sündenstrafe befreit. Der Gläubige kann diese Ablässe für sich selbst gewinnen oder fürbittweise Verstorbenen zuwenden. Die Vollmacht, Ablass zu gewähren, liegt beim Papst; beschränkte Ablassvollmachten haben die Diözesanbischöfe, Metropoliten, Patriarchen und Kardinäle.
Theologischer Hintergrund des Ablasses ist die katholische Bußlehre mit ihrer Unterscheidung zwischen Sündenschuld und Sündenstrafe, wobei zwischen zeitlicher und ewiger Sündenstrafe (Hölle) unterschieden wird. Im Bußsakrament werden die Sündenschuld und die ewige Sündenstrafe (mit einem Teil der zeitlichen) vergeben; der noch ausstehende Teil der zeitlichen Strafe muss noch im irdischen Leben (durch auferlegte Bußwerke) oder im Fegefeuer »abgebüßt« werden. Ersatzweise kann die Kirche kraft ihrer Verfügungsgewalt über den Kirchenschatz diesen Teil für die Sünder »bezahlen«. Die neuere katholische Theologie (K. Rahner) interpretiert den Ablass v. a. geistlich-personal als Hilfe der Kirche zur intensiveren Buße, die neue Chancen christlicher Lebensgestaltung eröffnen hilft.
Der Ablass entstand auf dem Boden der frühmittelalterlichen Bußpraxis in der lateinischen Kirche und wurde erstmals im 11. Jahrhundert in Frankreich gewährt. Zunächst noch mit dem Bußsakrament verbunden, wurde er im 13. Jahrhundert von diesem abgetrennt und in der Folge oft als »Bußersatz« missverstanden. Die Kommerzialisierung des Ablasses (Verkauf von Beichtbriefen) setzte im 14. Jahrhundert ein und erreichte am Anfang des 16. Jahrhunderts im planmäßigen, von der Kirche geförderten Ablasshandel ihren Höhepunkt. Gegen diese Praxis trat Luther 1517 mit seinen 95 Thesen auf; der Missbrauch wurde jedoch erst durch das Konzil von Trient (1545–63) abgestellt. Die 1967 erfolgte Neuordnung des Ablasswesens durch Papst Paul VI. betont den Ablass v. a. als jurisdiktionellen Hoheitsakt der Kirche. Die alle 25 Jahre vom Papst ausgerufenen heiligen Jahre (zuletzt 2000) sind im theologisch-rechtlichen Sinn »Ablassjahre«. Eine vatikanische Behörde, die Apostolische Pönitentiarie, ist für die Veröffentlichung der Ausführungsbestimmungen zum Ablass und die Überwachung der korrekten Durchführung zuständig.
Die Ostkirchen kennen den Ablass nicht. Die evangelischen Kirchen lehnen ihn als unzulässigen Eingriff in Gottes Gnadenhandeln, der nicht mit der Bibel begründet werden kann, ab.
Abrahamitismus, abrahamitische Religion (13): Monotheistische Religion, die auf den Stammvater (Patriarchen) Abraham (auch Ibrahim) zurückgeht.
Adoptianismus (116): [zu adoptieren] der, -, die in der Kirchengeschichte mehrfach aufgetretene Lehrmeinung, Jesus sei nur ein durch sündloses Leben bewährter, in der Taufe zum Gottessohn adoptierter Mensch gewesen, nicht aber von Anbeginn göttlicher Natur. Hauptanliegen des Adoptianismus war die unbedingte Sicherung des Monotheismus. Seine erste Ausformung begegnet im Umkreis der Ebioniten, als theologischer Begründer gilt aber Theodotus der Ältere (um 200). Zum Adoptianischen Streit kam es Ende des 8. Jahrhunderts im Frankenreich; er gipfelte im Glaubensdisput zwischen Alkuin und Bischof Felix von Urgel (Aachener Synode von 800) und endete mit der Zurückweisung des Adoptianismus und der Verbannung des Felix.
Agrippa, Marcus Vipsanius (63): römischer Staatsmann, * 63 v. Chr., † 12 v. Chr.; Jugendfreund und bedeutender Feldherr des Kaisers Augustus, für den er die Siege bei Mylae und Naulochos über Sextus Pompeius, bei Aktium (31 v. Chr.) über M. Antonius und Kleopatra errang. Als Gemahl von Augustus’ Tochter Julia (seit 21) wurde er durch die Übertragung der »tribunicia potestas« (Tribun) und des »imperium proconsulare« (Imperium) zum Mitregenten erhoben. Er ließ auf eigene Kosten zwei neue Wasserleitungen (Iulia, Virgo), Thermen und das Pantheon bauen; die Ergebnisse der von ihm geleiteten Reichsvermessung sind in den (verlorenen) »Commentarii Agrippae« und in der danach entworfenen Weltkarte verwertet.
Aischa (120): arabisch A'isha, türkisch Aişe, Ayşe, Ehefrau von Mohammed und Tochter seines Freundes Abu Bakr. Sie war die jüngste Frau des Propheten und stand ihm besonders nahe; er starb 632 in ihrem Haus. Aischa blieb kinderlos. Aufgrund ihrer Einsichten in das Leben ihres Mannes und wegen ihres Wissens über die frühe islamische Gemeinde genoss sie als eine »Mutter der Gläubigen« bei den Muslimen große Achtung und engagierte sich auch politisch. In der »Kamelschlacht« 656 (so genannt, weil Aischa auf ihrem Kamel selbst am Gefecht teilnahm) wurde sie von Ali Ibn Abi Talib gefangen genommen und zur politischen Zurückhaltung verpflichtet. Bei den Sunniten gehört Aischa zu den Hauptüberlieferern der Sunna, während sie bei den Schiiten wegen ihres Verhältnisses zu Ali Ibn Abi Talib umstritten ist. – Als weiblicher Vorname ist »Aischa« im Islam sehr verbreitet.
Aleviten (125): siehe Nusairier
Annaten (195): [mittellateinisch, zu lateinisch annus »Jahr«] Plural, Jahresabgaben; die Abgabe des Ganzen (oder meist der Hälfte) des ersten Jahresertrags eines neu besetzten Benefiziums an den Papst; im weiteren Sinn seit dem 15. Jahrhundert alle Abgaben an die römische Kurie. Sie bildeten besonders im Spätmittelalter eine wichtige Einnahmequelle. Die Eintreibung der Annaten führte zu vielen Klagen und Streitigkeiten.
Anthropozentrismus (27): [griechisch], Betrachtungsweise, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt
Antipater (60 ff): griechisch Antipatros, Angehöriger der Dynastie Herodes' des Großen: Antipater, † (vergiftet) 43 v. Chr., Sohn von Antipater, im Unterschied zu diesem Antipas genannt; Vater von Herodes I., dem Großen; Berater Hyrkanos' I.; gewann das Vertrauen der Römer und wurde aus einem Parteiführer im Kampf der Makkabäerbrüder der Erbe ihrer Macht.
Antitrinitarier (172): siehe Unitarier
Antonius / Marcus Antonius (63): Angehöriger des römischen plebejischen Geschlechts der Antonier: Marcus Antonius, Mark Anton, * um 82 v. Chr., † (Selbsttötung) 30 v. Chr., Enkel von Marcus Antonius Orator, Neffe von Gaius Antonius Hybrida; stieg als Anhänger Caesars rasch auf. Für das Jahr 44 neben Caesar zum Konsul gewählt, bot er diesem an den Iden des Februar 44 vergeblich Königstitel und Diadem an. Nach Caesars Ermordung stellte Antonius in Rom die Ruhe wieder her und bezog bald gegen die Caesarmörder Stellung. Sein Streben nach einer eigenen Machtposition in Oberitalien und Gallien führte zu einem Krieg mit dem Senat und dessen Verbündetem Octavian (Augustus). Trotz seiner Niederlage bei Mutina (Modena) gelang es ihm, sich mit Octavian und Marcus Aemilius (Lepidus) zu verständigen und mit ihnen gemeinsam durch den Abschluss des zweiten Triumvirats (27. 11. 43) die Macht im S...