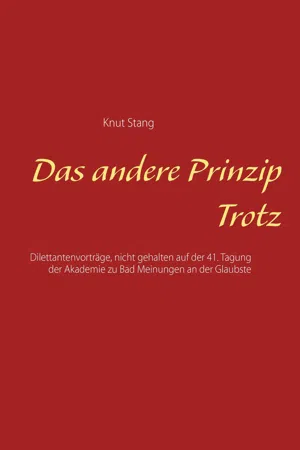
eBook - ePub
Das andere Prinzip Trotz
Dilettantenvorträge, nicht gehalten auf der 41. Tagung der Akademie zu Bad Meinungen an der Glaubste
- 556 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Das andere Prinzip Trotz
Dilettantenvorträge, nicht gehalten auf der 41. Tagung der Akademie zu Bad Meinungen an der Glaubste
Über dieses Buch
Beiträge aus verschiedenen Perspektiven zu einer moralischen Leitbilds des fortgesetzten Aufbegehrens gegen die angeblichen Unbedingtheiten des Seins, der Politik oder der Natur.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das andere Prinzip Trotz von Knut Stang im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Geschichte & Theorie der Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Karl Robert Schorle, M.A.: Wenn Niederlagen zu Erfolgen werden: Statt eines Geleitworts
Als Bürgermeister einer kleinen Stadt hat man nicht viele offizielle Anlässe, zu denen man etwas mehr oder weniger Gehaltvolles zu sagen hat. Da ist es umso betrüblicher, wenn einem dann auch noch einer dieser wenigen Anlässe abhanden kommt.
Als ich vor drei Jahren in dieses Amt gewählt worden bin, habe ich von meinem Vorgänger, dem unvergessenen Dr. Schröder-Huppendohl, neben vielen anderen Aufgaben auch die schöne Pflicht übernommen, die alle fünf Jahre stattfindende Tagung der Akademie zu Bad Meinungen als Schirmherr zu begleiten und, soweit es in den bescheidenen Möglichkeiten der Stadt liegt, zu unterstützen.
Wenn in diesem Jahr erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Tagung nicht stattgefunden hat, so ist dies nicht als Ausdruck zu verstehen, dass die Stadt Meinungen sich nicht mehr hinter die erklärten Ziele derjenigen stellen will, welche seinerzeit die Tagung ins Leben gerufen haben. Unverändert fühlen alle Bürger von Bad Meinungen sich dem Geist der Aufklärung und des freien Gesprächs mutiger Denker verpflichtet. Meine Damen und Herren, Sie wissen jedoch auch, dass wir anders als frühere Verwaltungen der Stadt uns dem Gesetz strikter Haushaltsdisziplin unterworfen haben. Wir sehen darin mehr als in allem anderen einen Beitrag, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch sorgenfrei in unserer schönen Stadt leben werden und die Verwaltung ohne Diktate des Landkreises oder der Landeshauptstadt auch weiterhin agieren kann.
Haushaltsdisziplin heißt aber eben auch, dass alle Ausgaben ohne Vorbehalte und Parteilichkeiten auf den Prüfstand gestellt werden. Hier hat manch ein lieb gewonnenes Ereignis, mancher Verein, manche traditionsreiche Einrichtung der Stadt Federn lassen müssen. Wir konnten hiervon auch die Tagung der Akademie, in der wir natürlich unverändert einen wichtigen Teil unserer Stadtchronik sehen, nicht gänzlich aussparen. Denn in der Vergangenheit hat die Stadt immerhin bis zu einem Viertel der unmittelbaren Aufwände für die Durchführung der Akademietagung übernehmen müssen. Gleichzeitig haben wir aber in diesem Jahr diverse zusätzliche Lasten schultern müssen, nicht zuletzt durch die erstmals auch durch unsere Stadt geleitete Landesrundfahrt der Radsportler, die, man muss das so sagen, nun einmal ein weitaus größeres Interesse der Öffentlichkeit findet als die alle fünf Jahre stattfindende Tagung der Akademie.
Letztlich musste die Verwaltung eine Entscheidung treffen, und man hat sich dies nicht leicht gemacht. Der Stadtrat hat zwei ganze Sitzungen fast ausschließlich auf diese Frage verwendet, ich selbst bin noch im Dezember vergangenen Jahres auf dem Landratsamt vorstellig geworden, um vielleicht doch noch zusätzliche Mittel zu beschaffen. Leider war es dann aber unumgänglich, die auf diese Art freigestellten Gelder für die Neugestaltung der Fußgängerzone vor dem Tagungsgebäude mitzuverwenden, was sicherlich mit Blick auf spätere Tagungen der Akademie eine sinnvolle und vernünftige Investition gewesen ist. Auch ist allseits bekannt, dass für unsere Stadt der Tourismus immer wichtiger wird. Warum sollen nicht auch die architektonisch so reizvollen Räume der Akademie hierfür geöffnet werden, nun da durch die Fußgängerzone ein direkter Anschluss zum Busparkplatz hinter dem Rathaus gegeben ist. Ich kann nur alle Leser dieses Buchs herzlich einladen, sich einmal, vielleicht auch im Rahmen eines Kurzurlaubs, die architektonischen, kulinarischen und künstlerischen Reize unser kleinen Stadt zu gönnen.
Was das vorliegende Buch betrifft, muss man es der Akademie nur umso mehr als Verdienst anrechnen, dass sie es trotz aller Beeinträchtigungen sich nicht hat nehmen lassen, die z.T., soweit ich weiß, bereits skizzierten Beiträge einiger Tagungsteilnehmer in dem Band zusammenzufassen, den Sie jetzt in Händen halten. Natürlich wäre es schön gewesen, die hier zusammengetragenen Gedanken und Ausführungen auch im Rahmen der Tagung und erhellt durch eine frische und muntere Diskussion zu Gehör zu bekommen. Aber auch in dieser Form meine ich, werden die Beiträge ihre Wirkung nicht verfehlen, haben sich doch auch in diesem Jahr wieder einige der ausgezeichnetsten Geister dieses Landes bereitgefunden, hierzu etwas beizutragen.
Ich meine daher, dass es der Leitung der Akademie, allen voran Herrn Dr. Nessken als ihrem Vorsitzenden, gelungen ist, eine scheinbare Niederlage in einen schönen Erfolg umzumünzen, indem diese, wie ich nicht zweifle, erstklassige Sammlung innovativen Denkens doch noch ans Licht der Welt gebracht werden konnte. Ich bin sicher, dass mit dieser Zähigkeit und dieser Kreativität auch und gerade in den Dingen des praktischen Lebens es der Leitung gelingen wird, in fünf Jahren dann auch wieder zahlreiche Freunde eines gehaltvollen Worts in den ehrwürdigen Räumen unserer schönen Akademie begrüßen zu können. Bis dahin hoffe ich, dass jeder Leser viel Nutzen und Gewinn aus der Lektüre der vorliegenden Beiträge ziehen und dass viele wichtige Diskussionen wie schon in der Vergangenheit hierdurch angestoßen und angeregt werden.
2 Arlt Neeskens: Was sich zusammenfindet, und was nicht
Die Geschichte der Akademie zu Bad Meinungen an der Glaubste ist eine Geschichte voll von Auf und Ab, das ist das Wesen der Geschichte überhaupt, könnte man sagen. In diesem Band sind einige der Beiträge versammelt, die wir eigentlich gehofft hatten, auf der Akademietagung zu hören. Diese Tagung ist entfallen, weil die Stadt Bad Meinungen an der Glaubste ihrer Budgetsteuerung andere Prioritäten gemeint hat geben zu müssen, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Dass eine Verpflichtung gegenüber der Tradition der Aufklärung und dem freien Spiel des Geistes höher zu werten ist als manches, was sich in Geld ausdrücken lässt, hat sich offensichtlich noch nicht in allen Winkeln unseres Landes oder auch unseres Denkens gleichermaßen verbreitet. Diese Akademie wird aber insbesondere hieran weiter arbeiten. Der Weg scheint doch noch länger zu sein, als wir alle noch vor wenigen Jahrzehnten vermutet hätten.
Es fehlen dadurch in diesem Band wichtige Beiträge, deren Autoren mit einer reinen Drucklegung nicht einverstanden gewesen sind. Nicht wenige haben zu Recht darauf hingewiesen, dass erst der Vortrag und der sich daran anschließende Diskurs im Rahmen der Akademietagung das eigentlich Besondere der Dilettantenvorträge ausmacht. Auch wollte man in einer solchen Form trotzigen Aufbegehrens ein klares Zeichen setzen gegen den in diesem Jahr nun einmal zu verzeichnenden Traditionsbruch. Ich werde weiter unten auf die Bedeutung und Dimension von Aufbegehren und Trotz noch eingehen und meine in der Tat, dass genau deshalb auch die nun nicht in diesem Band vorhandenen Aufsätze allein schon durch ihr Fehlen einen wichtigen Beitrag zum Gesamtanliegen darstellen. Dennoch ist es schade, dass dadurch vieles hier nicht erscheint, aber vielleicht in der nächsten Tagung – wir werden wieder versuchen, eine solche abzuhalten – vorgetragen werden kann. Erwähnen möchte ich daher hier nur zwei Beiträge, die dadurch für immer dahin sind. Adalbert Schick ist leider verstorben, bevor er seinen Beitrag zur Theorie der globalen Parallelphänomene am Beispiel des Pyramidenbaus in verschiedenen Teilen der Welt fertigstellen konnte. Wir verneigen uns in Erinnerung an diesen großen Lehrer und Forscher, dessen Lebenswerk im Bereich der elliptischen Kurven sicherlich noch weit in die Zukunft wirken wird. Wir haben dem Wunsch seiner Erben entsprochen, den uns vorliegenden, aber noch nicht von letzter Hand bearbeiteten Beitrag nicht zu veröffentlichen. Zweitens wäre hier Kerstin Siggebord anzuführen, deren Beitrag erst auf Basis eines mit den Zuhörern durchgeführten Experiments zur Kommunikation zwischen Hunden und zufällig ausgewählten Probanden zustande gekommen wäre. Sie wird dieses Experiment an anderer Stelle durchführen und entsprechend dann dort ihre Erkenntnisse veröffentlichen. So ist immerhin der wissenschaftlichen Gemeinschaft nichts, nur unserem vorliegenden Band ein wichtiger und zweifellos interessanter Beitrag verloren gegangen.
Dennoch ist es aber m.E. gelungen, hier eine recht stattliche Sammlung zusammenzutragen, zumal der eine oder andere die Gelegenheit genutzt hat, dann auch etwas ausführlicher seine Gedanken darzulegen, als dies im Rahmen eines Vortrags möglich gewesen wäre. Zudem haben die meisten Autoren auch anders, als es sonst Tradition der Dilettantenvorträge ist, ihre Aufsätze mit Verweisen auf die unmittelbar genannte Literatur versehen. Vor allem aber konnten wir in mehreren Fällen den Autoren bereits frühzeitig die Beiträge in diesem Band wenigstens in einer ersten Fassung zur Verfügung stellen. Insbesondere Haldert Gudmunsson hat in seinem Beitrag hierdurch an mehreren Stellen auch Bezug nehmen können auf andere in diesem Band befindliche Aufsätze, darunter vor allem jene von Bernd Schierbrook und von Albert Svargt. Schließlich will ich hier auch den Ergänzungsteil des Beitrags von Georg Porten nennen, der in einer Vortragsveranstaltung sicher der begrenzten Zeit zum Opfer gefallen wäre. Ich habe gerade diese Seiten, ich gestehe es, stellenweise durchaus auch mit Vergnügen gelesen. In diesem Fall tritt für mich deutlich zutage, wie eng beieinander Realität, Fantasie und eben auch Satire manchmal liegen.
Alle Beiträge durchzieht jedoch noch etwas anderes, und es war dies auch ein zusätzliches Motiv, diese Aufsätze trotz des Entfalls der ihnen eigentlich vorausgehenden Tagung zusammenzustellen und in den Druck zu geben. Es ist dies das Prinzip Trotz, welches dem Band daher auch den Namen gegeben hat. Sie werden freilich dem Beitrag von Bernd Schierbrook entnehmen, dass wir hier von einem Prinzip Trotz sprechen, dass deutlich anders gemeint ist als es seinerzeit im bekannten Werk von Robert Jungk der Fall gewesen ist. Daher haben wir diesen Band als „Das andere Prinzip Trotz“ betitelt. Es bildet vielleicht nicht wirklich einen roten Faden, der quasi alle Beiträge in diesem Band durchzöge, ist aber doch mehr als nur ein gelegentliches Motiv. Das führt mich zu der Überlegung, dass, wenn doch eine ganze Reihe interessanter Autoren, wie wir sie hier versammelt haben, ohne sich untereinander großartig abzustimmen, die eine oder andere Form von Trotz als wichtiges Element ihrer Beiträge einführen, dieser vielleicht insgesamt ein noch nicht hinreichend diskutiertes oder auch nur beschriebenes Element dessen ist, was man meist mit dem unschönen Wort „Zeitgeist“ bezeichnet. Oder vielleicht eher noch Element eines Geists, der Zeitgeist werden sollte, dies aber jedenfalls heute vielleicht noch nicht ist.
Was meine ich damit? Die vergangenen Jahrzehnte waren stark geprägt von verschiedenen Spielarten eines schlichten Engineering in allen Wissenschaften, aber auch in der Politik und auf weite Strecken sogar in der Kunst. Wir haben uns, jeder einzelne, oftmals sehr rasch abgefunden mit den angeblichen oder tatsächlichen Gegebenheiten des Felds, auf dem wir uns bewegten. Jede beliebige Disziplin wurde auf diese Art zur Kunst des Machbaren, um einmal einen Ausdruck von Bismarck zu verwenden. Aber es war dies dann immer auch eine Reduktion der Kunst auf das Machbare, auf das lediglich Machbare eigentlich. Und wir haben alle zu wenig, zu selten, mit zu wenig Hartnäckigkeit gefragt und immer wieder nachgefragt, ob das, was uns als machbar erschien oder was andere als die Grenzen des Machbaren umrissen haben, tatsächlich die Grenzen unseres Tuns bildet. Das Festhalten an etwas, von dem scheinbar längst festzustehen scheint, dass es nicht geht, nicht klug ist oder keine Mehrheitsfähigkeit aufweist, das mag dem einen oder anderen als Trotz oder Sturheit ausgelegt werden. Ich erinnere an dieser Stelle an die viel zu früh verstorbene Regine Hildebrandt, die oft einen Satz benutzt hat, der dann auch den Titel eines Buchs über sie bildet: „Erzählt mir doch nich, dasset nich jeht!“ Wir akzeptieren alle zu schnell, dass dieses oder jenes nicht geht und vergessen dabei, dass das Verwirklichen dessen, was wir denken oder träumen, nicht selten erst die Wirklichkeit erschafft, in der es möglich ist.
Unser Ehrenpräsident, Elias Koeldemanns, hat die Tagungsteilnehmer im Vorfeld der Erstellung des vorliegenden Bands dazu ermuntert, ihre Vorträge mögen sich in mehr als nur der erwarteten oder vielleicht auch beabsichtigten Hinsicht als ungehalten erweisen. Denn es ist, so meine ich dies verlängern zu dürfen, nun in der Tat gerade dies ungehaltene Aufbegehren, dieser vielleicht ganz kindische, jedenfalls bestimmt kindliche Unverstand, was sich auf mittlere Sicht vielleicht geradezu als Leitstern und Licht in dunkler Nacht des Denkens erweisen wird.
Auch die weiteren Beiträge in dieser Zusammenstellung sind in der einen oder anderen Hinsicht ein deutlicher Beleg dafür, wie zeitgemäß, ja wegweisend dieses neu definierte Prinzip Trotz ist. Nicht nur Elias Koeldemanns hat das in seinem eigenen Beitrag, auf den wir naturgemäß besonders stolz sind, sehr deutlich gemacht. Charles Lewis Whitey meint man in seinen Zeilen geradezu gegen Türen und Möbel treten zu hören, und auch Bertha Graanz lässt trotz schweizerischer Vornehmheit und intellektueller Zurückhaltung an ihre Verärgerung über die unzureichende Grundlegung unserer heutigen Strafrechtspraxis keinen Zweifel.
Sie wissen vielleicht, dass die Kinderpsychologie den Begriff der Trotzphase inzwischen weitgehend durch den Begriff der Autonomiephase ersetzt hat, weil dem Begriff des Trotzes eine starke Wertung innewohnt. In der Autonomiephase erreicht das Kind mehr oder weniger weitgehend die Herausbildung einer eigenständigen Ichkonzeption in klarer Abgrenzung von der Welt der Anderen. Dabei schlägt es oft über die Stränge, muss das tun, um sich im ersten Moment vielleicht weiter zu distanzieren, stärker abzugrenzen, als das der Sache nach notwendig wäre. Ansichten und Meinungen werden entsprechend nicht zurückgewiesen, sie werden zurückgeschleudert, Unmut wird nicht durch Stirnrunzeln ausgedrückt, sondern durch Toben und Schreien. Zugleich begreifen wir in dieser Phase häufig auch, dass es keine unbedingte Korrelation zwischen unseren Bedürfnissen und Wünschen und deren Erfüllung gibt. Enttäuschung ist ein biografisches Element, das in dieser Phase oft zum ersten Mal in unser Leben tritt.
Den Trotz als Moment unseres Denkens in den intellektuellen Diskurs zu bringen, scheint daher zunächst den Ideen der Rationalität und Aufklärung, welchen die Akademie zu Bad Meinungen sich verpflichtet fühlt, zuwider zu laufen. Man hält an offensichtlich widerlegten Ansichten fest, man bemüht ein erhebliches emotionales Reservoir, wo nüchterner Verstand vollkommen hinreichend wäre.
Es gibt bekanntermaßen die verbreitete Neigung, von einem Gegensatzpaar aus Rationalität und Emotionalität zu sprechen. Aber tatsächlich erzeugt unsere Emotionalität den gesamten Seinsraum unserer Eigenwahrnehmung und umschließt damit auch alles Rationale. Das eigentliche Gegensatzpaar in diesem Raum ist, hingewendet auf die Rationalität, mithin nicht die Emotionalität, sondern e verbo ipso die Irrationalität. Jene aber ist nicht synonym zur Emotionalität, sie ist synonym zu einer inneren Haltung des Handelnden. Diese Haltung, die man Irrationalität nennt, ist die Gleichgültigkeit gegenüber der Begründbarkeit des eigenen Handelns.
Wenn einer sagt, es ist mir egal, welche Begründungen ich für mein Handeln nennen kann, heißt das nicht, dass es solche Begründungen nicht geben kann; es heißt auch nicht, dass er diese nicht kennt. Da Handeln immer aus Gründen geschieht, kann man immer auch Begründungen formulieren, die insoweit zutreffend sein können, wie sie auf einer richtigen Annahme über diese Gründe beruhen. Doch ist nicht auszuschließen, dass ich meiner Handlungsgründe unsicher, mithin zu Begründungen nicht imstande bin. Es kann aber auch sein, dass ich diese möglichen Begründungen durchaus kenne, über sie aber nicht Rechenschaft ablegen mag.
Für Irrationalität ist dies alles im wahrsten Sinne gleichgültig. Sie weist die Forderung nach Begründung der eigenen Handlung zurück: als lächerlich, als Zeitverschwendung, als unlösbar, als belanglos.
Mithin wäre Rationalität zunächst der Wunsch, die eigenen Handlungen begründen zu können, sowie die Tätigkeit, über diese Begründungen bzw. über die hierdurch formulierten Gründe des Handelns nachzudenken. Es wäre sodann aber im sozialen Miteinander auch der Wunsch, diese Begründungen kommunizieren zu können. Dies hat zwei Erfordernisse: Zum einen muss man die jeweilige Begründung kommunizieren können, sie muss also in eine Form gebracht werden, die sie intersubjektiv verstehbar macht. Dies erfordert immer eine Form von Sprache, und sei es auch die Sprache von Kunst oder Musik. Zweitens muss die Begründung aber so sein, dass man sie nicht nur kommunizieren kann, sondern dass man sich auch bereit dazu findet. Nicht jeder Handlungsgrund ist sonderlich schmückend, wenn man ihn anderen berichtet; manches ist geradezu peinlich. Ein rationaler Mensch wird also auch versuchen, so zu handeln, dass das Vertreten seiner Beweggründe, also das Begründen seiner Handlungen, nicht zu Beschämung, Skandal oder gar Gefängnisaufenthalt führt.
Der Trotz ist keine Haltung, welche sich der Forderung nach Begründbarkeit des eigenen Handelns verweigert. Er wird auch häufig zu Unrecht gleichgesetzt mit einer Haltung, die Ansichten auch dann nicht aufgeben will, wenn Vernunft und gute Gründe dagegen sprechen. Aber das ist hier nicht der Fall. Das Festhalten an unseren Ideen aus einem Moment des Trotzes heraus speist sich eher aus einem starken Misstrauen gegenüber den allzu leichten und schnell gefundenen Argumenten gegen unsere Ideen. Wer einer neuen Idee entgegen wirft: „Tun Sie das nicht, das haben wir noch nie so gemacht!“, muss damit rechnen, dass ihm ein „Ist mir doch wurscht!“ entgegenschallt.
Es hilft ein wenig, das Wort „Trotz“ im ursprünglichen Sinne zu verstehen: Es ist der Trotz sprachgeschichtlich eng dem Trutz verwandt, also dem kämpferischen Widerstand. Auch dieser ist in gewissem Maß unvernünftig, ist aber zugleich auch vernünftig hinsichtlich des eigentlichen Ziels, nämlich der Wahrung der eigenen Autonomie gegen den Versuch eines anderen, uns seiner Verfügungsgewalt zu unterwerfen. Schon deshalb ist der Trotz, also das Aufbegehren gegen die Macht des tatsächlich oder auch nur scheinbar Faktischen eine unmittelbare Voraussetzung, die Freiheit zu gewinnen und zu verteidigen, welche unabdingbare Voraussetzung jeder Autonomie ist. Und es ist zur Freiheit vielleicht der einzige Weg, den zu beschreiten nicht voraussetzt, dass er schon bis zu seinem Ende beschritten ist. Auch in größter Unfreiheit kann der Mensch zum Trotze finden. Das nützt ihm dann vielleicht nichts mehr, aber es erlaubt ihm eine Stiftung seiner Identität aus diesem Erleben des eigenen Trotzes heraus. „Ich bin, der widersteht“, kann eine durchaus sinnvolle Seinsdefinition werden.
Insgesamt ist also der Trotz ein wichtiger Krückstock der Einsichtsmehrung, auf den gestützt sie auf der Straße der Ahnungslosigkeit vorwärts humpelt. Wie viele Fallstricke dabei ihrer lauern, das ist auch etwas, womit sich direkt oder zwischen den Zeilen der eine oder andere der nachfolgenden Beiträge auseinandersetzen wird. Das betrifft nicht nur die hier wiedergegebenen Gedanken und Einsichten, sondern mindestens hier und da auch ein stures Festhalten nach dem Suchen nach Antwort, wo andere vielleicht längst gesagt haben, dass zu antworten in dieser Frage nicht möglich, oder wenn, so doch jedenfalls kaum hilfreich und zielführend sein könne. Die Autoren in diesem Band sagen mehrheitlich, Sie werden das bemerken: „Na und? Ist mir doch wurscht!“
3 Bernd Schierbrook: Was wir nicht sind
Bernd Schierbrook ist den meisten Lesern wahrscheinlich vor allem aufgrund seiner sportlichen Erfolge bekannt, war er doch einer der ersten, denen es gelang, in nur einem Jahr alle zwölf bedeutenden Meerengen der Welt zu durchschwimmen. Darüber hinaus ist er seit geraumer Zeit ein wichtiger Forscher und Lehrer im weiten Feld der praktischen Sportwissenschaften.
3.1 Eigentlich eine simple Fra...
Inhaltsverzeichnis
- Vorangesetzte Nachbemerkung
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Karl Robert Schorle, M.A.: Wenn Niederlagen zu Erfolgen werden: Statt eines Geleitworts
- 2 Arlt Neeskens: Was sich zusammenfindet, und was nicht
- 3 Bernd Schierbrook: Was wir nicht sind
- 4 Martin Kladerer: Notizen zu Tolkien
- 5 Bengt Malte Schmickler: Der Topf am Ende des Regenbogens
- 6 Jacqueline Merot-Beconde: Der Begriff des Richtigen in der Geschichtswissenschaft
- 7 Charles Lewis Whitey: Als würd bei Nachbars eine totgeschlagen
- 8 Elias Koeldemans: Heraklit und Adam Smith
- 9 Bertha Graanz: Die andere Seite der Gitterstäbe
- 10 Haldert Gudmunsson: Das Ich und sein Ich: Individuelle Kohärenz und Vielheit
- 11 Georg Porten: Verschwörungstheorien für jedermann
- 12 Albert Svargt: Was ist Philosophie?
- Impressum