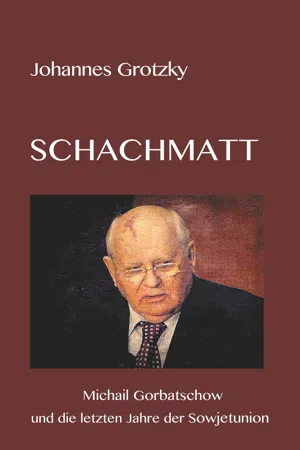![]()
MENSCHEN UND MÄCHTIGE
NEUER MANN AUF ALTER LINIE?
Konstantin Tschernenko löst Jurij Andropow ab6
Mit einem groben Strohbesen klopft die Putzfrau frischgefallenen Schnee von der Blumenpracht und glättet die roten Schärpen mit den Goldlettern. Behutsam fegt sie danach eine kleine Fläche vor ihren Füßen blank. Neugierig verfolgen Touristen aus der Ferne die Bewegung und tuscheln leise: „Dort muss es sein, da liegt er.“ Gemeint ist Moskaus neueste Sehenswürdigkeit, das Grab des Staats- und Parteichefs Andropow am Roten Platz, das auch eine Woche nach der Beerdigung durch seinen Blumenschmuck deutlich an der Kreml-Mauer auszumachen ist. Wo später einmal ein Gedenkstein aufgestellt werden soll, reflektiert vorerst ein metallblitzender Ährenring mit Hammer und Sichel das fahle Winterlicht. Noch gibt die sowjetische Hauptstadt nicht zu erkennen, ob mit Andropows Tod eine Ära oder doch nur eine Episode zu Ende gegangen ist. Die Trauerbeflaggung und die schwarz-rotumrandeten Gedenkbilder sind schnell aus dem Stadtbild verschwunden. Der neue Mann im Amt ist den Menschen noch nicht präsent. Die Verkäuferin im „Haus der Bücher“ am Kalinin-Prospekt schüttelt jedenfalls heftig den Kopf: „Nein, Tschernenko-Poster gibt es noch nicht. Da müssen Sie warten. Wir haben aber noch Andropow auf Lager.“
Nur in der Abteilung für politische Literatur macht sich der Wachtwechsel bemerkbar. Es gibt Titel über die Parteiarbeit, und eine Neuauflage von Tschernenkos gesammelten Reden ist Ende Januar, also gerade rechtzeitig, erschienen. Keines der imposanten Werke ist unter vierhundert Seiten stark. Dem Interessenten möchte die Händlerin gleich alle Bücher verkaufen, „weil man sie ja sowieso in der nächsten Zeit brauchen wird“. Die erste Überraschung nach Tschernenkos Wahl zum Generalsekretär der KPdSU kostet nur zehn Kopeken: eine 32-seitige Broschüre mit den Materialien des außerordentlichen ZK-Plenums, auf dem die Nachfolge-Entscheidung gefallen war. Sie enthält nicht nur die bereits veröffentlichten Reden, sondern auch eine 29 Zeilen lange Ansprache des Politbüro-Mitgliedes Michail Gorbatschow. Von ihm war stets die Rede gewesen, wenn es um eine Alternative zum 72-jährigen Tschernenko ging. Nicht wenige Beobachter sahen in der Wahl Tschernenkos eine Entscheidung gegen Gorbatschow, den erst 53-jährigen Landwirtschaftsfachmann, ZK-Sekretär und Repräsentanten der so genannten Junioren-Riege in der obersten Parteiführung.
Nun wird dieses Bild zurechtgerückt. Gorbatschow durfte nicht nur die einmütige Wahl Tschernenkos vor dem Plenum feststellen, er verschaffte sich mit den Worten: „Das Plenum ist beendet“ auch protokollarischen Respekt, der zukunftsträchtig sein kann. Offenbar hat Gorbatschow die Sondersitzung des ZK geleitet, was seine Bedeutung im Politbüro belegt. So erklärt sich jetzt auch die Formation der Parteiführung bei der Trauerfeier für Andropow. Da nämlich wurde der designierte Andropow-Nachfolger links flankiert von Regierungschef Tichonow und an seiner rechten, protokollarisch bedeutenderen Seite von Gorbatschow. Es besteht daher kaum noch ein Zweifel: Der relativ junge Gorbatschow ist von der Altherren-Riege im Kreml nicht ausmanövriert worden, er hat seine Stellung im Politbüro vielmehr ausgebaut und kann von dort aus gelassen das derzeitige Regiment des Triumvirats - Tschernenko, Gromyko und Ustinow - überdauern. Anders hingegen ist es dem aserbaidschanischen Saubermann Gejdar Alijew ergangen. Auch er galt als einer der Nachfolge-Favoriten, aber er wurde bei der Neuverteilung der Macht ganz an den Rand des Politbüros gedrängt. Verwirrung lösen schließlich noch die Vermutungen um Witali Worotnikow aus. Dem Ministerpräsidenten der Russischen Föderativen Sowjetrepublik war erst im vergangenen Dezember der Sprung ins Politbüro gelangen. Er galt als anerkannter Andropow-Mann und als Symbol für die trotz Krankheit vorhandene Entscheidungskraft und den Einfluss des Parteichefs, der sich monatelang nicht mehr öffentlich gezeigt hatte. Doch Worotnikow fehlte bei der Abschiedszeremonie an Andropows Aufbahrungsstätte, obwohl das Protokoll getreu dem russischen Alphabet seine Anwesenheit ganz oben notierte. Unterdessen stellt sich das Sowjetvolk wieder auf vertraute, inzwischen längst überholt geglaubte Sitten ein.
Lobenshymnen auf den Generalsekretär, die man in den letzten fünfzehn Monaten so angenehm vermisst hat, gehören erneut zum politischen Alltag. So erscheint im Fernsehen der moldawische Kolchosleiter und der usbekische Maschinist, die beide immer schon gespürt haben, welche hervorragende Führungspersönlichkeit, welch wirklich Leninscher Typ der neue Mann an der Parteispitze ist. Die beiden sind anscheinend nicht allein. Die abendliche Nachrichtensendung Wremja präsentiert jedenfalls immer neue Beweise der Zuneigung, Hochachtung und Wertschätzung für Tschernenko. So gerät der Einleitungssatz einer Meldung über Grußadressen an den neuen Generalsekretär im Druck neunzehn Zeilen lang, weil keine gesellschaftlich wichtige Gruppe fehlen darf: die Parteiorganisationen, die Komsomolzenverbände, die Kulturschaffenden, die Arbeitskollektive, das Militär – alle wollen im selben Atemzug genannt werden, um nicht mit ihren Erfolgswünschen für den neuen Mann zurückzustehen. Der neue Stil prägt auch die Wahlreden, mit denen sich die Kandidaten für die Abstimmung zum Obersten Sowjet am 4. März vorstellen.
Plötzlich wird Tschernenkos politischer Beitrag auf dem ZK-Plenum im Juni vergangenen Jahres vor der Leistung Andropows eingestuft. Diese Aufwertung ist zwar noch nicht durchgängig, aber erfahrene Apparatschiks wie der Breschnew-Mitstreiter und ZK-Sekretär Michail Simjanin wissen die neue, alte Linie zu deuten. Simjanin hat bereits Tschernenkos altes Losungswort vom Kampf gegen die bürgerliche Ideologie wiederaufleben lassen, das nun von einigen Künstlern wie ein Damoklesschwert über ihrer Art von Kulturverständnis gefürchtet wird. Wo lässt sich unter diesen Umständen eine veränderte, beweglichere Politik erwarten? Bisher gibt es darauf nur eine unbefriedigende Antwort: Das Neue an Tschernenkos Regime besteht wohl in der Wiederholung des Alten, nicht nur dem Stil, auch dem Inhalt nach. Es ertönen die gewohnten Bekenntnisse zu friedlicher Koexistenz, zu Verhandlungen, aber unter den bekannten Vorbedingungen.
Großherzige Gesten wie ein Angebot zur Verschrottung sowjetischer Raketen wird es in naher Zukunft nicht geben. Die außenpolitischen Erklärungen, die Tschernenko während der Beileidsbesuche westlicher Regierungschefs abgab, tragen eindeutig die harte Handschrift Gromykos. So zeigte das sowjetische Fernsehen einen Bundeskanzler Kohl, der vom neuen Kremlchef wegen der Raketenaufstellung gemaßregelt wurde. In den bundesdeutschen Medien hingegen wurde das dreißigminütige Treffen zu einem Beweis staatsmännischer Aktivitäten im deutsch-sowjetischen Verhältnis stilisiert. Kein Wunder, dass Moskau rasch noch eine erneute Kritik an Kohl nachschob. Auch unter Tschernenko wird die Sowjetunion weiterhin glauben, sie sei in der Raketenfrage vom Westen - von der Bundesrepublik besonders - hinters Licht geführt worden.
Im Augenblick scheint im Kreml nur Kanadas Regierungschef Trudeau gut gelitten zu sein. Seine Visite - eingereiht in Tschernenkos Gespräche mit Fidel Castro, Ortega aus Nicaragua und Karmal aus Afghanistan - zeigt nach außen Einmütigkeit. Allerdings kann sich die sowjetische Führung auf dem allgemeinen Nenner einer „ernsten Bedrohung über die wachsenden Spannungen in der Welt“ auch mit anderen Regierungen treffen, vorausgesetzt sie will es. Gegenüber einigen Ländern will der Kreml offenbar kühle Distanz demonstrieren. Das Beispiel Japan zeigt hier Kontinuität: Im Rahmen der Beerdigungsdiplomatie musste der japanische Außenminister von seinem sowjetischen Kollegen einen Rüffel hinnehmen. Bisher - so das Besucherbulletin ungeniert - fehle es in Japan an dem notwendigen Widerhall für gutnachbarliche Beziehungen mit der Sowjetunion. Nur wenig später erklärten die Sowjets vor Ort in Tokio, sie würden Japans Aufrüstung und die geplante Entsendung amerikanischer Kampfflugzeuge nicht stillschweigend hinnehmen. Inzwischen hat Moskau einen zweiten Flugzeugträger losgeschickt, um seine Pazifikflotte zu stärken. Doch das sind Schritte, die noch nichts über Moskaus neue Außenpolitik aussagen, weil sie gewiss nicht erst mit der Wahl Tschernenkos zum Generalsekretär eingeleitet wurden.
![]()
DIKTATOR UND POET DAZU
Ein Film zum Andenken an Jurij Andropow ist die
Sensation von Moskau7
Die schwere SIL-Limousine gleitet über den Roten Platz, taucht unter dem Spaskij-Turm an der Kreml-Mauer hindurch und schwenkt vor dem Regierungsgebäude ein. Sanfter Stopp, heraus steigt der Parteichef. Die Kamera verfolgt seinen Weg in das Sitzungszimmer des Politbüros, er wird zackig gegrüßt von der Kreml-Garde. - Das sind die ersten Szenen aus einem Film über Jurij Andropow, der in Moskau vor erlesenem Publikum Premiere feierte. Seine früheren Berater, hohe KGB-Leute und Moskaus Kulturschickeria waren ebenso in den kleinen Saal des Kinotheaters Oktjabr am Kalinin-Prospekt gekommen wie Sohn Igor, der die Sowjetunion in Griechenland als Botschafter vertritt. Was auf der Leinwand zu sehen war, verdient für sowjetische Verhältnisse die Bezeichnung „sensationell“.
Zum 70. Geburtstag des im vergangenen Februar verstorbenen Parteichefs wurde kein Verschnitt aus öffentlichen Auftritten und Reden geliefert, sondern das sehr intime Porträt eines Mannes, der für seine Frau Liebeslyrik schrieb und sich per Gedicht mit dem nahenden Tod auseinandersetzte. Im Gegensatz zu dem sonst traditionell abgeschirmten Familienleben der Sowjetführer wagte sich Tatjana Filipowna vor die Kamera, Andropows Witwe, über deren Existenz bis zu seinem Tod nur gerätselt wurde. Sie schildert schlicht, wie sie ihren Mann bei der Jugendorganisation Komsomol kennen und lieben gelernt hat. Seine Stimme, sein Gesang haben sie bezaubert. Fotos aus den Jahren der Familienidylle mit den Kindern geben ihrer Schilderung etwas rührend Alltägliches. In einer Rückblende fängt der Film die dörfliche Umgebung von Andropows Heimatort Nagutskaja ein. Das sowjetische Publikum wird bemerken, dass der viel gelobte Parteichef wie sein späterer Nachfolger Gorbatschow aus dem Gebiet von Stawropol stammt. Von dort führt der Film über die vielen Stationen der Karriere bis in die Moskauer Stadtwohnung am Kutusowskij Prospekt 26. Im gleichen Haus, in dem auch Breschnew als Mieter registriert war, lebte die Familie angeblich seit mehr als dreißig Jahren. Geblümte Stoffe, lackierte Holzmöbel zeugen von biederer Behaglichkeit. Am Tisch sitzen Mutter, Sohn und Tochter, für die Aufnahmen in Sonntagsstaat gekleidet, doch nur Andropows Witwe ergreift das Wort; ihre erwachsenen Kinder lauschen artig. Ein Schwenk - und die Leinwand ist übersät mit Büchern, die in Andropows Arbeitszimmer aufgestellt sind. Neben den Klassikern des Marxismus-Leninismus hat sich der Politiker auch mit Dante und Kant befasst. Dann zeigt die Kamera Don Quichotte als Holzfigur, streift kurz ein impressionistisches Blumenaquarell. Noch im Nachhinein wird das Image des aufgeklärten, in westlicher Literatur belesenen Parteiführers gepflegt. Selbst sein Deckname Magikas aus der Zeit der Partisanenkämpfe in Karelien ist eine Anleihe aus der russischsprachigen Fassung von David Copperfields Buchtitel vom letzten Mohikaner. Hinter Glas entdeckt der Zuschauer ein Foto Andropows mit dem ungarischen Parteichef János Kádár. Beide verband eine lange Freundschaft aus der Zeit als Andropow Botschafter in Ungarn war.
Für das Publikum hält der Film einen Schock bereit: Der Ungarn-Aufstand 1956 wird in drastischen Zeitdokumenten vorgeführt. Straßenschlachten, zerschossene Sowjetsterne, brutal erschlagene Opfer der Unruhen. Der Kommentar ist einseitig, aber auch vielsagend. Andropow – so erzählt János Kádár vor der Kamera – habe sich in dieser Ausnahmesituation nicht schablonenhaft verhalten, sondern dem Land viel geholfen. Dass die Sowjetarmee den Aufstand niedergeschlagen hat, wird verschwiegen. Wer etwas zu sagen hat im Nach-Andropow-Russland, taucht im Bild auf. Zu Wort kommt jedoch keiner von ihnen. Nur ein Mann fehlt ganz und gar: Andropows unmittelbarer Nachfolger Tschernenko. „So etwas hat es noch nicht gegeben“, urteilt ein etwas 35 Jahre alter Mann nach der Aufführung. Andere waren sichtlich ergriffen. Einige wischten sich Tränen aus den Augen. Das Erbe Andropows soll zu seinem Geburtstag am 15. Juni in der Öffentlichkeit propagiert werden. Michail Gorbatschow versucht, von der Aufbruchsstimmung zu profitieren, die von Andropow erzeugt worden war. Gorbatschow, das ist die Botschaft, verwirklicht, was Andropow nur begann: Bür...