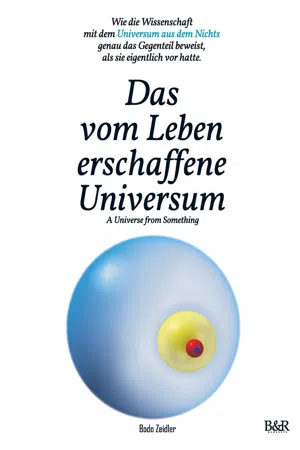
eBook - ePub
Das vom Leben erschaffene Universum - A Universe From Something – Edition 3
Wie die Wissenschaft mit dem Universum aus dem Nichts genau das Gegenteil beweist, als sie eigentlich vor hatte.
- 144 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Das vom Leben erschaffene Universum - A Universe From Something – Edition 3
Wie die Wissenschaft mit dem Universum aus dem Nichts genau das Gegenteil beweist, als sie eigentlich vor hatte.
Über dieses Buch
Deutsche FassungA UNIVERSE FROM SOMETHING behandelt eine ganz übersichtliche, wissenschaftliche Fragestellung: "Wenn das Universum aus dem Nichts entstanden ist, so wie es die Wissenschaft vermutet, wo befanden sich die dafür notwendigen Naturgesetze?"Wenn es so war, dass die Naturgesetze Bestand haben mussten, so deutet das womöglich auf eine initiierende Instanz des Universums hin.Der Einklang von Wissenschaft und der Tatsache, dass 4 Milliarden Menschen an das Göttliche glauben, ist zentrales Thema des Buches, und wird in kleinen Episoden möglichst haarscharf behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das vom Leben erschaffene Universum - A Universe From Something – Edition 3 von Bodo Zeidler im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Naturwissenschaften & Physik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Von Aaron und den falschen Weltbildern
(Gesamtfassung)
Als es Abend wurde, und die Dunkelheit über den Bergen herein brach, legte sich Aaron auf den kargen Boden und blickte in den Himmel. Er hatte sein Tageswerk vollbracht. Seine Augen und Gedanken schweiften ein weiteres Mal in die Ferne, auf das, was am Tage über ihm war. Bei seinen Handelsreisen hatte er jeden Abend Zeit, darüber nachzudenken, wie der Himmel funktioniert. Es waren so viele Sternenbilder zu sehen, und jeden Abend sahen sie gleich aus, bis auf den Mond, der so groß und von Mustern durchzogen war. Auf das Schauspiel der Natur zu schauen, war sein alltäglicher Genuss, die Belohnung seiner steten Reise. Tausende Male hatte er sich vor dem Schlafen alles genau beschaut. Und wie das da oben genau funktionierte, war ihm nicht klar, außer dem, was augenscheinlich und logisch war: Alle Himmelskörper umringten das flache Land, auf dem er lebte und Handel trieb.
Aus heutiger Sicht wissen wir beide, dass das Bild, was der Aaron da hatte, wohl nicht stimmt. Die Welt ist kein flaches Land, und die Himmelskörper kreisen nicht um uns, mit Ausnahme des Mondes. Die Wissenschaft hat sich dramatisch weiter entwickelt. Heute wissen wir, wie alles funktioniert, denn kluge Köpfe und Raumschiffe haben ja alles erkundet. Wir sind zudem auf dem Mond gelandet, und haben festgestellt, dass dieser auch wirklich da ist, und dass man auf ihm laufen und zurück auf die Erde blicken kann. Auch den Mars haben wir bereits erkundet, und Teleskope zeigen uns den Rest des Universums. Wir haben bewiesen, dass Masse, Raum und Zeit voneinander abhängig sind. Und nur mit dieser Erkenntnis ist es möglich, Satelliten und deren Signale so genau zu deuten, dass GPS-Systeme anzeigen, wo wir uns auf dem Erdball gerade befinden. Der Drops ist also gelutscht, wir wissen, wie alles geht und funktioniert.
Der wissenschaftliche Mensch hat eine Eigenart: Er meint zu wissen, wie alles funktioniert. Der Aaron, der auf seinen Handelsreisen in den Himmel schaute, war sich sicher, dass seine Sicht auf die Dinge richtig sei. Sein Leben funktionierte. Der Himmel fiel ihm nicht auf den Kopf, und das Land trug ihn. Und das Land war eben. Ab und zu gab es zwar ein paar Berge, auf die er hoch steigen musste mit seinem bepackten Esel, aber wo es hoch ging, ging es auch alsbald wieder runter, und am Ende seiner Reise war wieder das Meer vor ihm, wo alles ganz flach und eben war.
Auch wir in der heutigen Zeit sind uns so sicher wie der Aaron. Bis auf ein paar Feinheiten, wie nun genau das kleinste Teilchen aussehen mag, meinen wir alles zu wissen. Und wir bestärken uns mit gutem Grund in unserem Wissen, denn die GPS-Systeme funktionieren ja. Das, was der Einstein da über Raum, Masse und Zeit behauptete, stimmt ganz sicher, weil wir sein Wissen anwenden, und zwar sehr genau und sehr geschickt. Und weil wir alles so genau wissen und unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse weitreichend anwenden, gibt es keinen Zweifel an unserem Bild von Welt und Universum. Die Wissenschaft hat gesiegt, alles ist beantwortet.
An dieser Stelle müsste das, was ich hier schreibe, dann ja eigentlich zu Ende sein. Alles ist gesagt. Das, was man früher dachte, ist falsch, und was wir heute wissen, ist alles richtig und bewiesen.
Es gibt da bloß einen Haken, und dieser eine Haken bewegt mich, als Durchschnittsmensch und Nichtphilosoph, diese Gedanken für Dich aufzuschreiben. Es ist offensichtlich: Alle bisherigen Weltbilder waren grottenschlecht und substanziell falsch, und diese Erkenntnis bewegt mich dazu, anzunehmen, dass auch das aktuelle wissenschaftliche Bild von Welt und Universum substanziell falsch ist, wenn nicht sogar falscher als alle vorigen.
Im Groben beginnt meine Reise durch die Weltbilder genau bei diesem Aaron. Dieser war ein Händler im Altertum. Möglicherweise hat er 3.000 Jahre vor Christus gelebt, als Sohn eines durchschnittlichen Elternhauses, in dem auch der Vater Handelsmann war und seine Kenntnisse über den Beruf seinem Sohn weiter vermittelt hatte. Seine Mutter war zuhause, kochte und machte sich weniger Gedanken über Weltbilder, sondern sorgte für das leibliche Wohl der Familie und war das Zentrum der Liebe und Güte. Eines Tages zog Aaron dann in die weite Welt, um Handel zu treiben, zündete sich allabendlich ein Lagerfeuer an, um zu speisen, sich zu wärmen und wilde Tiere von sich fern zu halten. Und wäre sein gesamter Tag mit Arbeit ausgefüllt gewesen, hätte er sich wohl auch niemals Gedanken gemacht, wie die Welt und das Universum funktionieren mögen. Aber allein am Lagerfeuer zu liegen, war eben ein wenig fad, und so schweifte sein Blick in den Himmel, und er fühlte sich inspiriert, darüber nachzudenken, was da oben sei.
Aaron hatte von seinem Vater kein wissenschaftliches Wissen vermittelt bekommen. Seine Erkenntnisse erwuchsen also in ihm selbst, durch Beobachtung und Deutung. Wie sollte das Land auch etwas anderes sein als eine ebene Fläche, auf der sich hier und da Berge befanden? So wie es war, erschien es ihm logisch. Ebenso logisch war es, dass der Himmel über dem Land komplett ausgefüllt war. Der Himmel begann am Horizont, und wenn er sich einmal umdrehte, endete der Himmel am anderen Horizont. Und die Sonne ging auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite unter, eben fast immer an der gleichen Stelle. Der Himmel mutete ihm an wie ein Zelt, das er von den Beduinen kannte. Möglicherweise hatte sein Vater ähnliche Gedanken gehabt wie er selbst, als auch er am Lagerfeuer lag, an Abenden seiner langen Handelsreisen. Wie auch immer: Er hatte mit seinem Sohn Aaron nie über den Himmel gesprochen. Zwar brachte er ihm bei, zu zählen und zu rechnen, als dass er Handel betreiben konnte. Eine Weitergabe wissenschaftlicher Gedanken erfolgte aber nicht; nicht zuletzt, weil Sohn und Vater sich alsbald wenig sahen und beide getrennt als Handelsreisende durch die Lande zogen.
Der Vater des Aaron hatte also schon ganz interessante Gedanken entwickelt, was es mit dem Himmel auf sich haben könnte, mit seinem Sohn aber nie darüber gesprochen. Zudem war er selbst auch nicht des Schreibens mächtig, ebenso wenig wie sein Sohn Aaron. So begab es sich, dass der Vater des Aaron seine wissenschaftlichen Gedanken weder an seinen Sohn weiter gegeben noch aufgeschrieben hatte, und somit weder Aaron noch ein anderer Mensch – auf Grundlage schriftlich festgehaltener Erkenntnisse – seine Gedanken hätte fortführen können. Die Geschichte ging also so, dass der Vater des Aaron sein Bild von der Welt hatte, nie mit seinem Sohn darüber sprach und eines Tages verstarb. Aaron entwickelte selbst ebenso ganz interessante Gedanken und Deutungen über die Welt und verstarb aber ebenso, ohne etwas an seine eigenen Kinder weiter zu geben.
Was bedeutet das konkret für unsere Weltbilder? Menschen der Frühgeschichte und des Altertums machten sich – aus Neugier und Forschersinn – Gedanken darüber, was es mit der Welt auf sich haben könnte, entwickelten also ein persönliches Weltbild bzw. eine „Anschauung“ der Welt, und das im ureigentlichsten Sinne. Sie beschauten sich die Welt, wenn sie täglich zur Ruhe kamen; sie führten eine Weltanschauung durch. Ihr Gedankengut versiegte aber gemeinhin, weil sie starben und ihr Wissen nicht vererbten.
Beginnen wir rechnerisch also bei den Anfängen des heutigen Menschen - dem Homo Sapiens vor 200.000 Jahren - und gehen wir davon aus, dass jede Generation 20 Jahre beträgt, so gäbe es ca. 10.000 aufeinanderfolgende Weltbilder pro Stammbaumlinie. Jeder Mensch hatte ein wissenschaftliches Bild von der Welt, mit seinem Versterben versiegte jedoch das Gedankengut, bis der Mensch fähig war, Wissen zu konservieren. Jedes dieser Weltbilder war wohl nicht besonders nah an dem, was wir als Wirklichkeit bezeichnen würden. Aber wer will den Urmenschen schon einen Vorwurf dafür machen. Trotzdem ist es interessant zu mutmaßen, ob einer der bisherigen circa 108 Milliarden Menschen ein interessantes oder sogar bedeutendes Weltbild entwickelt hatte, das vielleicht sogar bahnbrechend war. Selbst wenn die Chance auf ein derart bahnbrechendes Weltbild nur bei 1 zu 108 Milliarden liegen würde, hätte es statistisch wohl einen Menschen gegeben, der ein herausragendes Bild von unserer Welt hatte.
Das Konservieren von Wissen war also ein entscheidender Punkt, dass ein neu geborener Mensch nicht wieder bei Null anfangen musste, weiter zu denken. Denn beim Denken gibt es eine gehörige Einschränkung, über die sich niemand hinwegsetzen kann: Die Länge des Lebens. Die Denkkapazität eines Lebens ist beschränkt. Der Urmensch, der immer wieder neu anfangen musste, zu denken, hatte demnach fast keine Chance, ein modernes, wissenschaftliches Weltbild zu entwickeln. Was ist aber nun die erste vorsätzliche Konservierung von Wissen? Die Antwort liegt wohl in den Begriffen Wort, Bild und Schrift. Mit der Entwicklung von Schrift ergab sich nicht nur eine Veränderung im Zusammenleben der Menschen, sondern auch die Chance auf die Konservierung von Wissen. Der Mensch musste nicht mehr von vorne anfangen zu denken, sondern las gemalte Bilder in Höhlen ab und wusste nun, dass Mammuts beim Pinkeln nicht das Bein heben.
Wenden wir uns wieder Vater und Sohn zu, so hätte Aaron eine viel bessere Grundlage zum Weiterdenken gehabt, wenn ihm sein Vater gesagt hätte, dass die Sonne im Osten auf und im Westen untergeht. Dann hätte sich Aaron mit diesem Thema nicht mehr auseinander setzen müssen. Die Erkenntnis des Vaters hätte Aaron in Form der Sprache vernommen, diese Erkenntnis erst einmal nicht in Frage gestellt und auf dieser Grundlage sein wissenschaftliches Denken fortgesetzt. Und das hätte zur Folge gehabt, dass unser Aaron am Ende seines Lebens wohl einen höheren Wissensstand gehabt hätte und möglicherweise ein besseres Weltbild, weil er mehr Kapazität und Zeit zum Denken über „neue“ Dinge gehabt hätte.
Grob gesprochen geht es bei der Fortentwicklung von Wissen also um zwei Wissensanteile: Das Wissen, was einem aus vorherigen Leben übermittelt worden ist, und die Neuentwicklung von Wissen, in Form eines kreativen Aktes, einer Wissensneuschöpfung.
Für meine Behauptung, wie schlecht die bisherigen Weltbilder seien, lässt sich sagen, dass die Urmenschen und Menschen des Altertums keine besonders gute Chance hatten, ein wissenschaftliches Weltbild zu entwickeln und gemeinsam zu erdenken. Die Weltbilder einzelner Menschen bis zur Neuzeit waren inhaltlich sehr beschränkt und aus heutiger Sicht falsch, was ja auch nicht weiter verwundert.
Mit Entwicklung der Sprache beschleunigte sich das Denken über Welt und Universum, da Wissen durch Sprache vererbt werden konnte. Das Himmelszelt des Aaron wurde also mit Leben gefüllt. Die Kenntnis über die hellen Punkte, die sich am Nachthimmel bewegten, wuchs und wuchs. Bestand hatte aber die Annahme, dass die Erde der fixe Mittelpunkt sei, und sich die Himmelkörper um die Welt bewegen. Mit welcher Genauigkeit beispielsweise die alten Griechen und Ägypter den Sternenlauf beschreiben konnten, ist ja ein großes Wunder. Und was die Griechen in ihrem wissenschaftlichen Glauben bestärkte, war, dass sich Ihre Erkenntnisse und Berechnungen extrem gut für die Navigation in der Schifffahrt und in kargen Wüsten eigneten. Die Erkenntnis darüber, dass sich die Nordrichtung am Nordstern festmachen ließ, und sich die übrigen Sternenbilder um diesen drehen, war verlässlich. Egal wann und wo man segelte, man kam mit der Ausrichtung am Nordstern am gewünschten Ort an. Gepaart mit der Kenntnis über den Sonnenverlauf, der täglich und jährlich einen weiteren Orientierungspunkt bot, klappte die Welt der Seefahrer und Handelsreisenden.
Das Bild von Welt und Universum hatte sich also verändert, die Meinung unseres Aaron war nicht mehr Stand der Technik, sondern die wissenschaftliche Erkenntnis der Griechen und Ägypter. Auf dieser Wissensgrundlage ließen sich auch Landkarten erstellen, und - da man sich beim Segeln tendenziell ohnehin am Land weiterhin orientierte - klappte das Weltbild der Navigation, wie ich es nennen würde, sehr gut. Nichts desto trotz: Vergleicht man das damalige wissenschaftliche Weltbild und unsere heutigen Erkenntnisse, so ist es extrem falsch, mit der Erde als Scheibe und den Himmelskörpern, die sich am Himmelszelt bewegen. Für die damaligen Menschen gab es nicht den geringsten Anlass, an diesem Bild von der Welt zu zweifeln.
Nun war es wiederum der Beobachtungsgabe intelligenter Menschen zu verdanken, vom Bild der Erde als Scheibe abzukehren. Einige Jahrhunderte vor Christus gab es einige Bestrebungen, das komplett falsche Bild von der Welt ein wenig richtiger zu machen. Man kam auf die Idee, dass die Erde rund sei. Und dafür gab es ja auch verschiedene Anhaltspunkte, nämlich, dass Schiffe am Horizont nicht vollständig zu sehen waren, sondern der Bug im Wasser zu versinken schien. Auch war dem Menschen spätestens jetzt bewusst, dass es eine Mondfinsternis gab, und wenn diese auftrat, der Sonnenschatten auf dem Mond auch rund war. Überhaupt war die Idee, dass Himmelskörper und die Erde rund sein könnten, ja ein schöner Gedanke. Die Form eines Kreises mutete schön an, und Menschen mit Schönheitssinn hatten die Hoffnung, dass alles im Himmel und auf Erden schön rund sei. Beeindruckend ist aber, dass bereits zu dieser Zeit einige Gelehrte versuchten, rechnerisch nachzuweisen, dass die Erde rund ist. Es war ein Durchbruch, auf die Idee eines wissenschaftlichen Experiments zu kommen, bei dem - zu einem Zeitpunkt - in zwei verschiedenen Städten der Sonnenstand gemessen wurde. Es wäre jetzt ein wenig langweilig, die Originalversion des Experiments zu zitieren, da ging es nämlich um die ägyptischen Städte Syene und Alexandria. Erklären wir das Experiment, wie man es heute unsererorts erzählen würde.
Es gab also zwei Städte, die gehörig weit auseinander waren. Nehmen wir an, es handelt sich um Manchester und London. Auch wenn diese beiden Städte auf der Landkarte nicht so richtig weit auseinander liegen, könnte man sich ja vorstellen, dass die Manchester-Fans vor ihrem Stadion eine rote Fahne senkrecht in den Boden stecken, und die Anhänger von Arsenal London vor ihrem Stadion wiederum eine blaue. Und wenn nun an einem Sonnentag die Sonne über beiden Stadien scheint, und der Manchester-Fan den Arsenal-Fan anrufen und fragen würde „Hör mal, was wirft denn Eure Fahne gerade für einen Schatten“, dann würde sich ergeben, dass beide Fahnen einen unterschiedlichen Schatten werfen. Nun krankt dieses Beispiel leider schon daran, das im Normalfall ein Manchester-Fan den Anruf eines Arsenal-Fans nicht freiwillig entgegen nehmen würde. Ansonsten könnte man aber abmessen, wie viele Fußballstadien zwischen die beiden Fahnen passen, so ein bisschen mit Winkeln hin und her rechnen und würde grob auf 40.000km für den Erdumfang kommen. Und erstaunlicherweise taten dies die alten Ägypter und kamen auf einen frappierend genauen Wert für den Erdumfang.
Schön und gut, aber was bedeutet das nun für unsere Bewertung von Weltbildern. Der alte Handelsreisende Aaron dachte, die Erde sei eine Scheibe und der Himmel wie ein Zelt. Das war riesig großer Kappes. Die schlauen Griechen und Ägypter kamen nun im 3. Jahrhundert vor Christus zu der richtigen Erkenntnis, dass die Erde rund sei, gingen aber immer noch davon aus, dass die Erde den Mittelpunkt des Universums darstelle: Auch großer Kappes, aber eben nicht ganz so groß wie bei Aaron. Und um es vorweg zu nehmen: Columbus war zu verpeilt, sich mal die Gebrauchsanleitung der alten Ägypter durchzulesen, wie sich die Erde bemisst. Und so segelte er mit dem Verstand eines Geisterfahrers der Abendsonne entgegen.
Die Fortschritte der Wissenschaft in punkto Weltbild waren in der Folgezeit recht stagnierend. Oder wie man es in der Fußballsprache sagen würde: „Never change a running system.“ In diesem running System konnte man wunderbar seefahren, Feldzüge führen und anderen Menschen die Köpfe einschlagen. Zudem ergab es sich, dass die Erkenntnisse über das wissenschaftliche Weltbild mit den Weltreligionen einher gingen. Die Schöpfung und der Lauf der Sterne standen nicht im Widerspruch zu den Weltreligionen. Das wissenschaftlich falsche Weltbild durfte somit auch nicht mehr angezweifelt und verbessert werden.
Das wissenschaftliche und religiöse Weltbild waren eins, und insbesondere in den Religionsbüchern schriftlich manifestiert. Die Entwicklung von 1.500 v.Chr. bis zu Christi Geburt dürfte man als deutlich inhaltsreicher betrachten als die Zeit von Christi Geburt bis Columbus. In geschichtlichen Recherchen herrscht geradezu wissenschaftliches Vakuum zum Thema Weltbild in dieser Zeit, bzw. wurde neuen Gedanken zum Thema Weltbild durch die Institutionen der Religionen massiv entgegen gewirkt. Selbst Wissenschaftler und Denker der Renaissance waren Schwierigkeiten mit der Kirche ausgesetzt. Zwar wird dem 2. Jahrhundert nach Christus die Erfindung des Globus nachgesagt, was aber nach der Erkenntnis, dass die Erde rund sei, doch eher als handwerkliche Umsetzung zu werten ist. Die Religionen nach Christi Geburt wussten, dass die Welt rund ist. Die Annahme, dass es nicht bekannt war, gilt als falsch. Vielmehr hat man versucht, das in den Religionsbüchern vermittelte Wissen aufrecht zu erhalten.
Am liebsten würde ich mich in zeitlich richtiger Reihenfolge jetzt nochmal am Mathematikwunder Christoph Columbus auslassen, der es schaffte, die Berechnungen von Eratosthenes im 3. Jahrhundert vor Christus komplett geistig auszublenden. Denn dieser Eratosthenes verrechnete sich statt der 40.007km Erdumfang wirklich nur um einige Kilometer. Beschaut man sich Superbrain Christoph Columbus, so weiß man gar nicht, ob er sich die Wissenschaft hinreichend beschaut hatte. Aber zum Glück knallte Columbus im Sangria-Rausch ja rechtzeitig gegen Amerika.
Die runde Welt wurde letztendlich wissenschaftlich anerkannt, wenn auch theologisch nur geduldet. Die Philosophen des Altertums genossen ein hohes Ansehen, und wer wollte den Auffassungen eines Aristoteles schon widersprechen?
Phonetisch liegen die Worte Egozentrik und Geozentrik nahe beieinander. Genau betrachtet handelt es sich nur um einen Buchstabendreher, in dem das „E“ und das „G“ vertauscht sind. Ebenso sind sich die Worte aber auch inhaltlich nahe. Denn als man zu der Erkenntnis gelangt war, dass die Erde rund ist, so hätte man ja auch gleich darauf kommen können, dass wir uns mit dem Erdball um andere Himmelskörper drehen, und so der optische Effekt sich bewegender Sterne und Planeten entsteht. Warum kamen wir aber auf die Idee, dass sich alles um die Erde dreht? Die Antwort mag darin liegen, dass wir alle ein wenig Aaron sind. Wir sind alle der Mensch, der durch sein „Ich“ geprägt ist. Aaron lag abends am Lagerfeuer und beschaute sich den Himmel. Er selbst war sich wichtig. Wer sollte schon Zentrum des Universums sein, wenn nicht er selbst. Oder andersrum: Wir Menschen sehen uns naturgemäß im Mittelpunkt. Gefühlt sind wir der Mittelpunkt des Universums, denn unsere Wahrnehmung findet ja in uns statt. Hätten wir unsere Augen auf dem Mond geparkt, so würde unser Sehen ja komplett anders funktionieren. Die Augen würden auf die Erde herab schauen, und der Mensch sich sagen: „Hey, die Erde ist ja nur ein Teil des Ganzen“. Aaron lag aber im Wüstensand. Seine Augen waren nicht auf den Mond entschwunden, sondern Teil seines Hauptes. Er lag da, statisch und geerdet. Und seine Augen folgten vor Müdigkeit dem Lauf der Sonne und der Sterne. Und so erlag Aaron seiner Ichbezogenheit. Ohne sein Ich hätte sich die Sternenwelt nie um ihn gedreht.
Vielleicht hätte sein Vater ihm sagen sollen, dass er nicht der Mittelpunkt der Erde ist. Sein Vater aber sagte ihm, dass er immer zuerst auf sich aufpassen solle auf den weiten Handelsreisen, dass ihm sein Rock näher sein solle als vieles andere, und dass sein eigen Hab und Gut mit das Wichtigste in seinem Leben sei. Und weil Aaron mit dieser Brille durchs Leben schritt, drehte sich alles um ihn selbst, egozentrisch und geozentrisch.
Es bedurfte viel Mathematik und dem Beschauen ohne Ichbezogenheit, dass man zur Erkenntnis gelangte, dass nicht die Erde der Mittelpunkt ist, um den sich alles dreht. Mit dem geozentrischen Weltbild meinte man ja schon alles beantwortet zu haben. Die Erde war keine Scheibe mehr, sondern rund. Und doch zeigte sich auch dieses Weltbild als falsch.
Nun drehte sich alles um die Sonne. Das war ja fast eine Beleidigung für die Erde, auch im religiösen Sinne. Denn dass die Erde nun keine Scheibe sondern eine Kugel war, damit konnte man sich noch gut...
Inhaltsverzeichnis
- Danke
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Paradoxon des Anfangs
- Die Einführung in das „Paradoxon des Anfangs“
- Unser Blick auf die Dinge
- Der Streit zwischen der Wissenschaft und Kreationisten
- Der Beweis, dass es keinen Beweis gibt
- Konstrukte
- Die Abrenzung von das Universum beschreibenden Wörtern und Konstrukten
- Die Betrachtung, wie Nichts und Naturgesetz sprachlich einzuordnen sind
- Nicht nur die Größe ist entscheidend
- Gibt es Energie nur wegen unseres Körpers?
- Körperbewusstsein
- Die größte Täuschung unseres Lebens
- Verankert
- Der Hinweis auf die Initiierung des Universums
- Die Abkehr vom Ursache-Folge-Denken
- Die Systembeschränkung
- Die mögliche Datenfernübertragung
- Die Varianz
- Die Gleichmäßigkeit des Universums
- Das Wesen eines Gesetzes und dessen Wichtigkeit für das „Paradoxon des Anfangs“
- Das mögliche Ergebnis, welches Bild wir uns vom Universum somit machen können?
- Wie sich die Liebe an das Göttliche begründet
- Die gesellschaftliche Sicht auf die Wirklichkeit
- Wer die Frage um den Anfang des Universums beantworten wird
- Eine Annahme, warum das Fermi-Paradoxon gar nicht paradox ist
- Das Wesen der Mathematik
- Die Erklärung, warum es keine Unendlichkeit gibt
- Die Theorie, was Dunkle Materie und Dunkle Energie ist
- Warum das Göttliche und die Schöpfung des Universums womöglich getrennt zu betrachten sind
- Die Deutung des Universums aufgrund demografischer Umstände
- Die Definiton, was Kunst ist
- Der freie Wille
- Schlusswort und die Widerlegung Krauss‘ Aussagen mindestens in einem Punkt
- Grobe Inhalte der Gedanken Matthew Widgets (Romanfigur aus „Das kleinste Teilchen ist ein Universum“)
- Der Aufbau des Zuckerwürfel-Experiments
- Das Zuckewürfelexperiment im Kleinen: Wie jeder Urmensch es hätte durchführen können
- Von Aaron und den falschen Weltbildern
- Der Quark mit den Quarks
- Viel Leben
- Impressum