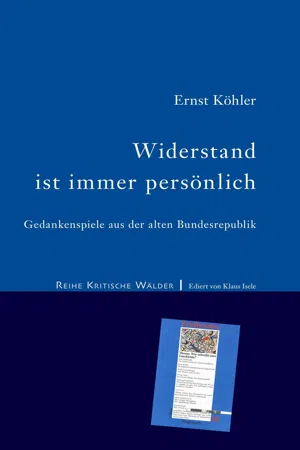![]()
Die langsame Verspießerung der Zeitgeschichte
Martin Broszat und der Widerstand
1.
Der »Historikerstreit« liegt bereits in Buchform vor. Wer zur schweigenden Mehrheit der Polemiker gehört und immer alles sofort aus den frischen Zeitungen herausgerissen hatte, empfindet darüber vielleicht ein gewisses Befremden. Es ist auch etwas ungerecht. Andererseits scheint es jetzt wieder leichter, einen liberalen Historiker anzugreifen, ohne ihm gleich in den Rücken zu fallen. Sie verstehen: Er kämpft mit Bravour gegen die viri obscuri von der Rechten, und ich, anstatt ihm zur Seite zu springen, ich kritisiere ihn in dieser Situation auch noch von hinten. Ich möchte diesen Moment der Kampfesstille, der möglicherweise nur eine Atempause ist, nutzen. Ich möchte hier einen Historiker angreifen, der sich den Traditionen der Aufklärung und des Antifaschismus verpflichtet fühlt und der mit der moralischen Aufrüstung unseres Geschichtsbewusstseins nichts zu schaffen haben möchte. Ich erlaube mir, Sie zu bitten, für einen Augenblick so zu tun, als hätten die Gegenaufklärer den Streit schon verloren – und als setzten sie nicht in Wirklichkeit triumphierend zu neuen Vorstößen an. Das gäbe uns den Spielraum und die innere Ruhe für eine Auseinandersetzung mit den Aufklärern – für mich immer noch das weitaus wichtigere und interessantere Thema in diesem Zusammenhang.
Die Rede soll hier von Martin Broszat sein. Seine jetzt, zu seinem sechzigsten Geburtstag gesammelt vorgelegten Aufsätze zur deutschen Zeitgeschichte1 dokumentieren das kritische, aufklärerische Selbstverständnis und Engagement dieser Disziplin und dieses Autors – auch sprachlich in diesem Fall: die Differenziertheit ist der Umgangssprache abgewonnen. Martin Broszat gehört, wie etwa auch Hans-Günther Zmarzlik oder Thomas Nipperdey, zu den eher seltenen und übrigens meist schon älteren Historikern, die zivil zu schreiben verstehen. Ich muss unwillkürlich an Alfred Andersch denken: Vielleicht ist es die persönliche Erfahrung des Krieges, die diese Autoren unempfänglich für die dann einsetzende und rasch eskalierende Folge der Arriviertheiten gemacht hat.
Etwas ältere Leser – jene, die etwa um 1960 herum ihr Studium begonnen haben – können bei dieser Lektüre ihre eigenen Lernschritte rekonstruieren – vielleicht, man verzeihe mir die schnöde Bemerkung, durch die eigentümlich dicke biografische Nebelwand der 68-Erfahrung hindurch: die Distanzierung von der nationalistisch-antidemokratischen, aber auch von der historischen Tradition der deutschen Geschichtswissenschaft, das wachsende Interesse für die Beiträge der liberalen Politologie, die schrittweise Aneignung auch struktur- und sozialgeschichtlicher Fragestellungen. Aber wir werden hier auch an Grenzen erinnert, die wir bis heute kaum überschritten haben. Man lese etwa den Essay über den »›Holocaust‹ und die Geschichtswissenschaften« von 1979:2 »In der Bundesrepublik ist die Darstellung der jüdischen Geschichte in der NS-Zeit, jüdischer Erlebnisse und Schicksale, mit Ausnahme einiger bemerkenswerter vor allem lokal-und landesgeschichtlicher Dokumentationen, bisher weitgehend unterblieben bzw. dem New Yorker Leo Baeck-Institute überlassen worden. Die einschlägige deutsche Zeitgeschichtsschreibung, auch die Bild- und Filmdokumentationen, stellte in aller Regel nicht die jüdische Erlebnis- und Verhaltensgeschichte, sondern fast ausschließlich die deutsche Aktionsgeschichte der Judenverfolgung in den Mittelpunkt. Basierend vor allem auf amtlichen deutschen Quellen aus der NS-Zeit, blieb die Verfolger-Perspektive dieser Quellengrundlage auch für die Darstellung des Themas weitgehend maßgeblich. Die jüdischen Opfer kommen meist nur schemenhaft vor, als Objekte der Verfolgung. Nicht Geschichte des Holocaust, sondern der ›Endlösung‹ wurde geschrieben, auch in den Schulbüchern.«3 Das sitzt, das trifft einen. Das ist Martin Broszat, oder das ist er auch, und ich hoffe, dass ich über der Polemik, die ich mir hier vornehme, diese Leistung und dieses Format nicht aus den Augen verliere.
2.
Meine Kritik gilt den Überlegungen zum Widerstand gegen das NS-Regime, wie sie Martin Broszat in den letzten Jahren mehrfach vorgetragen hat, und zwar mit zunehmender Streitbarkeit. Sie stellen in meinen Augen eine Provokation dar, unvergleichlich schärfer und irritierender als alles, was etwa ein Ernst Nolte oder ein Michael Stürmer je in die Debatte geworfen haben. Aber sie scheint irgendwie abgefangen, abgedämpft worden zu sein. Martin Broszat ist aber, so meine These, ein Aufklärer, der zurzeit Gegenaufklärung betreibt. Er ist ein Alltagshistoriker, der die ursprünglichen Intentionen dieses Forschungsansatzes zunehmend verdreht und verfälscht, und das nun scheint etwas zu sein, was weder die Anhänger noch die Kritiker dieses Zweiges der Geschichtswissenschaft aus der Reserve zu locken vermöchte. »Die mit dem Rahmenbegriff ›Konflikt‹ gesetzte Perspektive des Projektes führte auch zu einem spezifisch wirkungsgeschichtlichen Aspekt des Widerstandes. Zu seiner Kennzeichnung ist schon im Vorwort zum ersten Buch der Reihe4 hypothetisch der aus der medizinischen Terminologie stammende Begriff der ›Resistenz‹ verwandt worden. Die Ergebnisse der seitdem erarbeiteten und nunmehr vorliegenden Einzelstudien bestätigen, so scheint es uns, dass sich diese Hypothese bewährt hat. ›Resistenz‹ im Sinne dieser Begriffsbildung bedeutet ganz allgemein: wirksame Abwehr, Begrenzung, Eindämmung der NS-Herrschaft oder ihres Anspruches, gleichgültig von welchen Motiven, Gründen und Kräften her. Solche ›Resistenz‹ konnte begründet sein in der Fortexistenz relativ unabhängiger Institutionen (Kirchen, Bürokratie, Wehrmacht), der Geltendmachung dem NS widerstrebender sittlich-religiöser Normen, institutioneller und wirtschaftlicher Interessen oder rechtlicher, geistiger, künstlerischer u. a. Maßstäbe; wirksame Resistenz konnte Ausdruck finden in aktivem Gegenhandeln von Einzelnen oder Gruppen (dem verbotenen Streik in einem Betrieb, der Kritik an nationalsozialistischen Maßnahmen von der Kanzel herab), in zivilem Ungehorsam (Nichtteilnahme an NS-Versammlungen, Verweigerung des Hitler-Grußes, Nichtbeachtung des Verbotes des Umgangs mit Juden, Kriegsgefangenen o. a.), der Aufrechterhaltung von Gesinnungsgemeinschaften außerhalb der gleichgeschalteten NS-Organisationen (…) oder auch in der bloß inneren Bewahrung dem NS widerstrebender Grundsätze und der dadurch bedingten Immunität gegenüber nationalsozialistischer Ideologie und Propaganda (Ablehnung von Antisemitismus und Rassenideologie, Pazifismus o. a.). Voraussetzung dafür, dass diese unterschiedlichen Formen der Einstellung oder des Reagierens den wirkungsgeschichtlichen Begriff der Resistenz erfüllen, ist einzig und allein, dass sie tatsächlich eine die NS-Herrschaft und NS-Ideologie einschränkende Wirkung hatten. (…) Der Resistenz-Begriff kontrastiert damit deutlich mit denjenigen Tendenzen der Widerstandsforschung, die – unter weitgehender Ausklammerung der tatsächlichen Wirkung des Widerstandes – sich primär auf die Motivations- und Aktionsgeschichte des Widerstandes konzentrieren. (…) In jedem politisch-gesellschaftlichen System, noch mehr unter einer politischen Herrschaft wie der des NS, zählt politisch und historisch vor allem, was getan und was bewirkt, weniger das, was nur gewollt oder beabsichtigt war. Das historische Scheitern des aktiven deutschen Widerstandes im Dritten Reich entlastet nicht von dieser Bemessung, sondern fordert sie immer wieder heraus. Wenn – gerade auch durch die hier vorgelegten Untersuchungen – erneut deutlich wird, dass der aktive, fundamentale Widerstand gegen das NS-Regime fast überall vergeblich geblieben, dagegen wirkungsvolle Resistenz in den verschiedenen politisch-gesellschaftlichen Sektoren der deutschen Bevölkerung vielfältig zu registrieren ist, so scheint uns dies ein Befund, der allein schon zum Nachdenken über die Prämissen des Widerstandsbegriffs veranlasst.
Soll und kann sich, so ist zu fragen, das Vermächtnis des Widerstandes nur beziehen auf das vergebliche Märtyrertum von Personen und Kräften, die aktiven, illegalen Widerstand gegen das Regime trotz von vornherein äußerst geringer Erfolgschancen dennoch versuchten? Ist es nicht ebenso tragisch, dass die vielen ›kleinen‹ Ansatzpunkte zu realistischer Teil-Opposition und Resistenz, die sich in den verschiedenen Entwicklungsstadien und Politikbereichen der NS-Herrschaft immer wieder boten, so wenig genutzt wurden?«5
Das Problem mit diesen Ausführungen ist zunächst einmal, dass sie offenkundig mit mehreren und ganz verschiedenen Begriffen von Wirkung operieren – aber so, als sei es nur einer. Denn was sollte jene »innere Bewahrung« getan und bewirkt haben? Es berührt einen etwas peinlich; kann es denn überhaupt etwas Irrelevanteres, Wirkungsloseres geben als jene innere Emigration, wie man es bislang – und mit mehr Recht – nannte? Andererseits charakterisiert Broszat wenige Zeilen weiter den Widerstand der Kommunisten und anderer als wirkungsgeschichtlich irrelevant. Man begreift, den Kampf gegen den Nationalsozialismus kann Broszat als wirkungslos bezeichnen, weil er ihn an seinen Zielen misst. Das Ziel war der Sturz oder die Schwächung der Hitlerdiktatur. Die Flucht ins Innenleben kann Broszat hingegen als relativ wirkungsvoll einstufen, weil er sie mit den illusionär übersteigerten Herrschaftsambitionen der Nationalsozialisten konfrontiert. Es wird hier mit zweierlei Maß gemessen, aber eben so, als sei es nur eines; denn jene geistige »Immunität«, die hier auch noch der stillsten reservatio mentalis die Qualifizierung als realer Faktor einbringt, besaßen ja beispielsweise die Kommunisten schon lange. Man fühlt sich hier von fern an das Bibelwort von den 99 Gerechten gemahnt. Weil diese Kommunisten aber darüber hinaus etwas wollten und auch zu handeln versuchten, wären sie kein realer Faktor gewesen? Wer gescheitert ist, hatte faktisch kein Gewicht – bitte, das ist zwar hart formuliert, aber das kann man akzeptieren. Aber wer gar nicht scheitern konnte – denn wie hätte jemand, der sich auf sich selbst zurückzog, scheitern können? – , der hätte Gewicht gehabt?
Ich greife ein weiteres Moment aus dem breiten Spektrum der Resistenz heraus. War die Reichswehr eine »relativ unabhängige Institution«? Raul Hilberg hat in seinem Standardwerk über Die Vernichtung der europäischen Juden6 im Detail nachgewiesen, dass die deutsche Armee systematisch und grenzenlos kollaboriert hat. »In Begleitung der vorrückenden Heeresgruppen befanden sich kleine, motorisierte Tötungskommandos der SS und Polizei, die tatsächlich den Militärbefehlshabern unterstanden, ansonsten jedoch bei der Erledigung ihres Sonderauftrags freie Hand hatten. Aufgrund besonderer Absprachen operierten diese mobilen Tötungseinheiten im Frontgebiet in einzigartiger Partnerschaft mit der Wehrmacht. Um zu verstehen, wie es zu dieser Partnerschaft kam, ist es erforderlich, sich die beiden Partner näher anzusehen: die deutsche Wehrmacht und das Reichssicherheitshauptamt der SS und Polizei.
Die Wehrmacht bildete eine der vier unabhängigen Hierarchien der Vernichtungsmaschinerie. Anders als Partei, Verwaltungsapparat und Wirtschaft spielte sie in der Vorbereitungsphase des Vernichtungsprozesses keine maßgebliche Rolle; doch der Fortgang dieses Prozesses verstrickte jedes Segment des deutschen Gesellschaftsgefüges unerbittlich in das Vernichtungswerk. Wir erinnern uns, dass sich die Wehrmacht bereits 1933 an einer Definition der ›Juden‹ interessiert zeigte.«7
Man darf Martin Broszat nicht unterstellen, dass er diese Realitäten bestreiten möchte. Auch nicht, dass er hier die seit langem bekannte und begriffene funktionale Polyzentrik der Macht im Dritten Reich etwa mit einer – wie immer unterdrückten, reduzierten – Pluralität der politischen Kräfte, sozusagen mit einer verkrüppelten Variante von »Limited Government«, mit einem rudimentären System der »checks and balances« verwechselt. Broszat hat ja selbst ein wichtiges und bis heute kaum übertroffenes Werk über die »innere Verfassung« des NS-Regimes geschrieben und dort herausgearbeitet, dass die dann besonders für die Kriegsphase typische permanente Verdopplung und Vervielfältigung der Entscheidungsinstanzen die imperialistische und rassistische Dynamik des Regimes gerade freigesetzt und keineswegs abgebremst hat.8 Was aber soll dann die Formulierung von der »relativen Unabhängigkeit« der Armee, der Bürokratie bedeuten? Dass die Nationalsozialisten in einem komplex strukturierten Umfeld, in einer modernen Klassengesellschaft agieren mussten? Dass sie sich gegen traditionelle Eliten und konkurrierende Machtapparate durchsetzen mussten? Aber ist das nicht eine Trivialität? Es scheint, dass Broszat mit seiner geheimnisvollen »Resistenz« aus dieser Trivialität eine irgendwie »höhere« oder »tiefere« Wirklichkeit, so etwas wie eine ontologische Dimension herausschlagen möchte. Was bedeutet schon die Tatsache, dass auch die Nazis sich durchsetzen mussten, gegenüber der Tatsache, dass sie sich durchgesetzt haben? Das eigentlich Charakteristische am Dritten Reich ist die erschreckende Reibungslosigkeit, Widerstandslosigkeit, mit der die Staatsapparate im engeren Sinn des Wortes sich haben gleichschalten und instrumentalisieren und sogar politisch gewinnen lassen. Was könnte Alltagsgeschichte, eine Alltagsgeschichte beliebiger Art an diesem Gesamtbild ändern?
Es hat im ganzen Dritten Reich nur einen einzigen, einsamen Fall von Massenresistenz im Sinne Broszats gegeben: den Protest gegen die Ermordung der Geisteskranken. Man fragt sich, wie lange die bundesdeutsche Geschichtswissenschaft noch von der Korrektur eines längst korrigierten Zerrbildes leben will. Dass das NS-Regime die Deutschen nicht in eine uniforme, haltlose, fanatisierte Masse verwandelt hat, ist seit langem eine Binsenweisheit. Aber diese Grenze der ideologischen Hegemonie war keine Grenze der politischen Macht. Eher könnte man umgekehrt argumentieren, die politische Stabilität des Regimes sei nicht zuletzt dem Scheitern seiner »totalitären« Intentionen zu verdanken gewesen; aber Überlegungen dieser Art sucht man jedenfalls in der bundesdeutschen Alltagsgeschichte vergebens.
Was die »Sozialgeschichte des politischen Verhaltens« da jetzt im einzelnen über die vielfältige und veränderliche Verbindung von Konsens und Dissens, von Indifferenz und Begeisterung usw. herausfindet, zeigt nur, wie diese Herrschaft wirklich funktioniert hat. Nur von einem ganz wirklichkeitsfernen Konstrukt, von einem ins Utopische getriebenen Idealtypus »totaler« Herrschaft her betrachtet, waren all diese Formen des partiellen und prinzipienlosen Nonkonformismus, die sich fast immer in irgendeinen großen Konformismus – den der »Volksgemeinschaft« oder den der »Ordnung« oder den der »Nation« oder sogar den des »Kampfes ums Dasein« – einfügen, eine Grenze der Macht.
Mit dem Pogrom von 1938 sind die Nazis auf breite Ablehnung, ja, auf Abscheu gestoßen – nicht aber mit den Nürnberger Gesetzen vorher und auch nicht mit den lautlosen, routinemäßig ablaufenden Deportationen später. Die Deutschen hatten also etwas gegen Pogrome, aber nichts oder wenig gegen gesetzlich-reguläre Ausgrenzung und gegen bürokratisch organisierte Verschleppung. Die Feinheiten dieser Haltung – das je spezifische Mischungsverhältnis von latentem Rassismus, law and order-Mentalität, Gleichgültigkeit, Verdrängung und Angst – interessiert hier nicht. Es zählt nur, was – mit Broszat – »getan« und was »bewirkt« wurde. Es wäre ein Hohn, wollte man die Unmutsäußerungen von 1938 als »Resistenz« im Sinne wirksamer Machtbeschränkung werten. Das Regime hat die Situation getestet und daraus gelernt. Es hat auf ein Stück Populismus verzichtet oder verzichten müssen. Es hat realisiert, dass die Deutschen keine hasserfüllten und militanten Antisemiten waren, und seine Vernichtungspolitik dann auf kaltem Wege und im Halbdunkel durchgeführt. Und welcher Pogrom hätte so effizient sein können? Ist es so falsch zu sagen, die Deutschen hätten mit ihrem Widerwillen gegen Unordnung und Gewalt auf der Straße das Regime nur ein bisschen schneller zu sich selbst gebracht? Auch die Deportationen setzten dann übrigens wieder mit »sondierenden«, eher tastenden Maßnahmen ein, wie Hannah Arendt in ihrem Eichmann-Buch gezeigt hat.9 Diesmal ist der Test befriedigend ausgefallen.
3.
Aber das eigentlich Fragwürdige an den Thesen Martin Broszats liegt gar nicht in diesem Mangel an politischer Urteilsfähigkeit. Die Verwechslung der schlichten Konkretisierung und Differenzierung unseres Bildes vom Dritten Reich, wie sie die Alltagsgeschichte leistet, mit der Kreierung eines grundsätzlich neuen Bildes oder »Paradigmas« ließe sich noch auf eine Befangenheit, auf eine gewisse Distanzlosigkeit des Forschers gegenüber den eigenen Ansätzen und Ergebnissen schieben. Aber Broszat geht viel weiter. Er versucht, die »Resistenz« gegen den Widerstand auszuspielen. Es geht hier schon gar nicht mehr darum, neben dem Widerstand im üblichen Sinn des Wortes auch anderen Formen oppositionellen oder auch nur abweichenden Verhaltens gerecht zu werden. Es geht vielmehr um eine Veränderung der Maßstäbe, um eine Umwertung: um die politische und moralische Aufwertung der »Resistenz« gegenüber dem Widerstand und um die politische und moralische Problematisierung des Widerstandes gegenüber der »Resistenz«. Es ist, als ob der alte nüchterne, selbstkritische Gedanke, wir Heutigen hätten kein Recht, uns zum Richter über die Masse der Ze...