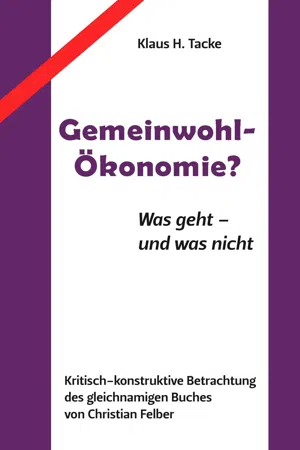![]()
Wenn man tatsächlich so weit gehen will, das Eigentum und das Einkommens-Volumen zu begrenzen, dann ist das dermaßen tiefgreifend, dass man auf eine Reihe von zusätzlichen Restriktionen, die in der Gemeinwohl-Ökonomie vorgesehen sind, nicht mehr benötigt, weil sie sich von selbst ergeben.
Es sollte festgestellt werden, dass nicht das Eigentum selbst das Problem ist, sondern die damit verbundene Möglichkeit zur Machtausübung. Das sollte man berücksichtigen, wenn man eine Begrenzung des privaten Eigentums fordert. Rein technisch dürfte es viel Zeit benötigen, um eine derartig fundamentale Maßnahme politisch durchsetzen zu können. Es wäre deshalb angebracht, nach anderen Methoden Ausschau zu halten, mit denen man, wenn schon nicht das Eigentum, so doch wenigstens in einer ersten wichtigen Stufe die Machtanhäufung und den eigentumsbedingten Machtmissbrauch reduzieren kann. Es ist auch durchaus möglich, in demokratischen Staaten große Einkommensunterschiede zu haben und trotzdem zufriedene Bürger, wie das Beispiel der skandinavischen Länder zeigt. Wenn es zum Verständnis der Gesellschaft geworden ist, dass man seinen Reichtum nicht zeigt, wirkt er nicht mehr provozierend.
Bankern oder Spekulanten, die nur noch das x- Fache des gesetzlichen Mindestlohnes verdienen dürfen, braucht man die Spekulation nicht mehr zu verbieten, sondern braucht nur noch die Haftungsbedingungen zu verstärken durch eine andere Eigenkapitalbasis. Die meisten Spekulanten würden das Interesse verlieren, wenn sie mit ihrem Eigentum für eventuelle Verluste haften müssten.
Die Spekulation als klassische Funktion muss jedoch erhalten bleiben. Es liegt zum Beispiel seit Jahrhunderten im vitalen Interesse der Landwirtschaft, dass die Bauern, die eher nicht zu Spekulationen neigen, bei der Aussaat im Frühjahr wissen, welchen Preis sie für ihre Produkte nach der Ernte im Herbst erhalten können. Für sie ist es eine Frage der Existenzsicherheit, dass jemand sich bereit erklärt, die Ware auf Termin zu einem festen Preis zu kaufen, ohne zu wissen, wie sich der Marktpreis bis zur Verfügbarkeit der Ware im Herbst entwickelt. Der Spekulant übernimmt das Risiko und nutzt die Zeit bis zum Herbst, um bei den sich täglich ändernden Zukunftserwartungen (z. B. durch anhaltend ungünstiges Klima oder überdurchschnittliche Ernteerwartung) an den unterschiedlichen Einschätzungen anderer Spekulanten zu verdienen, indem er den Kaufvertrag während der Laufzeit weiterverkaufen kann. Der Preis kann fallen oder in riesige Höhen steigen, am Verkaufsstichtag im Herbst muss derjenige, der den Vertrag in Händen hält, die Ware von dem Bauern physisch übernehmen und dem Bauern den im Frühjahr festgelegten Verkaufspreis zahlen. Es ist also nicht so, dass ein Spekulant die Rohstoffpreise verteuert, sondern der Preis passt sich während der Laufzeit eines Vertrages den täglichen Informationen und Einschätzungen an und spiegelt damit die jeweils aktuelle Marktsituation wider. Bei steigenden Preisen wird also nicht die Ware teurer, sondern das Papier, auf welchem bestätigt ist, dass man eine bestimmte Ware zu einem fixierten Termin und zu einem bestimmten Preis dafür erhält. Der Vertrag selbst, der jeder Spekulation zugrunde liegt, wird jedoch am Ende der Laufzeit zu dem am Anfang des Vertrages vereinbarten Konditionen ausgeführt.
Anders die Spekulation im Finanzsektor, bei welchem Fremdkapital unter Ausnutzung diverser Hebel eingesetzt wird, um auf Kurs- oder Preisänderungen zu setzen. Die Chancen in diesem Bereich bei Spekulationen auf die Zukunft sind rechnerisch exakt bei 50%, weil theoretisch zu jedem Zeitpunkt alle Analysten der Welt über alle Informationen verfügen, sie aber unterschiedlich interpretieren. Der entsprechende Tageskurs reflektiert die Summe aller Einschätzungen bestimmter Einflussfaktoren. Die Einschätzung kann sich am nächsten Tag schon ändern, da neue Infos zu neuer Einschätzung führen. Das kann gleichermaßen die Preise nach oben oder unten führen. Durch die ungemein starken Hebel, die dabei eingesetzt werden können, multiplizieren sich die Summen, die man verlieren oder gewinnen kann.
Wenn eine Bank gewinnt, behält sie das Geld. Verliert sie, rechnet sie damit, dass die Politiker sie schon retten werden – mit dem Steuergeld der Bürger. Der wichtigste Punkt und der Grund allen Übels ist die Tatsache, dass Risiko und Haftung auseinander fallen. Niemand übernimmt gerne Risiko, wenn er selber für das Ergebnis haften muss, weil es dem Eigennutz schaden könnte. Bei eigenem Haftungsrisiko werden folglich die unvorsichtigen Handlungen nicht mehr durchgeführt. Diese ganz einfache Reaktion sollte zur Selbstverständlichkeit werden in allen Fällen, wo jemand das Geld Dritter zu verwalten und auszugeben hat.
Der Aufkauf und die feindliche Übernahme von Unternehmen reduziert sich in dem Augenblick next to zero, in welchem die Manager ihre persönliche Situation abhängig machen müssen von Erfolg oder Misserfolg der Übernahme. In der Gemeinwohl-Ökonomie nehmen begrenzte Einkommensvolumen ihm weiterhin das Interesse, weil er in der Regel sein Vermögen nicht mehr vergrößern kann. Es kann ihm lediglich einen Prestigezuwachs bringen. In einer Wirtschaftswelt, in der jedoch andere, gesellschaftlich wichtigere Werte gelten, wird er damit nicht die erwünschte Anerkennung durch die Gesellschaft erfahren können, und damit reduziert sich die dadurch hervorgerufene Motivation ebenfalls ins Bedeutungslose.
Unabhängig davon, in welchem Stadium sich die Entwicklung der Gemeinwohl-Ökonomie befindet, ist es unbedingt erforderlich, einen Weg zu finden, die Fremdunternehmer, die ein Unternehmen managen, sich aber nur am Gewinn, nicht aber am Verlust der Firma beteiligen wollen, mehr in die Pflicht zu nehmen. Ansatzpunkte dazu habe ich vorgeschlagen bei meiner Analyse der aktuellen Problemfelder des Gemeinwohls (Tacke, 146 f.).
Bei einer generell vorgesehenen Einkommensbeschränkung ist es grundsätzlich egal, aus welcher Quelle das Einkommen stammt, welches jeder bis zu dem vereinbarten Maximum einnimmt. Es zu limitieren auf eine einzige Einkommensart, nämlich Arbeit, setzt voraus, dass jeder seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen kann, weil er sonst auf staatliche Unterstützung angewiesen ist.
Das limitiert zum Beispiel die Möglichkeiten von Personen, die am Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Ausbildung oder sonstiger Handicaps nur begrenzte Möglichkeiten haben, ein Leben frei von staatlicher Unterstützung zu führen. Diesen würde es sehr viel helfen, ihre Würde zu bewahren, wenn sie für ein eventuell vorhandenes – entsprechend dem Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie – kleines Vermögen jährliche Zinsen erhalten könnten. Niemand kann bei begrenztem Einkommens- und Vermögensvolumen große gemeinschaftsschädigende Aktionen unternehmen. Also warum soll man den Zins als Einnahmeart verbieten. Zinsen sind Einkünfte, die jederzeit kontrolliert und an der Quelle besteuert werden können. Eine derartige Einkommens-Möglichkeit würde die Philosophie und Effizienz eines Gemeinwohl-Ökonomie-Systems in keiner Weise beeinträchtigen.
Die Argumentation von Felber (73 ff.) zielt darauf ab, dass bei Zinszahlung 90% der Bevölkerung dadurch einen Verlust realisiert, weil die Kreditzinsen in den Produktpreis eingerechnet werden müssen und somit das Produkt verteuern. Ökonomisch gesehen ist das eine sehr einseitige Betrachtung, denn Zinsen sind immer auch Einkommen.
Nehmen wir das Prinzip des Marktes und untersuchen, was wirklich passiert: Ein Unternehmer ist teurer in seinen Produkten als die Konkurrenz. Mit einer bestimmten Maschine könnte er die Kosten entscheidend senken. Er geht zur Bank und leiht sich Geld. Die Bank berechnet ihm einen Betrag X als Kreditkosten, und er stellt fest, dass die Kalkulation klappt. Die Kunden bestätigen das, indem sie jetzt sein Produkt vorziehen. Trotz der Bankkosten haben sie einen Vorteil. Sie realisieren keinen Verlust, sondern haben beim Kauf Geld übrig gegenüber der früheren Situation. Gäbe es überhaupt keine Kreditkosten, könnte entweder der Verkaufspreis noch weiter reduziert werden, oder der Unternehmer hätte eine größere Marge für sich, oder er bezahlt den Mitarbeitern davon eine Prämie – alles, obwohl der Sparer mit seiner Einlage in der Bank die Maschine finanziert hat. Er hat am Produktionsprozess teilgenommen und sollte auch entsprechend prämiert werden, und zwar nicht nur durch das hehre Gefühl, sich mit der Spareinlage gemeinwohlfördernd verhalten zu haben – ähnliches sollte man nämlich gleichermaßen von den Konsumenten und dem Produzenten erwarten. Der Sparer ist schließlich auch Teil des Gemeinwohls. Wenn die Bank als Kreditzins z. B. 3% Sparzins einrechnen würde, würde darunter das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie in keiner Weise leiden, zumal in diversen Untersuchungen festgestellt wurde, dass ein Kreditzins auf angemessenem Niveau bei Investitionsüberlegungen eine untergeordnete Rolle spielt. Anders war die Situation Anfang der 1970er Jahre, als die Kreditzinsen ein Niveau von 13–15% p. a. erreicht hatten.
Zinsen zu verbieten ist wenig sinnvoll. Man kann einem Investor nicht zumuten, in ein Gemeinwohl-Ökonomie-Unternehmen zu investieren und damit ohne Ausgleichsmöglichkeiten Risiken zu akzeptieren. Zins ist eine Prämie für das Risiko, welches auch bei Unternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie nicht ausgeschlossen werden kann. Zins ist weiter ein – wenn auch schwaches – Mittel, dem Staat die Schuldenaufnahme zu erschweren. Das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie wird durch ein Zinsverbot wesentlich erschwert. Zinsen nutzen mehr als sie schaden. Wer nur über ein begrenztes Einkommen verfügt, wird durch Zinsen nicht gefährlich reich und nicht einflussreich werden können.
Felber (74 f.) stellt weiter fest, dass Kapitaleinkommen Wachstumszwang auslöse, weil Kreditnehmer mehr Geld zurückbezahlen, als sie geborgt haben. Ebenfalls wird unterstellt, dass durch Zinsen das Geldvermögen wächst.
Es ist nicht schlüssig festzustellen, dass das volkswirtschaftliche Geldvermögen durch die Zinsen wächst. Es sind andere Faktoren, die das Geldvermögen wachsen lassen. Man denke nur daran, dass die Banken nicht nur das Geld der Sparer verleihen, sondern basierend auf den Spareinlagen die Möglichkeit haben, zusätzlichen Kredit zu schaffen. Die Höhe dieser Möglichkeit wird durch die Zentralbank reguliert. Nehmen wir wieder den klassischen Fall und verzichten zur Vereinfachung auf die Bankkosten, so geht der Unternehmer mit seiner Idee zur Bank, die leiht ihm das Geld des Sparers und kassiert dafür einen Kreditzins. Den leitet sie weiter an den Sparer. Der Käufer ist dadurch um die Summe ärmer, die der Produzent der Bank bezahlen muss. Um die gleiche Summe hat sich aber die Kaufkraft des Sparers erhöht. Ein absolut neutraler Vorgang, der mit Wachstum nichts zu tun hat. Wenn der Unternehmer Glück hat, ist er derjenige, der mit seiner Idee weiteres Wachstum anregen kann.
Wenn durch das Zinsgeschäft das Geldvermögen nicht vergrößert, sondern nur umverteilt wird, bleiben Folgerungen aus dieser nicht zutreffenden Unterstellung ebenfalls wirkungslos. Nicht durch den Zins wächst das Geldvermögen, sondern durch zusätzliche Finanz-Maßnahmen, die mehr oder weniger präzise gesteuert werden können durch die Zentralbanken. Es ist nicht sinnvoll, auf derartigen Annahmen ein Wirtschaftsgebäude zu bauen, auf welchem eine neue Gemeinwohl-Ökonomie ihre Existenz finden soll. Da muss Christian Felber noch einmal nacharbeiten. Dazu gehören auch Überlegungen und Erklärungen, die mit den Konsequenzen einer sinkenden und steigenden Sparquote verbunden sind. Wenn Unternehmer viele Ideen haben und die Nachfrage groß ist, sind sie bereit, einen höheren Kreditzins zu bezahlen. Bekommen die Sparer einen höheren Zins, sparen sie gerne mehr. Dadurch geben sie aber weniger Geld für Konsumzwecke aus. Kaufen sie deshalb weniger, sind die Unternehmer logischerweise enttäuscht und investieren weniger. Wenn weniger Kredit nachgefragt wird, muss die Bank die Kreditzinsen senken und kann dem Sparer nur geringere Zinsen zahlen. Alles, was Einfluss nehmen kann auf die Veränderung der Geldmenge, und damit des Geldvermögens, wird von außen bestimmt. Die Zinsen und das Kapitaleinkommen verantwortlich zu machen für die Tragfähigkeitsgrenze der Erde ist nicht nur eine schlichte, sondern auch unzutreffende Darstellung. Was Kapitaleinkommen machen kann oder darf, hängt im Wesentlichen davon ab, was die Gesellschaft als Ganzes akzeptiert und wo sie Grenzen gesetzt haben möchte. Diese Entscheidungsmöglichkeiten, und folglich die damit verbundene Macht, ist das erste, was man dem Bürger zurückerobern muss, wenn man wirklich will, dass der Staat nach dem Willen des Volkes geführt wird.
Gleichermaßen würde sich erübrigen, die Verwendung von Gewinnen als Dividende zu verbieten (Felber, 50 ff.). Die meisten Dividenden würden wie vorgesehen an die Mitarbeiter fließen, die bei größeren Firmen sukzessive zu Miteigentümern würden. Alle – vom Chef bis zum Lehrling – leben in einer Gemeinwohl-Ökonomie unter der Maßregel der Einkommenslimitierung. Die Dividende, die der Chef erhält, wird ihm wahrscheinlich nicht viel geben, falls er mit seinem Arbeitseinkommen das gesetzte Limit schon erreicht hat. Den Mitarbeitern aber wäre es eine Prämie und Anerkennung ihrer eigenen Leistung. Warum sollte man dem Team diesen „Dank“ für eine gute Gemeinschaftsleistung nicht zuerkennen? Auch die Angst, dass Dividenden auch an nicht mitarbeitende Eigentümer gezahlt würden, sollte kein Grund zur Sorge sein. Falls ein Eigentümer außerhalb seiner Firma arbeitet, verdient er dort sein Geld und hat gute Chancen, mit oder ohne die besagte Dividende sein Einkommenslimit zu erreichen. Mehr geht eben nicht – also braucht man auch nicht alles zu verbieten und dem Einzelnen damit die Voraussetzungen für einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu erschweren.
Es muss auch in einer Gemeinwohl-Ökonomie möglich und gestattet sein, wenn auch begrenzt, durch Vermögen sein Einkommen zu vermehren bis zu dem von der Gemeinschaft festgelegten Maximum.
Die Behauptung, dass das Individuum nicht eingeschränkt werden soll und dass die Gemeinwohl-Ökonomie nur die „juristischen“ Personen betrifft, ist zu bezweifeln (Felber, 14 f.). Schließlich wird allen ein gemeinwohlnützliches Verhalten abgefordert. In den Unternehmen, in welchen sie arbeiten, beeinflussen Maßnahmen der Gemeinwohl-Ökonomie ebenfalls das Individuum an seinem Arbeitsplatz, und für alle Mitglieder der Gemeinwohl- Gesellschaft wird die Verfügung über Eigenkapital und Einkommen reglementiert.
Gewinnstreben soll nicht mehr Zweck unternehmerischen Handelns sein, sondern soll durch Gemeinwohlstreben ersetzt werden. Ob das eine das andere ersetzen kann, kann in Frage gestellt werden. In jedem Fall aber würde es der Gemeinschaft nützen, wenn die Unternehmen sich entsprechend gemeinwohlfördernd verhalten würden. Dazu muss man aber nicht die Wirtschaftsordnung abschaffen, sondern ähnlich wie bei dem Monopolverbot für Unternehmen nur die unerwünschten Auswüchse durch entsprechende Regeln vermeiden.
Wenn unsere Wirtschaftsordnung den Banken spekulative Geschäfte mit fremdem Geld erlaubt, ist das nicht hinnehmbar, weil Risiko und Haftung auseinander fallen. Es würde genügen, eine Regulierung einzuführen, dass Banker die Boni der letzten beiden Jahre zurückzahlen müssen für den Fall, dass die Bank auf Hilfe von außen angewiesen sein sollte. Ebenfalls muss unterschieden werden, ob Manager ihre Boni durch Einsatz von Fremdkapital oder Eigenkapital erwerben. Für Boni müssen im Falle von Fremdkapital strengere Begrenzungen und Auflagen gelten. Wir scheitern jedoch immer wieder an der Frage, wer das beschließen sollte angesichts der Situation gegenseitiger Verflechtung und Abhängigkeit der Entscheidungsträger. Es ist auch für die Gemeinwohl-Ökonomie unbedingt erforderlich, im Vorfeld der eigentlichen Reformen die Machtverhältnisse wieder verfassungsgemäß zu ordnen, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, einen wie auch immer gearteten Reformbeschluss durchsetzen zu können. Eine Revolution von unten ist unter den heutigen Verhältnissen aussichtslos, Das sollten wir uns in aller Nüchternheit vor Augen führen. Die politische Klasse braucht uns Bürger nicht mehr und will im eigenen Wirken nicht eingeschränkt und möglichst wenig von uns gestört werden. Das ist die Grundeinstellung unserer heutigen Volksvertretung (Tacke 33 ff.).
(Felber, 70 ff.) Die geplante demokratische Bank soll nicht gewinnorientiert arbeiten. Sie soll regionale Wirtschaftskreisläufe und sozial wie ökologisch nachhaltige Investitionen fördern. Ihre Funktionen betreffen in erster Linie die Verwaltung von Spareinlagen, kostenlosen Giro-Konten, kostengünstigen Krediten für Individuen und Firmen, die die Auflage ökonomischer Bonität und der Schaffung von ökologischem und sozialem Mehrwert erfüllen. Gleichermaßen soll sie zuständig sein für kostengünstige Ergänzungskredite zur EZBFinanzierung und – solange noch erforderlich – zur Vermittlung von Staatsanleihen.
Eine demokratische Bank deckt nur die Kosten plus Vorsorge für Kreditausfälle. Die maximale Einkommensspreizung bei den Mitarbeitern soll 1:3 betragen. Die Vorstände sollen persönlich haften, wenn sie die Gesetze nicht einhalten.
Sie beschäftigt sich also bewusst nahezu ausschließlich mit dem klassischen Bankgeschäft, indem sie als Vermittler fungiert zwischen Sparern und Kreditnehmern. Da sie kein eigenes Geld schöpfen sollte, verfügt sie laut Felber auch über genügend Eigenkapital (woher?), um Krisenzeiten überstehen zu können. Das Geld bleibt jedoch Eigentum der Sparer. Es wird nicht zum Eigenkapital der Banken gerechnet. Da es keine Fonds mehr geben soll, sind die Menschen gehalten, Ihr Geld zinslos bei der demokratischen Bank zu deponieren. In Krisenzeiten – oder wenn eine Firma ihren Kredit nicht zurückzahlen kann – werden die Verluste gedeckt aus den geplanten Rücklagen aus dem Kreditgeschäft – sollten sie aufgebraucht sein, deckt der Staat den Verlust ab. Diese staatliche Garantie wird besonders wichtig, weil Banken in der Gemeinwohl-Ökonomie gehalten werden, antizyklische Kreditpolitik zu betreiben und dadurch in Krisenzeiten den Unternehmen wesentlich mehr Kredite gewähren als in normalen Zeiten.
Alles wird in der Verfassung festgeschrieben und kann nur durch den Souverän geändert werden. Regierung und Parlament sollen keinen Zugriff auf die Demokratische Bank haben.
Die Bank soll Risiken eingehen können bei ökosozialen Projekten. Alternativ sollen bei sonstigen nicht ökosozialen Unternehmenskrediten (also Risikokapital) die Kreditgebühren im Erfolgsfall höher sein, damit man damit ausfallende Kredite abdecken kann. Auch können lokale Bürger in die Investition einbezogen werden, bekommen dafür aber nur Anerkennung und Mitsprache. Der Investitionsgrund soll nicht Geld sein! Alle Orga...