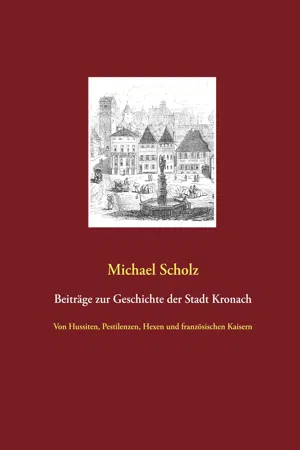
eBook - ePub
Beiträge zur Kronacher Stadtgeschichte
Von Hussiten, Pestilenzen, Hexen und französischen Kaisern
- 204 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Beiträge zur Kronacher Stadtgeschichte
Von Hussiten, Pestilenzen, Hexen und französischen Kaisern
Über dieses Buch
Diese vier Beiträge zur Kronacher Geschichte stellen Themen vor, die bisher etwas vernachlässigt wurden. Der erste Beitrag beschäftigt sich mit der Belagerung durch die Hussiten, der zweite mit den Hexenverfolgungen, der dritte mit den Pestepidemien und der vierte mit dem Besuch Napoleons in Kronach und den damit verbundenen militärischen Durchmärschen. Besonderes Augenmerk wurde in allen Beiträgen immer auf die sogenannten "kleinen Leute" gelegt, die zumeist die Politik der "Großen" ausbaden mussten. So entstand ein menschlicher Einblick in vier Kapitel der Kronacher Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Beiträge zur Kronacher Stadtgeschichte von Michael Scholz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Pest
Vom großen Sterben in der Welt und in
Kronach
Einleitung
Der schwarze Tod und das große Sterben, das sind nur zwei der zahlreichen Namen, die der Volksmund für eine der schrecklichsten aller Krankheiten gefunden hat: die Pest!
Tausende und abertausende hat diese furchtbare Geißel der Menschheit dahingerafft. Vor keinem machte die Seuche halt. Arm und reich, alt und jung, im Sterben waren sie alle gleich. Da die Mediziner, die seit dem Altertum mit der Pest konfrontiert wurden, ja noch nichts von Bakterien und Antibiotika wußten, nahm diese schreckliche Krankheit fast immer einen epidemischen Verlauf. Man war früher der Ansicht, daß eine Verunreinigung der Luft für die Krankheit verantwortlich war, und teilweise wurden riesige Scheiterhaufen mit wohlriechenden Kräutern als Gegenmittel entzündet. Pesthäuser wurden gegründet und die Kranken dort gesammelt. Von der Grundidee her war dies natürlich richtig, allerdings hatten die Krankenpfleger und Ärzte keinerlei oder nur unzureichende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Gewiß, es gab Ärzte und Pfleger, die nicht von der Pest befallen wurden, aber sie waren doch die Ausnahme.
In manchen Gegenden wurden die Kranken einfach eingemauert, andere Ärzte verlangten von den Pestkranken eine radikale Fastenkur. Die Auswirkungen auf einen geschwächten Organismus kann sich ja jeder vorstellen. Allgemein arbeiteten die Ärzte mit dem Pestwurz oder dem Tausendgüldenkraut, das sie zumeist aufgebrüht in Wasser verabreichten. Die Mediziner selbst versuchten sich durch dicke Mäntel und Masken mit langen Nasen, in denen Aromastoffe waren, vor der Seuche zu schützen. Das alles half aber nicht viel. Der polnische König machte das einzig richtige: Er erließ eine Quarantäneverordnung für alle Grenzen seines Königreiches.
Besonders hervorgetan hat sich der Orden der Franziskaner, der sich überall, wo er Niederlassungen hatte, um die kranken Menschen kümmerte. Die Mönche hatten dann alleine bei der großen Pandemie von 1348/49 über zehntausend Tote zu beklagen.
Aber auch nicht-franziskanische Kleriker taten sich hervor, wie zum Beispiel der heilige Aloisius Gonzaga, der 1591 in Rom die Kranken pflegte und dann schließlich selbst an der Seuche starb, oder der italienische Prediger und Reformer Girolamo Savonarola, der etwa hundert Jahre früher in Florenz den an der Pest erkrankten Mönchen weiterhin die Sakramente spendete. Er starb ein Jahr später, 1498, allerdings nicht an der Pest, sondern als Häretiker durch den Strick; sein Leichnam wurde verbrannt. Viele andere bedeutende Menschen starben ebenfalls durch diese Krankheit. In der Antike waren dies zum Beispiel Perikles und Kaiser Marcus Aurelius, später dann Wilhelm von Ockham, Cornelius Jansen, Martin Opitz oder Perugino.
Das Auftreten der Seuche wurde nach der damals herrschenden Meinung entweder durch die Sündenhaftigkeit und Sittenlosigkeit der Menschen oder durch Kometen und andere Himmelserscheinungen angekündigt oder ausgelöst. Der Klerus predigte der Bevölkerung, daß ihre Sünden der Auslöser wären und der Tag des Jüngsten Gerichts bald gekommen sei und die Pest nur ein weiterer der apokalyptischen Reiter wäre, der nach der Offenbarung des Johannes, den dritten Teil der Menschheit auslöschen sollte.
Dieser Gedankengang lag für die religiösen Menschen des 14. Jahrhunderts nahe, denn fast alle Prophezeiungen des Johannes schienen eingetreten. Da waren Heuschreckenplagen, Hungersnöte, Erdbeben und Himmelserscheinungen; Kriege waren damals ja sowieso an der Tagesordnung. So zählten die Menschen eins und eins zusammen und kamen auf den Weltuntergang. Diese Ansicht ist allerdings charakteristisch für das Mittelalter, jeder wartete irgendwie auf das Ende der Welt und das Jüngste Gericht.
Aus dieser Stimmung heraus wurden auch die Juden für den Ausbruch der Pest verantwortlich gemacht. Man unterstellte ihnen, sie hätten die Brunnen vergiftet, um die gesamte Christenheit auszulöschen. Dieser Anschuldigung schlossen sich Pogrome an, denen tausende von Juden zum Opfer fielen.
Die nächste Bewegung, die durch die Pest aufkam, waren die Geißler oder Flagellanten, die auch lauthals für Judenmorde eintraten und durch Selbstzüchtigung und Gebet Buße erlangen wollten. Durch ihr imposantes Auftreten, die Gesänge und Gebete hatten sie zu Anfang sogar einige Erfolge zu verbuchen. Die Menschen in den Städten, in die sie kamen, wurden tatsächlich „tugendhafter“. Später dann warf man den Geißlern vor, unter dem Deckmantel der Buße ihre eigene Unzucht weiterzutreiben. Als sie dann auch noch die Autorität der Kirche anzweifelten, wurden sie vom Klerus und den weltlichen Mächten gnadenlos verfolgt.
Die Pest fand ihren Niederschlag ebenso in der Literatur, wie zum Beispiel in Boccaccios Decamerone, in dem sich zehn Menschen vor der Pest auf ein Landgut flüchten.
Die Pest war und ist eine der gefährlichsten Krankheiten die es gibt, und wir können heute froh sein, daß sie unter Kontrolle ist und wenigstens aus Europa verbannt wurde. Wir müssen uns allerdings immer wieder auf einen erneuten Ausbruch gefaßt machen, der wie im Mittelalter sich wieder über die Hafenstädte wie Marseille, Genua oder Neapel, auf ganz Europa verbreiten könnte.
Medizinische Erklärung der Pest
Schlagen wir irgendein Lexikon auf und suchen unter dem Begriff "Pest", finden wir eine Definition, die sich wahrscheinlich wie diese anhört: PEST (Pestilenz, lat.), durch P. Bakterien übertragene epidemische Krankheit; dezimierte in früheren Jahrhunderten auch in Europa die Bevölkerung in immer neuen Wellen; heute durch strenge hygien. Überwachung, vor allem in den Hafenstädten, aus Europa völlig verdrängt, nur noch in Asien heimisch.(1)
So einfach ist die Sache allerdings nicht. Der Volksmund nannte noch bis ins Mittelalter hinein jede bösartige epidemische Krankheit einfach "Pest", egal um welche Krankheit es sich tatsächlich handelte.
Aber was ist die Pest jetzt wirklich? Die Pest ist eine eminent ansteckende Infektionskrankheit. Sie wird durch Pestbakterien (Yersinia pestis) hervorgerufen. Der Erreger wurde erstmals 1894 in Honkong von Alexandre Yersin entdeckt. (Yersin, ein Schweizer Tropenarzt, war Mitarbeiter am Institut Pasteur.) Vorerst ordnete man den Erreger der Gruppe der Pasteurellen zu. Da spätere Untersuchungen erhebliche Unterschiede in den biochemischen und enzymatischen Eigenschaften sowie dem pathogenen Vermögen zwischen dem Pesterreger und den Pasteurellen aufzeigten, wurde eine ganz neue Gruppe geschaffen: die der Yersinia.
Der heute somit "Yersinia pestis" benannte Erreger ist ein plumpes, ovoid geformtes, unbewegliches und ungegeißeltes Stäbchen von der Länge von 1-2 μ. Er ist anspruchslos und daher leicht auf den verschiedensten Nährmedien zur Vermehrung zu bringen, am optimalsten bei einer Temperatur um 25° C, dennoch ist er unempfindlich gegenüber niederen Temperaturen. So kann das Pestbakterium auch außerhalb von lebenden Organismen unter Bewahrung seiner Infektiosität überleben. Besonders gute Voraussetzungen liegen z. B. im Auswurf oder in Baumwollgeweben vor, unter optimalen Bedingungen kann es jedenfalls Monate, manchmal Jahre überdauern. Abtötend hingegen wirkt intensive Sonneneinstrahlung oder UV-Licht. (2)
Die Medizin unterscheidet drei Unterarten der Yersinia pestis. In Häfen, in Amerika und dem Orient findet man am häufigsten den Yersinia pestis orientalis. Der Yersinia pestis antiqua dagegen ist wahrscheinlich am Ausbruch der großen Epidemien in der Antike schuld. Heute trifft man ihn noch in einigen Gebieten Afrikas an. Der Yersinia pestis mediävalis ist das Bakterium, von dem die Wissenschaftler annehmen, daß es die großen Epidemien in Westeuropa und dem Nahen Orient von 1348 an verursachte.
In der Gruppe der Yersinia-Arten finden wir auch noch den Yersinia pseudotuberculosis und den Yersinia enterocolitica. Sie weisen jede für sich große Gemeinsamkeiten mit dem Pesterreger auf und die Mediziner spekulieren, daß diese beiden Erreger in Yersinia pestis mutiert sind und umgekehrt. Die Bakterien der Yersinia-Gruppe stellen der Wissenschaft jedenfalls immer neue Rätsel, ihr 'epidemiologisches Genie' scheint unerschöpflich. (2)
Bei der Krankheit selbst kann man zwei Arten der Pest unterscheiden. Dringt der Erreger über die Haut ins Lymphsystem, handelt es sich um die sogenannte Beulen- oder Bubonenpest. Nimmt die Infektion von den Lungenschleimhäuten aus ihren Lauf, spricht man von der Lungenpest. Bei der Beulenpest dringen die Erreger also über die Haut in den Körper ein. Dies geschieht vor allem bei Bißwunden (u. a. durch Flöhe) oder anderen Verletzungen der Haut. Diese Pestart hat eine Inkubationszeit von durchschnittlich nur sechs Tagen. Der Patient bekommt plötzlich und "aus vollster Gesundheit heraus" einen Fieberschub auf etwa 40° mit starken Kopf- und Gliederschmerzen, darauf folgen extreme Lichtempfindlichkeit und heftiger Schüttelfrost. Der Erkrankte erbricht sich und ist benommen. Bei schweren Verlaufsformen wird Blut gespuckt; es treten auch Hautblutungen auf.
Am augenscheinlichsten sind aber die Schwellungen der Lymphknoten in der Leistengegend, in der Achselhöhle und am Hals. Die geschwollenen Lymphdrüsen werden Bubonen genannt. Man unterscheidet dabei primäre und sekundäre Bubonen: Erstere werden auf dem Lymphweg direkt von der Infektionsstelle her gebildet, zu den sekundären kommt es erst durch Erregerstreuung auf dem Blutweg.(2)
Bei 50 – 75 % der Fälle treten diese Schwellungen in der Leistengegend auf, bei 20 % in der Achselhöhle und nur bei 10 % im Nacken. Diese Schwellungen müssen aber nicht sofort sichtbar werden und können auch erst einige Tage nach dem Fieberschub auftauchen. Bei einigen Fällen stirbt der Patient auch, ohne daß die Bubonen sichtbar werden. Dies wird vor allem zu Beginn einer Epidemie beobachtet, da durch die vorher zu stark angeschlagene Konstitution des Patienten der Tod schon vorher eintritt, und die Schwellungen zu wenig Zeit hatten sich zu entwickeln. Bei einem "klassischen" Krankheitsverlauf tauchen die Bubonen allerdings nach einem bis zwei Tagen auf und können von der Größe einer Walnuß bis zu Faustgröße aufschwellen. Der Kranke selbst nimmt im Bereich dieser Schwellungen ein starkes Spannungsgefühl wahr.
Während des Krankheitsverlaufs wird auch der Kreislauf in Mitleidenschaft gezogen. Der Puls rast und wird flach. Zum Ende der Erkrankung hin ist er fliegend und nicht mehr rhythmisch, bis er nicht mehr zu fühlen ist. Weiterhin wird Bluthochdruck diagnostiziert sowie eine Neigung zum Kollaps und ein Druckgefühl über dem Herzen. Während dieses Krankheitsbildes ist ein Herzversagen jederzeit möglich.
Nach ungefähr einer Woche kann eine Gesundung beginnen, bei Betrachtung bisheriger Epidemien rechnet man mit 20 bis 40 % Heilungsfällen. Der dabei einsetzende Fieberabfall geht in der Regel einher mit dem Durchbruch der eingeschmolzenen Bubonen oder dem Beginn ihrer Rückbildung. Es gibt aber auch irreguläre Krankheitsverläufe: Im Extrem können die Auswirkungen der Infektion so gering sein, daß der klinische Verlauf der Beulenpest dem eines gewöhnlichen Karbunkels entspricht. Solche Fälle von sog. ‚pest minor‘ sollen vor allem gegen Ende von Epidemien häufiger auftreten. (2)
Tritt diese Gesundung nicht ein, wird es ernst, und es kommt zur sogenannten hämorrhagischen Septikämie. Dabei strömen die Bakterien in das Blut und werden rasend schnell im ganzen Körper verteilt. Dies führt schon bald zum Tod. Dieses letzte Stadium der Krankheit beginnt mit Herz-, Nieren- oder Lungenkomplikationen und einem erneuten Fieberstoß auf 40 bis 42 Grad. Stirbt der Patient nicht gleich, so können weitere Hautveränderungen, wie neue Karbunkel oder Flecken unter der Haut, die in vielen Farben schimmern können, auftreten. Zum Ende der Krankheit hin ist der Patient auch stärker verwirrt, er hat Halluzinationen, fällt plötzlich ins Koma und stirbt bald darauf.
Bei der Lungenpest hingegen dringt der Krankheitserreger durch die Lungenschleimhäute in den Körper ein. Die Lungenpest kann auch eine Folge der Beulenpest sein. Der Grund dafür liegt darin, daß bei schweren Beulenpesterkrankungen die Gefahr einer Überschwemmung auch der Lunge, in der kritischen septikämischen Phase besteht. Geschieht dies, so bilden sich in ihr sog. metastasische Herde. In solch einem Fall spricht man von sekundärer Lungenpest, weil ihr der gewöhnliche Verlauf der Beulenpest vorausging. (2) Der Patient hat einen starken Auswurf, in dem es nur so von Bakterien wimmelt. So gibt er die Erreger in die Umwelt ab, und somit geht die Bubonenpest in die Lungenpest über.
Genau wie die Beulenpest setzt die Lungenpest plötzlich ein und beginnt mit einem enormen Fieberstoß und Schüttelfrost. Nur einen Tag nach der Infektion bricht die Krankheit aus, und nach nur einigen Stunden kann sich Herz- und Kreislaufversagen einstellen. Atemstörungen, Kurzatmigkeit und ein heftiger Hustenreiz stellen sich ebenfalls kurz nach der Infektion ein. Zu Beginn der Krankheit klagt der Patient auch über Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung, genauso wie Appetitlosigkeit. Weiterhin hat der Erkrankte auch einen starken Auswurf, der schon bald blutig wird und nur unter großen Schmerzen abzuhusten ist.
Im Gegensatz zur Beulenpest ist bei der Lungenpest der Krankheitsverlauf schneller, und ohne Behandlung stirbt der Patient schon nach zwei bis drei Tagen, bei der Beulenpest die Hälfte der Erkrankten vor dem achten Tag und 80 bis 90 % vor Beginn der vierten Woche. Vor dem zweiten Tag sterben 30 bis 40 % und nur ein bis zwei Prozent sterben sofort. Die Beulenpest ist im Gegensatz zur Lungenpest weniger gefährlich und die Heilungschancen sind besser.
Hatte ma...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Von den Ketzern aus dem Böhmerlande
- Von Hexen und Hexenbrennern
- Pest Vom großen Sterben in der Welt und in Kronach
- Als Napoleon nach Kronach kam
- Impressum