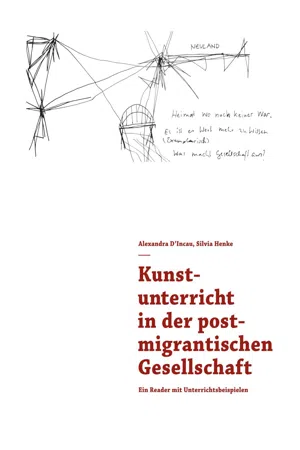
eBook - ePub
Kunstunterricht in der postmigrantischen Gesellschaft
Ein Reader mit Unterrichtsbeispielen
- 140 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Kunstunterricht in der postmigrantischen Gesellschaft
Ein Reader mit Unterrichtsbeispielen
Über dieses Buch
Ob Stillleben, Selbstporträt oder räumliches Zeichnen: Sobald man den Anspruch an kulturelle Bildung ernst nimmt, werden Kernaufgaben des Kunstunterrichts zu komplexen und äußerst produktiven Fragen von Identität, Differenz, Zugehörigkeit und Symbolik. Sie führen damit immer auch zu aktuellen transkulturellen Bedeutungen.Der vorliegende Reader bietet einen diskursiven Rahmen und konkrete Unterrichtsbeispiele für theoretische, subjektive und alltagsspezifische Artikulationen von Kultur, in dem er verschiedene Stimmen und Perspektiven zusammenführt. Nachvollziehbar wird damit das Wechselspiel von individuellen und gesellschaftlichen Bedeutungen von Transkultur im konkreten künstlerisch-gestalterischen Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kunstunterricht in der postmigrantischen Gesellschaft von Alexandra D'Incau,Silvia Henke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politische Freiheit. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
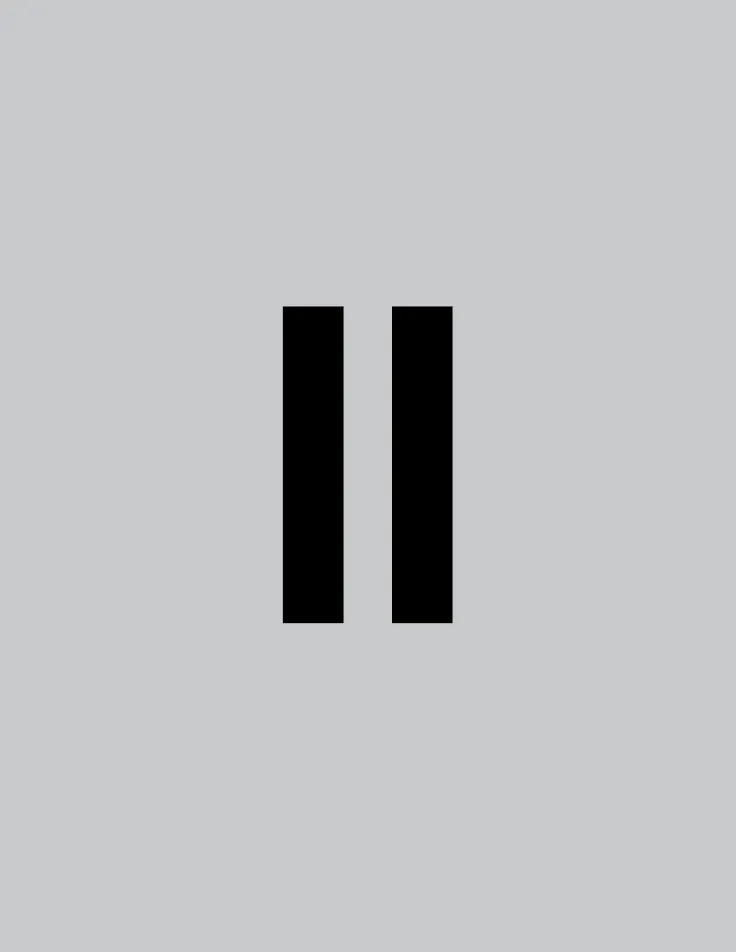
PRAKTIKA
UND ÜBUNGEN
IM FELD DER
TRANSKULTURELLEN
KUNSTPÄDAGOGIK
Preliminarien
Alexandra D’Incau, Silvia Henke
Rahmen und methodische Voraussetzungen
Im Studienjahr 2016/17 führten 5 Studierende aus dem Studiengang Master of Arts in Fine Arts, Major Art Teaching in ihrem 2. Praktikum auf der Sek II Stufe (Gymnasium) ein Praktikum durch, bei welchem sie Fragestellungen des Transkulturellen im Blickfeld hatten. Eingeführt und eingeübt wurde die Thematik durch ein 4-tägiges Forschungsmodul, in welchem wir uns folgenden Aspekten widmeten: Perspektive der Kunst, Perspektive der Pädagogik, Perspektive Alltag und eigene biographische Erfahrungen, Perspektive Bildungssoziologie und zuletzt auch noch methodische Ansätze von Unterrichtsforschung und Reflexion, die in den Praktika zum Zuge kamen.
Aufgabe der Praktikant*innen war es, den Umgang mit kulturellen und sozialen Unterschieden sowie Geschlechterdifferenzen über gestalterische Arbeit zu beobachten, ohne Muster zu verfestigen, sondern um diese zu erkennen, zu öffnen und eventuell im Gespräch zu verschieben.
Dieser Anspruch klingt und ist gross – auch in den Ohren der Lehrer*innen für bildnerisches Gestalten, bei welchen die Studierenden ihre Praktika machten. Interessant waren in dieser Hinsicht auch die negativen Reaktionen von einigen Lehrpersonen, die sofort meinten, das Thema hätte doch mit dem Fach Bildnerisches Gestalten nichts zu tun. Andere präzisierten ihre Bedenken, indem sie die Studierenden mit konkreten und eher technisch-formalen Lehrinhalten beauftragten (Perspektive, Figur, räumliches Zeichnen) und meinten, dass diese formalen oder technischen Lehrziele nichts mit Kultur oder Fremdheit zu tun haben könnten. Andere wiederum verwiesen auf das homogene soziale Milieu an gewissen Gymnasien, das solche Fragen gar nicht zulasse und ein solches Vorgehen deshalb wenig sinnvoll sei.33 Bei den positiven Reaktionen waren zwei Typen häufig: die einen waren einfach offen und neugierig, liessen die Studierenden gewähren; die anderen waren aktiv interessiert, weil das Thema eigene Erfahrungen berührte.
Die Studierenden hatten entsprechend eine relativ diffizile Aufgabe im Vorfeld ihres Praktikums: nicht nur war es an ihnen, eine geeignete Aufgabenstellung zu finden für ihr Vorhaben, sie mussten diese auch verbinden mit den Vorstellungen oder Vorgaben der Lehrpersonen gemäss Lehrplan und mit Forschungsfragen, mit welchen wir sie vertraut gemacht haben. Zudem mussten sie den ganzen Prozess dokumentieren und Vorbereitungs- und Auswertungsgesprächen mit uns führen. Trotz Interesse der Studierenden wurden entsprechend wenige Praktika durchgeführt. Insgesamt lässt sich sagen: das Interesse der Studierenden war grösser als jenes der Lehrpersonen für Bildnerisches Gestalten.
Von uns erhielten den Praktikant*innen ein Merkblatt, mit welchem sie die Vor- und Nachbereitung sowie ihre Reflexion strukturieren konnten. Gleichzeitig erhielten sie ein Merkblatt zu den Eckdaten des Forschungsprojektes für die Kommunikation mit der Lehrperson.
Merkblatt zum Forschungs-Praktikum mit Fokus auf Transkultur
- Wie taucht das Thema auf? (Aufgabe, Bildbeispiel, Gespräche)
- Wie kommt Vielfalt zum Ausdruck?
- Wie werden Unterschiede gezeigt, thematisiert?
- Welche Stereotypen kommen zum Vorschein? Werden sie bewusst gemacht?
- Welche Aussagen über das Eigene / Persönliche werden gemacht?
- Wie taucht das Fremde / Andere auf? Welche Aussagen werden gemacht?
- Aussagen über Milieu, Zugehörigkeit, Ähnlichkeit?
- Tauchen Sexismen, Rassismen auf? Umgang damit?
- Woher kamen die Erkenntnisse? (Input, Schüler*innen, Zusammenfassung und Verdeutlichung durch Lehrperson)
- Eigene Position
- Welches waren jeweils meine konkreten Erwartungen (Lehrziele)?
- Welche Teilaufgaben, welche Fragen eigneten sich speziell für die Themenstellung, welche weniger?
- Wo gab es Überforderung?
- Was waren die Highlights?
- Wo und warum gab es Enttäuschung?
- Generelle Hinweise bezüglich Unterrichtsforschung Erhöhte Aufmerksamkeit für Schlüsselmomente und Irritationen, sorgfältige Dokumentation, Bildbeispiele oder Flipcharts fotografieren
Dieses Merkblatt ist natürlich keineswegs erschöpfend für alle Ebenen und Fragen, die im Themenfeld auftauchen. Das zeigen die nachträglichen Auswertungen zu den Praktika, die zusammen mit den Praktikant*innen und zum Teil auch mit den Lehrpersonen, also den offiziellen Praktikumsbegleitungen, erfolgten.
Forschungsfragen
Ein wichtiges Anliegen unseres Forschungsprojektes war neben Kompetenzaufbau und Wissensaustausch auf Hochschulebene die Vernetzung mit Lehrpersonen BG Sek II sowie die Entwicklung, Erprobung und Durchführung von gestalterischen Aufgabenstellungen mit transkultureller Perspektive im BG-Unterricht. Gerade im Wissen darüber, dass für viele Master-Studierende das Forschen im kunstpädagogischen Feld während des Studiums oft abstrakt und ungreifbar bleibt, entschieden wir uns, sie bei Interesse aktiv in dieses Projekt einzubeziehen. Es zeigte sich erst im konkreten Kontext, wie komplex und anspruchsvoll es nach wie vor ist, die Perspektive des Transkulturellen zu thematisieren. Denn die Schweizer Bildungsinstitutionen bilden nach wie vor eine relativ homogene, überwiegend weisse und weibliche Lehrerschaft aus, auch im Feld der Kulturvermittlung. In diesem Sinne legt Göhlich dar, dass heutige Pädagog*innen meist weniger existentielle transkulturelle Erfahrungen haben als die von ihnen unterrichteten Jugendlichen und, dass Transkulturalität oft nach wie vor eher als Problem denn als Ziel pädagogischer Praxis erscheint.34
Um die Studierenden zwischen all diesen Herausforderungen, Verstrickungen und Widersprüchen in ihrer Wirkmacht zu stärken, führten wir im Modul «Forschung Kunstpädagogik» den Ansatz der Aktionsforschung nach Altrichter/Posch ein, eine Methode, die die (Weiter)entwicklung der eigenen Unterrichtspraxis unterstützt. Wie produktiv diese für Berufseinsteiger*innen ist, kann diskutiert werden. Wichtig war für uns, dass sie Expert*innen im eigenen Feld sein konnten und Probleme der Praxis selbst feststellten und auch Erkenntnisse für eigene Lösungen gewannen.35 So ergänzten unterrichtsbeforschende Verfahren und transdisziplinäre Zugänge zu visuellen Kulturen die theoretisch-praktische Einführung in dieses komplexe Themenfeld einer transkulturellen Kunstvermittlung mit all ihren Chancen und Herausforderungen. Die vielfältige Auseinandersetzung auf kultureller, künstlerischer und didaktisch-pädagogischer Ebene ergänzt durch das Erkennen eines eigenen Interesses, das im Zuge einer kleinen Feldforschung vertieft wurde, bildete die Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit den Studierenden.
Dafür war es unabdingbar, ihnen Grundlagenwissen über kulturwissenschaftliche Konzepte zu vermitteln und ihre historische und gesellschaftliche Relevanz aufzuzeigen.36 Ebenso relevant war der fachspezifische Ansatz. In diesem Kontext analysierten und diskutierten wir gemeinsam Strategien und Wirkmacht künstlerischer Praktiken und Initiativen. Dies geschah selbstverständlich immer mit Seitenblick auf Ansprüche und Bedingungen des BG-Unterrichts, um davon ausgehend eine Brücke ins Feld des (Kunst-)Pädagogischen schlagen zu können. Potentielle Widersprüche zwischen künstlerischer Denkweise, Pädagogik und Didaktik kamen dabei ebenso zur Sprache wie die Vielfalt von Themen, Fragestellungen und Zielen im Forschungsgebiet der Kunstpädagogik, die, wie jede andere Disziplin, durch institutionelle, gesellschaftliche und politische Konstellationen mitbestimmt werden.37 Um die Vielfalt an Zugängen und Methoden erlebbar zu machen, versuchten wir innerhalb des Moduls, methodische Ansätze zur visuellen und materiellen Kultur des Pädagogischen anhand eigener kleiner Feldforschungen exemplarisch einzuüben. Dabei zeigte sich der Ansatz von Schade/Wenk als äusserst produktive Herangehensweise. Gemäss diesem gilt es, «Praktiken des Sehens, des Interpretierens, des Deutens oder auch des Zu-Verstehen-Gebens, der Gesten und Rahmungen des Zeigens und Sehens, und damit nicht zuletzt auch Fragen nach darin eingeschlossenen Effekten von Autorität, Macht und Begehren in der Konstitution von Relationen zwischen Individuen und Gemeinschaften in den Mittelpunkt zu rücken.»38 Wir teilen die Ansicht, dass «ein verantwortungsvoller Umgang mit visueller Kultur […] notwendig eine Reflexion des eigenen Standortes und der eigenen Perspektive» mit einschliesst.39 Besondere Bedeutung schenkten wir deshalb der dazugehörenden Reflexion, beispielsweise, inwiefern gewonnene Erkenntnisse in den Kontext der schulischen Bildung übersetzbar sind.40 Neben dem Erwerb von Fachkompetenzen legten wir grossen Wert auf die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen, denn durch das Kennenlernen von Theorien können auch blinde Flecken und implizite Annahmen erkannt werden. Ausgehend von künstlerischen Strategien, die sich oft und gerne expliziten Stellungnahmen widersetzen, kann beim gemeinsamen Diskutieren der Umgang mit Kontingenz und Ambivalenz gezielt geübt werden. Denn die viel beschworene Offenheit eines künstlerischen Werkes ist dort Erkenntnis fördernd, wo sie gesellschaftliche Widersprüche aufdeckt. Solche Erkenntnisse und Fähigkeiten können helfen, die eigene Haltung zu erkunden und darauf aufbauend ein pädagogisches Selbstverständnis zu entwickeln, welches die Sensibilität für Machtstrukturen und transkulturelle Zusammenhänge in der Gesellschaft wie im schulischen Umfeld mit einbezieht. Beide Bezugsfelder – Kunst wie Gesellschaft – konstituieren sich nämlich durch normative Standards und Codes, die Stabilisierung und somit Vereinfachung versprechen. Und so galt es gemäss Yildiz das Versprechen zu hinterfragen, «Individuen könnten durch Erziehung jenseits der Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu völlig autonomen und freien heranwachsen.»41
Diejenigen, die sich davon ausgehend für die Durchführung eines Praktikums mit dem Schwerpunkt Transkultur entschieden, erhielten neben dem regulären fachdidaktischen Mentorat zusätzlich ein spezifisches Coaching durch uns, in welchem wir thematische Unsicherheiten auffangen konnten und ihnen einen Reflexionsraum anboten, der sie bei gestalterisch-inhaltlichen Entscheiden unterstützte. Nach Abschluss unseres Projektes fühlen wir uns in unser These bestätigt, dass das Wissen um transkulturelle Bedingungen in der postmigrantischen Gesellschaft helfen kann, unseren Blick auf eine konstruierte Wirklichkeit und deren Machstrukturen zu legen und uns selber so...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Silvia Henke und Alexandra D’Incau
- I. Transkultur und Kunstunterricht: Sichtung eines Forschungsfeldes
- II. Praktika und Übungen im Feld der transkulturellen Kunstpädagogik
- III. Berichte von Studierenden der Hochschule Luzern – Design & Kunst
- IV. Verzeichnis
- Impressum