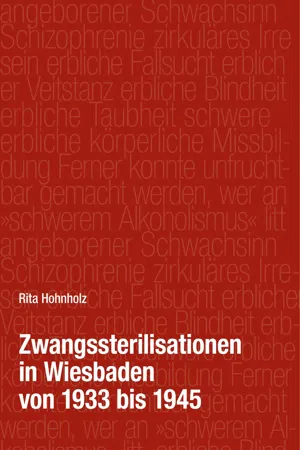![]()
1. Einleitung
Die während des »Dritten Reiches« in Wiesbadener Krankenhäusern und der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg durchgeführten zwangsweisen Sterilisationen an mehreren Hundert Männern und Frauen haben über einen langen Zeitraum keine umfassende wissenschaftliche Beachtung erfahren. Dabei ist es nicht so, dass die im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden vorhandenen Erbgesundheitsgerichtsakten, die das Schicksal der Betroffenen widerspiegeln, bis dato nie genutzt worden sind. Tatsächlich wurden sie im Zusammenhang mit dem Projekt »Widerstand und Verfolgung in Hessen zwischen 1933 und 1945« herangezogen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Schicksale und Lebenswege der von NS-Verfolgung betroffenen Personen sowie derjenigen, die sich gegen den nationalsozialistischen Unrechtsstaat zur Wehr setzten, zu dokumentieren. Auf diese Weise entstand eine Datenbank, die personenbezogene Recherchen ermöglicht. Dort sind auch die Menschen erfasst, die auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen zwangssterilisiert worden sind.
Von Zwangssterilisation betroffen waren selbstverständlich auch Menschen aus Wiesbaden, wobei der Fokus der folgenden Untersuchung auf Personen liegt, die in Wiesbadener Krankenhäusern sowie der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg zwangsweise unfruchtbar gemacht wurden. Folglich sind in der Studie nicht alle Wiesbadener Bürger – oder Einwohner – erfasst, die sich zwischen 1934 und 1945 diesem Eingriff unterziehen mussten, denn mancher Wiesbadener war in anderen Orten (des heutigen) Hessens oder gar des Reiches zwangssterilisiert worden. Der Rechercheaufwand, der notwendig gewesen wäre, um Menschen, die in Wiesbaden geboren oder lange Zeit dort gelebt hatten, in alten Unterlagen und Dokumenten, darunter aus Einwohnermeldeämtern usw., ausfindig zu machen, um zu erfahren, wann und an welchem Ort sie zwangssterilisiert worden sind, wäre enorm gewesen und hätte ein Scheitern impliziert, weil die Informationen, nicht zuletzt aufgrund von Kriegseinwirkungen, nicht mehr erhalten sind. Folglich ist es fast unmöglich, eine Untersuchung vorzulegen, die Wiesbaden und sämtliche Wiesbadener Bürger, die hier geboren worden sind oder hier gelebt haben, berücksichtigt. Deshalb wurde der Ausgangspunkt »Wiesbadener Krankenhäuser« gewählt.
Obwohl die Suchmöglichkeiten, die die Datenbank »Widerstand und Verfolgung« anbietet, vielfältig sind, konnte sie doch den gewählten Schwerpunkt nicht vollständig abbilden und daher nicht alle Betroffenen auflisten. Dennoch stellte die Datenbank, die sich in Bezug auf die Wiedergabe der Schicksale und Lebenswege der Zwangssterilisierten, u. a. auf Erbgesundheitsgerichtsakten stützt, einen wichtigen Meilenstein bei der Erstellung der vorliegenden Untersuchung dar.
Ergänzt und erweitert wurden die in der Datenbank vorgehaltenen Informationen u. a. durch das Heranziehen und Auswerten von Erbgesundheitsgerichtsakten vornehmlich aus Wiesbaden, Frankfurt/Main, oder Limburg/Lahn.1 Hinzu kamen Akten von Landratsämtern, zum Beispiel des Rheingaukreises, des Rheingau-Taunus-Kreises, des Obertaunuskreises oder des Landratsamts Gelnhausen2, außerdem Akten aus dem Bestand des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main, bei dem das für Wiesbaden zuständige Erbgesundheitsobergericht angesiedelt war, dem Amtsgericht Wiesbaden, dem das örtliche Erbgesundheitsgericht angegliedert war, oder dem Landgericht Wiesbaden (Staatsanwaltschaft).3 Berücksichtigt wurden darüber hinaus Unterlagen aus dem Bestand der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg4, den (hessischen) Regierungspräsidien als Entschädigungsbehörde5, dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt6 und dem Hessischen Staatsarchiv Marburg7. Einblick wurde auch in die Gestapo-Kartei Frankfurt/Main genommen, die teilweise in fotokopierter Form im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden vorhanden ist. Außerdem die im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden vorhandenen Aktenunterlagen in Bezug auf das Wiesbadener Gesundheitsamt. Wichtig waren im Übrigen die im Stadtarchiv Wiesbaden vorhandenen Akten und Amtsbücher.8
Die Auswertung der genannten Materialien ergab, dass in Wiesbadener Krankenhäusern sowie der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg, die die für die Stadt zuständige psychiatrische Einrichtung darstellte, insgesamt 1.064 Frauen und Männer zwangssterilisiert wurden.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Frauen und Männern, die in Wiesbadener Krankenhäusern bzw. der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg zwangssterilisiert worden sind. In diesem Zusammenhang erfolgt eine kurze Auseinandersetzung mit den Kliniken, in denen die Eingriffe vorgenommen wurden, sowie dem dort tätigen medizinischen Führungspersonal. Eingegangen wird darüber hinaus auf die Formen der zwangsweisen Sterilisation sowie die Diagnosen, die dazu führten, dass sich Menschen dem Eingriff unterziehen mussten. Analysiert wird in Bezug auf die diagnostizierten Leiden, ob diese tatsächlich genetisch bedingt bzw. vererbbar waren, wie es das am 1. Januar 1934 in Kraft getretene »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« suggerierte, oder ob es sich in Wirklichkeit nicht um sozial oder »rassisch« bzw. rassistisch motivierte Indikationen handelte. Selbstverständlich wird hierbei auch nach den Gründen für rassistisch oder sozial indizierte Diagnosen gefragt. Des Weiteren befasst sich die vorliegende Studie mit den kommunalen bzw. staatlichen Behörden und Einrichtungen, die in das System der Zwangssterilisationen involviert waren, darunter das zunächst kommunale, ab 1935 dann staatliche Gesundheitsamt in Wiesbaden, sowie andere Ämter, wie zum Beispiel die Schulverwaltung oder das Wohlfahrtsamt. Untersucht werden aber auch nicht-staatliche Einrichtungen, die mit Menschen zu tun hatten, die zwangssterilisiert wurden, darunter u. a. kirchlich geführte Institutionen, wie das katholische Waisenhaus Sankt Michael oder die unter evangelischer Leitung stehende »Erziehungsanstalt« auf dem Geisberg. Alle Bereiche der Studie werden durch die beispielhafte Darstellung der Schicksale der in Wiesbaden zwangssterilisierten Frauen und Männer ergänzt und untermauert.
1.1 Aufbau der Studie und Quellenlage
Die Konzentration auf die Wiesbadener Krankenhäuser als Orte der Durchführung der zwangsweisen Sterilisation verlangte nach einer Auseinandersetzung mit der Geschichte des jeweiligen Hauses, seiner Leitung, Philosophie sowie religiösen bzw. weltanschaulichen Ausrichtung sowie dem dort führenden medizinischen Personal. Infolgedessen werden die Städtischen Kliniken, das Krankenhaus »Paulinenstift«, das Sankt Josefs-Hospital, aber auch das Rotkreuz-Krankenhaus eingehender untersucht.
Bei der Beschäftigung mit dieser Thematik stellte sich allerdings heraus, dass die historische Überlieferung für sämtliche Wiesbadener Kliniken – mit Ausnahme der Heil- und Pflegeanstalt Eichberg – rudimentär bis nicht vorhanden ist. In Bezug auf die Heil- und Pflegeanstalt Eichberg ist festzustellen, dass der Schwerpunkt der Untersuchungen, die sich mit der Einrichtung während der NS-Zeit beschäftigen, auf der Einbindung der Anstalt in die »Euthanasie« liegt. Das Thema Zwangssterilisationen im Eichberg ist dagegen bislang noch nicht erschöpfend dargestellt worden.
Im Fall der Städtischen Kliniken fanden sich weder im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden noch in den Beständen des Wiesbadener Stadtarchivs Unterlagen. Auch die in gedruckter Form vorliegenden Materialien erwiesen sich als spärlich. Dass das Thema Zwangssterilisationen keinerlei Berücksichtigung in den vorhandenen Texten findet, überrascht angesichts der Einstellung zu zwangsweisen Unfruchtbarmachungen vor und nach 1945 nicht. Erstaunlich ist hingegen, dass die Geschichte des Städtischen Krankenhauses in Wiesbaden sowohl vor, während als auch nach der NS-Zeit bislang auf wenig Interesse gestoßen ist. Eine umfassende Darstellung der medizinischen Einrichtungen in Wiesbaden – abseits des Kur- und Badewesens – existiert jedenfalls nicht. Als ergiebigstes Werk erwies sich die von Herbert Müller-Werth verfasste Festschrift »75 Jahre Städtische Krankenanstalten Wiesbaden« – im Rahmen der 600jährigen Wiesbadener Hospitalgeschichte 1879–1954 aus dem Jahr 1954.9
Ähnlich überschaubar war die Quellen- und Literaturlage in Bezug auf das Krankenhaus »Paulinenstift« und das Krankenhaus des Roten Kreuzes. Auch hier musste auf Festschriften zurückgegriffen werden, bei denen die Zeit des »Dritten Reiches« nicht im Mittelpunkt stand. Vielmehr zielten die Texte darauf ab, dem Leser lediglich einen allgemein und knapp gehaltenen Überblick über die Zeit des Bestehens der jeweiligen Einrichtung zu liefern.10
Gleiches galt für die Entwicklung der katholischen Krankenhäuser in Wiesbaden.11 Die stellten allerdings insofern eine Ausnahme dar, als in diesen Kliniken keine Zwangssterilisationen durchgeführt worden sind. In diesem Fall war es notwendig, sich mit den Gründen für die Nichtbeteiligung an den zwangsweisen Sterilisationen zu beschäftigen. Die hierzu vorhandene Literatur erwies sich als umfassend und aussagekräftig.12
Hinsichtlich des medizinischen Personals, insbesondere der Mediziner, die hauptsächlich für die Eingriffe verantwortlich zeichneten, konnte – zumindest in einigen Fällen – auf die im Hessischen Hauptstaatsarchiv aufbewahrten Spruchkammerakten zurückgegriffen werden, so dass es möglich war, zumindest einen Überblick über die Verstrickung der beteiligten Ärzte in das NS-System zu erhalten.13 Nicht anders verhielt es sich mit leitendem Pflegepersonal oder führenden Mitarbeitern in Behörden und Einrichtungen, einschließlich sozialen oder kirchlichen Institutionen, wie zum Beispiel dem evangelischen Erziehungsheim auf dem Geisberg, dem katholischen Johannesstift oder dem katholischen Waisenhaus Sankt Michael, beide in der Platter Straße.14 Auch hier ließen sich so gut wie gar keine personenbezogenen Unterlagen ausfindig machen. Sekundärliteratur existiert ebenfalls so gut wie keine, was schon in Bezug auf die Historie der jeweiligen Häuser thematisiert wurde. Es kann daher nicht überraschen, dass Informationen über die Mitarbeiterschaft in gedruckten Quellen oder Literatur nicht auszumachen sind.
Das zentrale Element der vorliegenden Studie aber stellen selbstverständlich die von der Zwangssterilisation betroffenen Männer und Frauen dar. Die meisten in Wiesbaden zwangssterilisierten Männer und Frauen erhielten die Diagnose »angeborener Schwachsinn«, gefolgt von »Schizophrenie«. Die von einem Arzt, häufig einem Vertreter des Gesundheitsamts, festgestellte »Erbkrankheit« war, wie die Studie zeigt, vorwiegend sozialindiziert und basierte keinesfalls auf einer tatsächlich vererblichen Krankheit. Diesbezüglich unterscheidet sich das Ergebnis für Wiesbaden nicht von dem in anderen Städten und Gemeinden in der Region bzw. im Deutschen Reich.15 Das gilt auch für die in Wiesbaden angewendeten Sterilisationsmethoden. Hier wie andernorts wurden die Betroffenen durch einen operativen Eingriff unfruchtbar gemacht. Nur selten kamen Röntgenstrahlen zum Einsatz.
Die Untersuchung legt eingehend dar, welche Personen aus welchen Gründen und in welchem Zeitraum zwangssterilisiert wurden und schildert darüber hinaus das entsprechende Diagnoseverfahren, das angewendet wurde, um die angebliche Erbkrankheit festzustellen. Darüber hinaus wird geschildert, wie das Verfahren im Fall einer Zwangssterilisation generell ablief, zeigt also auf, welche Institutionen und Personen darin verwickelt waren, wie zum Beispiel das Wiesbadener Gesundheitsamt, das für die meisten Antragsstellungen in der vorliegenden Arbeit verantwortlich zeichnete.
Im Vergleich dazu zurückhaltend verhielten sich hingegen niedergelassene Mediziner und Angehörige anderer Medizinalberufe, obwohl auch sie verpflichtet waren, ihnen »bekannte« Erbkranke beim Gesundheitsamt zu melden, um dadurch das Zwangssterilisationsverfahren einzuleiten. Neben diesem Personenkreis waren auch – wie bereits erwähnt – Mitarbeiter von Behörden, insbesondere solchen, die mit Menschen zu tun hatten, die sozial auffällig oder wirtschaftlich vom Staat abhängig waren und den Nationalsozialisten daher als fortpflanzungsunwürdig erschienen, aufgefordert, Männer und Frauen zu melden, die als potenzielle Sterilisanden in Frage kamen. Tatsächlich haben vor allem Sozialbehörden, wie zum Beispiel das Wohlfahrtsamt, aber auch Hilfsschulen oder Institutionen, die Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen zu betreuen hatten, darunter...