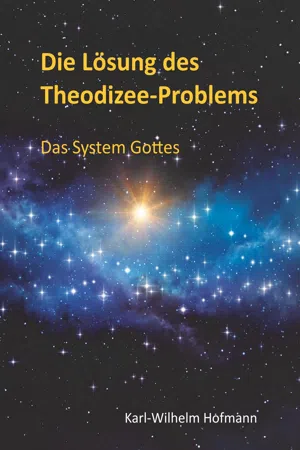![]()
F Zweifelsfragen
Das von mir vorgestellte System Gottes ist ein in sich schlüssiges, widerspruchsfreies System. Dennoch bleiben offene Fragen, z. B. wie das Zusammenspiel zwischen unserer Seele und unserem Gehirn genau funktioniert. Im Folgenden gehe ich auf einige Fragen ein, die der Leser möglicherweise genauer beantwortet haben möchte.
F 1 Zwei Fundamente der kirchlichen Lehre
a. Vorbemerkungen
Zwei wesentliche Säulen der christlichen Lehre sind die Erbsünde und die Sühnetheologie. Nach der Erbsünde wird der „Ursündenfall“ von Adam und Eva fortlaufend auf alle Nachkommen vererbt. Wegen dieser Erbsünde ist jeder Mensch grundsätzlich rettungslos verloren. Hier greift nun die Sühnetheologie: Jesus Christus erlöst die Menschen aus ihrer aussichtslosen Situation, indem er durch seinen Opfertod die Sünden der Menschen, inklusive Erbsünde, auf sich nimmt. Er erlöst die Menschen, weil er durch seinen Opfertod Gott mit den Menschen versöhnt. Jesus „sühnt“ für die Sünden der Menschen. Sowohl die Lehre von der Erbsünde als auch die Sühnetheologie gehen auf Paulus zurück. Bei Paulus handelt es sich um den früheren „Saulus“, einen gefürchteten Christenverfolger, der, erst nachdem ihm Jesus erschienen ist, zum „Paulus“ wurde (Apg. 9,1–19). Das Neue Testament wird neben den vier Evangelien von der Apostelgeschichte und den insgesamt vierzehn Briefen des Paulus an verschiedene Gemeinden beherrscht. In diesen Briefen hat Paulus seine „Paulinische Theologie“ entwickelt, deren Eckpfeiler die Erbsünde und die Sühnetheologie sind.
Für die Beurteilung und Gewichtung der Thesen von Paulus ist wichtig, dass er Jesus zu dessen Lebzeiten niemals persönlich begegnet ist. Er ist ihm nur durch dessen „Erscheinen“ bekannt. Nach der Schilderung in Apg. 9,1–19 gab ihm Jesus dabei auf, von der Verfolgung der Christen abzulassen und stattdessen seine (Jesu) Botschaft in aller Welt zu verkünden. An keiner Stelle ist etwas darüber ausgesagt, dass Paulus von Jesus den Auftrag erhalten hätte, seine (Jesu) Botschaft zu ergänzen oder zu erweitern. Immer wenn sich Paulus auf Jesus oder Gott beruft, verweist er auf die in der Apostelgeschichte geschilderte Erscheinung Jesu, dessen „Offenbarung“ an ihn und dass er das Evangelium Jesu verkünden solle, vgl. z. B. Gal. 1,11–24, Eph. 3,1–13. Jesus hat aber „sein“ Evangelium zu seinen Lebzeiten den Jüngern vorgelebt und gepredigt. Da Paulus Jesus nicht persönlich erlebt hat, hätte es deshalb nahegelegen, sich Informationen über „Jesu Botschaft“ von den Menschen zu holen, die Jesu Wirken persönlich, aus nächster Nähe, miterlebt haben, also den Jüngern. Nach eigenem Bekenntnis hat Paulus jedoch den Kontakt zu den Jüngern Jesu weitestgehend gemieden, Gal. 1,16–19. Woher wusste Paulus also so genau, was er verkünden sollte? Denkbar ist, dass er dieses Wissen durch die von ihm behaupteten „Offenbarungen“ von Jesus erhalten hat, sozusagen in einer Art „Schnellkurs“. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass Jesus dem Paulus „mehr“ offenbart hat als zu seinen Lebzeiten den Jüngern. Denn dann hätte Jesus seine Mission nicht ganz erfüllt. Er hätte „vergessen“, den Jüngern noch etwas mit auf den Weg zu geben. Dass dem Gottessohn ein solches „Missgeschick“ passiert, ist unglaubwürdig. Aber selbst wenn es so wäre, hätte es weitaus mehr Sinn gemacht, diese zusätzlichen Informationen nachträglich den Jüngern kundzutun und nicht dem „Outsider“ Paulus. Die Glaubwürdigkeit der Thesen des Paulus ist deshalb daran zu messen, ob er das verkündet, was Jesus gelehrt hat, oder ob er etwas „Zusätzliches“ lehrt, das in den vier Evangelien keine Grundlage hat.
Generell entsteht beim unbefangenen Lesen der Evangelien einerseits und der Paulusbriefe andererseits der Eindruck, dass hier zwei völlig verschiedene Lehren beschrieben werden. Während Jesus eine Theologie der Liebe, der Barmherzigkeit und der Vergebung verkündet, predigt Paulus die Erbsünde und Jesu Sühnetod. So, als hätten Jesus und seine Botschaften gar nicht existiert. In Paulus’ Briefen kommen Jesu Worte und Taten auch nicht vor. Eine Auseinandersetzung mit dessen Wirken findet nicht statt. Paulus predigt, dass Jesus Gottes Sohn war und zur Rettung der Menschen deren Sünden durch seinen Opfertod auf sich genommen hat. Der „Lehrauftrag“ von Jesus an die Jünger war dagegen ein völlig anderer. Im Missionsbefehl hat Jesus diesen Auftrag eindeutig formuliert (Mt. 28,16–20): „… Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe …“ (Hervorhebung durch den Autor). Da gibt es keinen „Interpretationsspielraum“ mehr. Es ist überdeutlich gesagt, was die zu verkündende Botschaft ist. Die Jünger sollen die ihnen von Jesus vermittelten Verhaltensregeln und Werte in die Welt hinaustragen und an ihre Nachfolger weitergeben. Keinerlei Aussagen darüber, warum Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist, und insbesondere auch kein Wort davon, dass die Jünger irgendetwas von einem Sühne- oder Opfertod Jesu lehren sollten. Die von Paulus verkündete Lehre ist somit seine eigene Interpretation von Jesu Tod. Die Jünger hielten sich zunächst strikt an Jesu Auftrag und verkündeten ausschließlich das, was sie mit Jesus erlebt hatten, vgl. z. B. die Rede von Petrus in Cäsarea, Apg. 10,34–48. Erst allmählich schlich sich auch in ihre Verkündigung, abweichend von ihrem Auftrag, die Sühnetheologie des Paulus ein. Warum Paulus mit seiner Sühnetheologie selbst bei den Jüngern so erfolgreich war, werde ich weiter unten aufzeigen. Hier gilt es zunächst festzuhalten, dass die von Paulus gepredigte Theologie nicht im Einklang mit den Evangelien steht und deshalb äußerst kritisch zu betrachten ist.
Die Zweifel an Paulus werden zusätzlich dadurch erhärtet, dass er Thesen lehrte, die mit Sicherheit nicht auf Jesu Offenbarung basieren. So wertet er z. B. die Frau gegenüber dem Mann ab: 1. Kor.11,3–9, 1. Kor. 14,34–35, Eph. 5,22–24. In seiner Staatslehre ist die weltliche Macht immer von Gott eingesetzt und vollzieht deshalb auch ein gerechtes (göttliches) Strafgericht an all denen, die sich nicht der weltlichen Macht beugen, Röm. 13. Jesus lehrte dagegen etwas ganz anderes: „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“, Mk. 12,17. Und in der Apostelgeschichte verkündet auch Petrus die gegenteilige Auffassung: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“, Apg. 5,29. Unterschiedlicher können die Botschaften nicht sein.
Bei sorgfältiger Bewertung dieses Sachverhalts wiegen deshalb die in den Evangelien verbrieften Worte Jesu allemal mehr als die von Paulus. Die Kirche hat anfangs durchaus darum gerungen, ob sie den Evangelien oder deren Interpretation durch Paulus folgen soll. Denn schon früh wurden die Widersprüche und Ungereimtheiten der paulinischen Theologie erkannt. So ging z. B. der Mönch Pelagius gegen die Erbsünde und die Sühnetheologie an, war damit jedoch nicht erfolgreich.
Beleuchten wir nun die Lehre von der Erbsünde und die Sühnetheologie im Detail.
b. Die Erbsünde. Gibt es sie?
Nach der christlichen Lehre überträgt sich die allererste Sünde (der Sündenfall durch Adam und Eva) durch Fortpflanzung auf jeden Menschen. Durch diese Erbsünde ist jeder Mensch, unabhängig davon, wie er sein Leben lebt, von Geburt an schuldig.47 Die Erbsündenlehre geht eindeutig auf Paulus zurück, der sie sozusagen „exklusiv“ entwickelt hat. Die „klassische Beweisstelle“ stammt aus dem Brief des Paulus an die Römer, Röm. 5,12–21. „Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam … Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist …“ Außer in den Briefen des Paulus finden sich in der Bibel kaum Stellen, mit denen die Erbsünde begründet werden könnte. Insbesondere hat Jesus an keiner Stelle in diese Richtung gelehrt. Die katholische Kirche führt noch Ps. 51,7 an: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ Zu dieser Bibelstelle später mehr.
Da der Rest der Bibel somit wenig für die Erbsündenlehre hergibt, war es auch innerhalb der Kirche lange umstritten, ob Paulus’ Position richtig ist. Besonders die Anhänger des Mönchs Pelagius (ca. 350–420), die Pelagianer, lehrten, dass die Sünde Adams keineswegs durch Vererbung auf seine Nachkommen übergeht, sondern durch Nachahmung, also einen eigenen, persönlichen Akt. Augustinus (354–430) vertrat die Gegenposition und entwickelte die von Paulus begründete Lehre weiter. Sie wurde von der Kirche schließlich auf den Synoden von Mileve (416), Karthago (418), Orange (529) und Trient (1546) als verbindliche Lehrmeinung festgelegt. Gegenteilige Auffassungen, so auch die des Pelagius, wurden zur Ketzerei erklärt.48
Es ist eindeutig, dass Paulus zum Zeitpunkt seines Briefes an die Römer die Schöpfungsgeschichte und die Schilderung des Sündenfalls in 1. Mose wortwörtlich für wahr hielt. Nur vor diesem Hintergrund konnte er zu seinen Aussagen in Röm. 5,12–21 kommen. Wir wissen inzwischen, dass die Menschheit nicht von Adam und Eva abstammt und der biblische Schöpfungsbericht nur symbolisch zu verstehen ist. Die Basis, aus der Paulus die Lehre abgeleitet hat, ist deshalb erwiesenermaßen falsch. Die Evolutionstheorie hat der Lehre von der Erbsünde die Grundlage entzogen.
Das entscheidende theologische Argument gegen die Erbsünde ist jedoch ein anderes: Die Lehre steht im Gegensatz zu den durch die Bibel verbrieften Eigenschaften Gottes. Gott ist ein gerechter und liebender Gott. Zu diesen Eigenschaften passt es nicht, eine Sippenhaft zu begründen. Gottes Liebe und die Erbsünde sind nicht kompatibel. Es ist erstaunlich, dass dieser Widerspruch Paulus nicht selbst aufgefallen ist. Denn gerade er war auch ein großer Verfechter der Liebe Gottes. Wunderbar seine entsprechende Darstellung in 1. Kor. 13,4 ff. Möglicherweise hat er diesen Widerspruch jedoch bewusst ausgeblendet, weil er die Erbsünde unbedingt als Begründung für seine Sühnetheologie benötigte (siehe unten). Denn ohne Erbsünde macht diese Theologie wenig Sinn.
Da Paulus’ Erbsündenlehre somit sowohl den Erkenntnissen der Naturwissenschaften (Evolutionstheorie) als auch Gottes Liebe widerspricht, ist sie als irrige Einzelmeinung von Paulus abzulehnen und zu verwerfen.
Obwohl es somit keine Erbsünde gibt, komme ich nach dem von mir in diesem Buch vorgestellten System scheinbar zu dem gleichen Ergebnis wie die Kirche, nämlich dass jeder Mensch bereits als „Sünder“ geboren wird. Also doch eine bei Geburt ererbte Sünde? Wie passt das zusammen? Ein Schuh wird deshalb daraus, weil mein Ergebnis völlig anders begründet ist und nicht das Geringste mit der Erbsünde zu tun hat. Die Lehre der Erbsünde besagt im Kern, dass jeder Mensch bereits als Sünder in das Erdenleben hineingeboren wird, weil die „Ursünde“ ohne eigenes Tun auf ihn vererbt wird. Er persönlich hat sie nicht begangen. Der Aussage, dass jeder Mensch als Sünder in das Erdenleben hineingeboren wird, stimme ich zu. Der Grund dafür ist jedoch ein völlig anderer. Unser Aufenthalt auf der Erde ist die Folge eines persönlich von uns begangenen Vergehens, einer „Sünde“, im Jenseits. Wir werden deshalb als „Straftäter“, als Sünder geboren. Nicht, weil die Sünde auf uns vererbt wurde, sondern weil wir sie selbst im Jenseits begangen haben. Wegen dieses persönlichen Vergehens werden wir aus dem Jenseits, dem „Paradies“, vertrieben, sind wir zum „Stubenarrest“ auf der Erde und werden schon „als Sünder“ geboren. Die in der Bibel dargestellte Vertreibung von Adam und Eva aus dem (immateriellen) Paradies erleidet somit jede auf die Erde verbannte Seele individuell aufgrund eines eigenen Vergehens. Zu meiner Theorie passt durchaus auch die von der Kirche für ihre Position reklamierte Bibelstelle in Ps. 51,7: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ Es kommt eben auf den Blickwinkel an, aus dem man eine Bibelstelle interpretiert. Die von der Kirche vertretene Position ist somit nur „äußerlich“ mit der meinigen identisch. Meine Position ist jedoch völlig anders begründet und die Konsequenzen sind deshalb auch völlig unterschiedlich.
c. Die Sühnetheologie. Ist sie haltbar?
Nach der traditionellen Lehre der Kirche ist das Erscheinen Jesu Christi ein Akt der Liebe und der Gnade Gottes, den die Menschen eigentlich wegen ihrer Verdorben- und Sündhaftigkeit nicht verdient haben. Schon wegen der Erbsünde sind die Menschen rettungslos verloren. Jesus versöhnt Gott durch seinen freiwilligen Opferkreuzestod mit den Menschen. Er befreit sie aus ihrer Sündhaftigkeit, weil er die Sünden der Menschen an deren Stelle auf sich nimmt.49
Auch diese so genannte „Sühnetheologie“ geht exklusiv auf Paulus zurück. Die wichtigste „Beweisstelle“ findet sich in Paulus’ Brief an die Römer: Röm. 3,24 und 25: „… durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut als Sühneopfer, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit.“ Weitere Stellen in Paulusbriefen sind z. B. 2. Kor. 5,19: „Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“ Kol. 1,20: „… und alles durch ihn (Jesus) versöhnt würde mit Gott, … dadurch dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz.“ Hebr. 9,12: „Er ist ... durch sein eigen Blut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“
In den Texten der Evangelien finden sich dagegen kaum Stellen, mit denen die Sühnetheologie begründet werden könnte. So sagt Johannes der Täufer, Joh. 1,29: „Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!“ An anderen Stellen in den Evangelien wird gesagt, Jesus werde die Menschen „retten“ bzw. „erlösen“. Auf welche Art und Weise, bleibt offen. Mt. 1,21: „… denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“
Jesus selbst nennt als Grund für sein Kommen, Lk. 19,10: „Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ Mt. 9,13: „… Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.“ Joh. 3,17: „Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“ Der sich daran anschließende Satz deutet an, dass es nicht auf ein Blutopfer am Kreuz ankommt, sondern dass die „Rettung“ auch so aussehen könnte, dass man Jesu Lehre und Handeln als Vorbild nimmt und an ihn „glaubt“: „Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ Ob Jesu Worte beim Abendmahl auf einen Sühnetod hinweisen, ist fraglich. Die zusammenfassende Gesamtschau der Schilderungen des Mahls in den vier Evangelien legt eher nahe, dass dem nicht so ist. Bei Markus und Lukas spricht Jesus lediglich davon, sein Blut werde für uns vergossen, Mk. 14,24, Lk. 22,20. Der Zusatz „zur Vergebung der Sünden“ erscheint nur bei Matthäus, Mt. 26,27. Bei Johannes wird das Abendmahl dagegen völlig anders dargestellt. Dort ist der zentrale Vorgang, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Die Einsetzungsworte „für uns vergossen …“ zu Brot und Wein fehlen völlig, Joh. 13.
Die Analyse der Evangelien ergibt somit, dass dort nur spärliche Hinweise auf ein Sühneopfer Jesu zu finden sind. Eine explizite Sühnetheologie wird in den Evangelien eindeutig nicht überliefert. Insbesondere hat sich Jesus selbst nicht in diese Richtung geäußert. Es handelt sich somit um eine von Paulus außerhalb der Botschaften Jesu zusätzlich, von ihm entwickelte Lehre. Wie kam Paulus zu dieser Lehre und weshalb war er selbst bei den Jüngern damit so erfolgreich? Der Schlüssel für die Antwort liegt in der Erwartungshaltung der Juden gegenüber dem erwarteten „Messias“. Von ihm wurde erwartet, dass er das Reich Davids wieder aufrichte und insbesondere die verhassten Römer vertreibe, vgl. z. B. Mt. 22,41–45. Erwartet wurde also ein mächtiger (weltlicher) Messias, der mit den üblichen (militärischen) Mitteln alles regelt. Das war auch die Erwartung der Jünger, vgl. z. B. Joh. 1,41–45, die sie sogar noch nach Jesu Tod hatten, vgl. Apg. 1,6. Jesu Auftreten und seine Botschaft waren mit dieser Erwartung nicht deckungsgleich. Ganz im Gegenteil. Keine Spur von der Vertreibung der Römer oder der Errichtung eines neuen mächtigen jüdischen Königreichs. Statt dessen: „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“, Mk. 12,17, oder: „Und wer dich schlägt auf eine Backe, dem biete die andere auch dar“, Lk. 6,29. Bis zuletzt haben die Jünger diesen Widerspruch nicht wirklich verstanden. Möglicherweise hat Judas Jesus nur deshalb verraten, weil er Jesus auf diesem Weg zwingen wollte, endlich seine Macht zu zeigen und sich der Verhaftung zu entziehen. Bekanntermaßen führte auch das nicht zu dem von Judas erwarteten Ergebnis. Es passte einfach nicht in die Vorstellungswelt der Jünger, dass Gottes Sohn, der Messias, hilf- und wehrlos am Kreuz starb. Und dass Jesus Gottes Sohn war, davon waren die Jünger fest überzeugt. Die Jünger hatten somit einen Erklärungsnotstand. Sie mussten für sich selbst und für die Erfüllung des Missionsbefehls eine einleuchtende, griffige Erklärung für Jesu schmachvollen Tod finden. Auferstehung schön und gut. Aber wem nutzte das letztendlich irgendetwas, außer Jesus selbst? Die Auferstehung änderte nichts an der tristen irdischen Lage unter römischer Besatzung. Was konnte der Ausweg aus diesem Dilemma sein?
An dieser Stelle ist die historisch-kritische Exegese hilfreich. Die Evangelien nennen keinen eindeutigen Grund für das Erscheinen Jesu. Es kann deshalb erforscht werden, ob es vor 2000 Jahren kulturelle Hintergründe, gesellschaftliche Strömungen, Überzeugungen gab, die zu einer Lösung des Problems beitragen k...