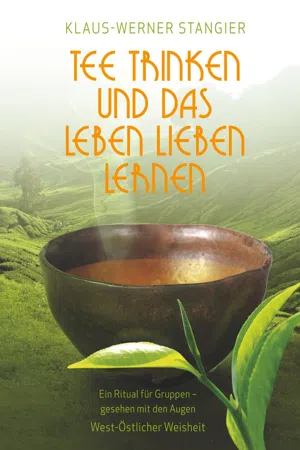![]()
1. Zur Einführung
Tea trifft Tcha
persönliche Vorbemerkungen und darüber hinaus / mit westlichen Augen eine fernöstliche Übung verstehen?
„Dearest You are cordially invited to afternoon tea for a very special bride-to-be. Come and sit for me and we'll have high tea and talk of things that were and things that are to be. We'll get dressed up, what fun it will be to celebrate the bride, celeste, our lessy.
High Tea will be $23 and will include all the cake, sandwiches, tea and coffee you can possibly consume. It will be held at Panorama Cafe at the Royal Pines (Ross Street, Benowa.) Please come dressed up and gorgeous as always!
Please RSVP no later than 27th of March so we can arrange the catering numbers. We look forward to seeing you there!!“
Solche Einladungen hat es im Lauf der Geschichte nicht nur in England, sondern auch und zunächst einmal in China oder Japan gegeben. Die höhere Gesellschaft feiert sich, zeigt, wer sie ist, was sie hat, sie genießt und ist exklusiv. Eingeschlossen sind alle Sorten von Kuchen und Schnittchen und wem Tee nicht genügt, für den gibt es auch noch Kaffee, eine Grenze wird nur durch das Fassungsvermögen des Magens gesetzt. Diese üppige barocke Expansion ruft unmittelbar nach dem Gegenpol, der sich in der Einfachheit und Bescheidenheit einer japanischen Teezeremonie entfaltet.
In Japan als Gast begrüßt zu werden, meint bei guten Freunden, ein heißes Bad genießen zu dürfen - in jedem Fall, eine Schale Tee zu empfangen; bei besonderen Anlässen von einer Teemeisterin oder einem Teemeister zubereitet und gereicht. Höflich erkundigte sich bei einem meiner Aufenthalte die Teemeisterin, gut informiert, dass der westliche Gast aus einer christlichen Tradition kommt, nach einem kleinen weißen Tuch, dass katholische Christen bei der Eucharistiefeier zum Reinigen des Kelches benutzen. Sie vergleicht es mit dem chakin der Teezeremonie, einem kleinen weißen Trockentuch. Wir werden ihm noch begegnen beim Trocknen der Teeschale. Eine ältere Frau aus dem Rheinland bemerkte bei Gelegenheit, sie gehe gerne bei einem bestimmten Pfarrer in den Gottesdienst: „der tut die Messe so schön!“ Und das wiederum tue ihr gut. Und sie meint damit, dass er die wenigen Handreichungen bei der Kommunion, wenn Wein und Wasser eingefüllt, getrunken und die Geräte anschließend gesäubert werden, nicht nur flott und funktional, sondern aufmerksam und konzentriert vollzieht.
Tee zuzubereiten habe ich bei Sokan in Kyoto gelernt. Sokan ist Zen-Priester, leitete damals eine Gemeinde am Stadtrand von Kyoto, spricht Deutsch, ist ein gelehrter Mann, der uralte chinesische Texte übersetzt und kommentiert und sich gut auskennt in der deutschen Philosophie des Idealismus. Deutsch hat er unter anderem mit Hilfe von Fernsehkassetten gelernt, aufgenommen wohl in Süddeutschland, denn er spricht nicht von Brötchen, sondern von Semmeln. Heute steht er dem Eigen-ji Kloster in der Präfektur Shiga als Abt vor.
Von Sokan habe ich gelernt, dass Teemeister zu sein oder zu werden eine Lebensaufgabe ist, nicht nur existentiell, es gilt auch, eine Menge über japanische Kunst, Keramik, Architektur, Geschichte und letztlich auch eine neue Sprache zu lernen. Die größte Herausforderung besteht darin, das dann im Vollzug zu lassen und lediglich da zu sein. Die heilende Kraft der reinen Gebärde, D., 1970, S.48 die Karlfried Graf Dürckheim der aufmerksam vollzogenen Handreichung zuschreibt, findet ihre Weise in der Zubereitung und im Trinken von Tee. Ich habe begonnen, eingewiesen und ermutigt durch Sokan, Elemente der Teezeremonie im Stil von Omotesenke zu übernehmen und eine Form zu entwickeln, die mehrere Menschen in der Zubereitung und im Genuss von Tee zusammenführt. Omotesenke ist eine neben andern Formen der Teezubereitung in Japan, eine der ersten Formen. Erste Informationen sind über das Internet zugänglich.
Lange Zeit habe ich darunter gelitten, Zentexte nicht im Original lesen zu können. Westliche Leser.innen sind darauf angewiesen, aufzunehmen, was andere oft auch selbst aus zweiter Hand übernommen haben und mitteilen. Vielfach sind englische Übersetzungen Grundlage für deutsche Texte. Angeregt und ermutigt vor allem durch die Begegnung mit Menschen aus der Zentradition habe ich mich auf die Suche gemacht nach vergleichbaren Erfahrungen in der westlichen Tradition. Gibt es ähnliche Erfahrungen, Übungsformen, Rituale und Berichte? Auch diese westlichen, scheinbar so nahe liegenden Texte, sind bei näherem Zusehen nur beschränkt zugänglich, sie sind immer noch verschlüsselt, auch durch die eigene, persönliche Sprache der Autoren und Autorinnen und geprägt durch den Geist einer vergangenen Zeit. Möchte man östliche und westliche Tradition ins Gespräch bringen, dann ist das außerdem nur in dem Umfang des eigenen Eindringens in die Materie möglich. Das gilt gleichermaßen für das tiefere Verstehen von Übungen wie auch von Texten. Ich ahne, wie beschränkt dieses Vertrautwerden mit dem Fremden ist und lerne auch zunehmend begreifen, wie bruchstückhaft das Endringen in die eigene Tradition ist.
Hier wird dennoch der Versuch unternommen, eine japanische Übungsform westlich orientierten Menschen zugänglich zu machen. Denkt man darüber nach, wie das geschehen kann, dann wird der Turm von Fragen immer höher. Wie fremd sind sich doch östliche und westliche Tradition! Mutig könnte man sich entschließen, mehr oder weniger naiv die Übung anzugehen und zu sagen: komm und experimentiere! - Naiv meine ich hier im Sinn von unbefangen, offen, nicht vorbelastet durch Erfahrungen, die andere gemacht haben. Im Sinn des Anfängergeistes kann das ein guter Zugang sein. Andererseits liegt ein reicher Schatz an Ritualen und Übungsformen vor, er kann genutzt werden – und will auch gelernt werden.
Beim näheren Hinsehen fällt auf, dass der vorliegende Übungsaufbau nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Gefüge der Omotesenke-Tradition sein kann. Ich vertraue darauf, dass für die Wirkung der Übung nicht die große Zahl der Übungselemente, sondern die Größe der Aufmerksamkeit und die achtsame Wiederholung auch eines kleinen Übungsumfanges ausschlaggebend sind.
Wer sich auf den Weg macht, die östliche Tradition zu verstehen, stößt sich ab, braucht eine Basis, die den Druck des Abstoßens aushält, eine Basis, die auch die Kraft und Ermutigung für den Schritt gibt. Der Schritt wird so getragen von der dankbaren Erinnerung an die eigene Herkunft. So prägt die jüdisch-christliche Tradition den Blick in die neue Richtung. Die westliche Kultur ist eher patriarchal geprägt, sonnenhaft trifft sie auf eine dem Mond zugetane Kultur. Weiblich, mütterlich geht es ihr mehr um Beziehung als um kognitive Begriffe und Inhalte – aber auch manch Vertrautes begegnet in der Fremde. Formen und Inhalte westlicher Weltsicht lassen sich im Zen-Buddhismus wiederfinden, aber auch die Unterschiede zwischen Ost und West werden mit der Zeit deutlicher. Da ist z.B. der Unterschied zwischen einem linearen Zeitverständnis, in dem es Anfang und Ende gibt, die Erschaffung der Welt und ihre Vollendung am Ende der Zeiten, und einem zirkularen Verständnis, in dem sich die Zeit in der Wiederholung erfüllt, wie es der östlichen Philosophie vertraut ist. Andererseits kennt aber auch die philosophische Tradition des Westens schon in der Antike eine Beschäftigung mit dem kreisenden Wiederkehren der Zeit. Friedrich Nietzsche hat mit dem ihm eigenen Engagement Thesen in diese Richtung formuliert.
Also sprach Zarathustra: „Und diese langsame Spinne, die im Mondschein kriecht, und dieser Mondschein selber, und ich und du im Torwege, zusammen flüsternd, von ewigen Dingen flüsternd, müssen wir nicht alle schon da gewesen sein - und wiederkommen [...] müssen wir nicht ewig wiederkommen?“
Nietzsche, 1997, Bd II, S. 409
Sind sich Kulturen im zeitlichen und räumlichen Abstand auch zutiefst fremd, so sind dennoch überall auf der Welt Menschen auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Austausch und vor allem gemeinsames Üben und Leben sind im Wissen um bleibende Fremdheit möglich. Das gemeinsame Tun ermöglicht eine je eigene Weise zu verstehen.
Das wird deutlich bei der Verwendung des Begriffs der Teezeremonie. Eine Zeremonie kennt einen Zeremonienmeister. Das ist so am königlichen Hof in London wie im liturgischen Raum der Kathedrale. Da wirkt jemand mit, der weiß, wie es zugeht und er achtet darauf, dass alles seine Ordnung hat. Der Gottesdienst im Petersdom kennt eine möglichst unauffällige aber für jeden ersichtliche stille Leitung, die dafür sorgt, dass das Ritual auch rite et recte abläuft. Zeremonie signalisiert etwas Feierliches, ein Ritual, ein aus dem alltäglichen Fluss heraus gehobenes Ereignis.
So das Teetrinken zu beginnen, hieße es mit Vorstellungen zu überhäufen und unnötig zu belasten. Dann kann es nur noch darum gehen, Erwartungen zu erfüllen, Vorstellungen zu bestätigen und richtig und falsch zum Maßstab zu machen. Umgekehrt kann es aber sein, dass ein einfaches, möglichst voraussetzungsloses Tun und Beisammensein die Wirklichkeit für Momente öffnet und erschließt - worauf das Wort Zeremonie hindeutet. Ich spreche, um den Blick frei zu setzen für das, was geschieht, lieber und lediglich vom Teetrinken.
Rite et recte kennt das Teetrinken aber trotz alledem auch: so wird´s gemacht, alles andere ist falsch. Wir werden uns mit der Falsch-Richtig-Falle noch ausgiebig beschäftigen.
Gewählt habe ich für die Zubereitung des Tee Utensilien, die für Europäer leicht zugänglich sind, Teebesen und Schöpflöffel, beide aus Bambus, sind ohne Mühe zu erwerben. Auch der grüne Tee aus Blättern, der neben dem Pulvertee verwendet wird. Weshalb überhaupt Gerät aus Japan? Porzellan aus dem bayrischen Wald und Besteck aus Solingen täten es doch auch! So ist es. Wenn dennoch ungewohnte Werkzeuge benutzt werden, dann der Fremdheit wegen. Die Fremdheit ermöglicht einen bewussteren Umgang mit den Dingen und die ästhetische Vollendung der Teegeräte schärft den Formsinn.
Meine Dankbarkeit für die Begegnung mit Menschen, die mir die Lebensweise des Zen und das Teetrinken nahe gebracht haben, ist tief und herzlich. Ich bin auf sie gestoßen in Japan, in Kyoto und im Kloster Eigenji und ebenso im Westen, vor allem in Todtmoos-Rütte. Ob die Unterscheidung in Ost und West auch eine Unterscheidung der Vermittlung aus erster und zweiter Hand beinhaltet? Ich meine, Nein. Zentral für die Öffnung der Augen und des Herzens, oder bescheidener gesagt: für den Beginn des Weges in die Fülle des Nichts sind die Begegnung mit Menschen, die ein selbstverantwortetes Leben führen, ferner der eigenen Neugier folgen sowie der Bereitschaft, im Übergang zu leben. Auf diesem Weg wird im Osten wie im Westen das Herz gebildet und beseelt.
Auf die Bedeutung von bislang eingeführten Begriffen wie Fülle des Nichts, Selbstverantwortung, Neugier, Übergang und Herz komme ich noch zurück. Wir stoßen hier auch auf die grundlegende Bedeutung der Sprache. Inwieweit Sprache das Erleben nicht nur prägt, sondern überhaupt erst als Erfahrung ermöglicht, wird hier nicht erörtert, es würde den Rahmen sprengen. Ich möchte aber auf die Bedeutung der Sprache hinweisen.
Leitend für das deutende Erschließen des Teetrinkens ist in erster Linie die westliche Tradition. Die Erfahrungen und Reflexionen abendländischer Theologen und Philosophen können das, was beim Teetrinken geschieht, auf ihre Weise erhellen und aufschließen. Ihre Worte sind auch eine Einladung, eine eigene Sprache zu entwickeln. Diese wird dann zunächst einmal als eine Fremdsprache in den westöstlichen Dialog eintreten. Im gemeinsamen tatenfreien Tun findet der Dialog seine Vollendung.
Zunächst ein Blick auf den Tee. Worte ermöglichen allerdings nur eine unzureichende Begegnung mit der Köstlichkeit, die es zu riechen und zu schmecken gilt.
Es wird erneut deutlich, dass das Buch nur motivieren möchte, den Tee in der Realität des Alltags zuzubereiten, seinen Duft aufzunehmen, den Geschmack zu kosten und mit andern zu teilen.
![]()
2. Grüner Tee
zwei Handelswege, zwei Namen / weit hinab in die Vergangenheit / ein glücklicher Fund / Lebensbedingungen / wachsen lassen und schneiden / ernten / genießen und gesunden
Göttlicher Klang umgibt die beiden Pflanzennamen, die Urformen des Teegewächses, aus denen alle heutigen Teesorten entwickelt wurden: Thea Camellia sinensis und Thea Camellia assamica. "Sinensis" steht dabei für das ursprüngliche Verbreitungsgebiet: China. Die Blätter dieser Pflanze sind klein, eher hart und stark aromatisch, der Ertrag ist niedrig. "Assamica" steht für den indischen Bundesstaat Assam, in dem diese Teeart 1830 entdeckt wird. Ursprünglich hat diese Sorte große, weiche Blätter, ihr Aroma ist nicht so ausgeprägt, sie sind empfindlich gegen Trockenheit und Kälte und liefern hohe Erträge. Eine freie Etymologie könnte aus Thea eine Doppelgöttin machen, eine Göttin mit zwei Gesichtern, Thea Camellia sinensis assamica. Die Pflanze jedoch ist nicht nur göttlich, sie verbindet vielmehr Himmel und Erde, sie vereint Licht und Tau des Himmels mit fruchtbarem Boden, sie ist die gewachsene Einheit von göttlich und irdisch und die gewordene Einheit aus Natur und Kultur. Der Name „Tee“ hat die deutschsprachigen Länder über die Niederlande erreicht und hat seinen Ursprung in einem südchinesischen Dialekt, dem minnanischen. Der Name Tee kam ins westliche Europa, da der Teetransport dorthin meist auf dem Seeweg von Südchina aus erfolgte. Persien, die Türkei und Russland wurden auf dem Landweg vom Norden Chinas aus beliefert, sie haben die Bezeichnung cha, ein Wort der chinesischen Hochsprache, des Mandarin, übernommen. Man sagt, dass der Landweg dem Tee früher besser bekam, da er nicht der salzigen Luft und Feuchtigkeit der Seereise ausgesetzt war.
Wenn wir mit Tee in Berührung kommen, dann ertasten wir eine feine Ader, die tief in die Vergangenheit zurückführt. Schon 5000 Jahre vor Christus soll die Teepflanze in China bekannt gewesen sein, ein Busch, ein Baum unter vielen zunächst, anonym, voller Aroma und belebender Kraft, verborgen und unbekannt. Bis es eines Tages geschah, dass jemand auf die Blätter aufmerksam wurde, vielleicht ein Zufall. Vielleicht hat der Duft der Blätter die Menschen aufmerksam gemacht. Denn mindestens so bedeutend wie der Geschmack ist der Duft, den die Blätter verströmen. Vielleicht tauchte die Pflanze aber auch im Blickfeld eines neugierigen und aufmerksamen Menschen auf, der Heilkräuter suchte. Eine Entdeckung mit unabsehbaren Folgen.
Das Teeblatt hat einen Siegeszug durch die Welt angetreten, war Zeuge unzähliger Gespräche, Zeuge auch einsamer Stunden, ermutigend, wärmend, tröstend, heilend, beruhigend, voller Hingabe, Einladung zum Genuss und Erwachen.
Was braucht die Pflanze zum Wachstum? Wir finden sie heute in den Hochlagen der Tropen und Subtropen. China und Indien sind die Hauptproduzenten, sie liefern etwa die Hälfte der Weltp...