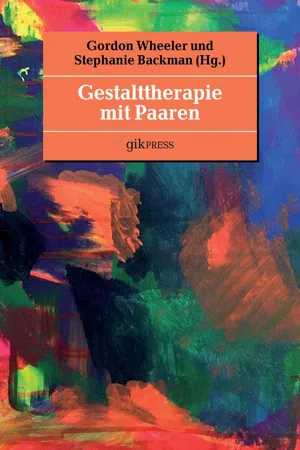
eBook - ePub
Gestalttherapie mit Paaren
- 388 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Gestalttherapie mit Paaren
Über dieses Buch
International anerkannte PraktikerInnen der Gestalttherapie berichten über ihre Arbeit mit Paaren und gehen dabei auf wesentliche Themen wie Intimität, Scham und das Geben und Nehmen in Paarbeziehungen ein.Sie nehmen verschiedene Klientengruppen in den Blick und berichten unter anderem auch über die therapeutische Arbeit mit heterosexuellen, schwulen und lesbischen Paaren, mit wiederverheirateten Paaren und mit Traumaüberlebenden und Missbrauchsofpern.Ein Buch nicht nur für TherapeutInnen (und solche, die es werden wollen), sondern ganz ausdrücklich auch für Interessierte und Betroffene.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Gestalttherapie mit Paaren von Gordon Wheeler, Stephanie Backman, Gordon Wheeler,Stephanie Backman im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Geschichte & Theorie in der Psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
11
Scham bei Paaren: ein unbeachtetes Thema
Robert Lee
Tom saß gerade und aufrecht auf seinem Stuhl und wirkte ziemlich abgespannt, als er sich zu Beginn der zweiten Therapiesitzung vorwurfsvoll an Claire wandte: »Es ärgert mich, daß du zu spät gekommen bist. Kannst du denn nicht einmal pünktlich sein?« Ohne ihn anzuschauen antwortete Claire verächtlich: »Warum bist du bloß so kleinlich mit der Zeit? Es waren doch nur zehn Minuten. Kannst du das nicht mal ein bißchen locker sehen?«
An diesem Punkt unterbrach ich die beiden, aber wir können uns vorstellen, wie diese Unterhaltung weitergegangen wäre, wenn ich das nicht getan hätte. Tom hätte vielleicht gesagt: »Das ist typisch. Zuerst bist du unpünktlich, und dann gibst du mir die Schuld.« Und vielleicht hätte Claire geantwortet: »Du bist genau wie dein Vater, steif wie ein Brett.« Daraufhin hätte Tom sagen können: »Zumindest bin ich nicht verantwortungslos – wie deine Familie. Ich stehe zu meinen Verpflichtungen, und außerdem bin ich nicht so verschwenderisch.« Und Claire hätte sagen können: »Aber ich, ja? Ich nehme an, du spielst auf neulich abends an, als du zu knauserig warst, mit mir essen und ins Kino zu gehen«, woraufhin Tom hätte antworten können: »Du willst ja nur Geld ausgeben. Du hältst dich wohl für was Besseres.« Und Claire hätte ihm entgegnen können: »Du bist doch ein Weichei. Du traust dich einfach nicht, deinen Chef nach einer Gehaltserhöhung zu fragen; dann könnten wir uns nämlich einen angemessenen Lebensstil leisten.« An diesem Punkt hätte einer von beiden vielleicht angefangen, den anderen anzuschreien oder wäre wütend rausgegangen.
Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, wie Tom und Claires Unterhaltung hätte weitergehen können, und zudem eine, die für beide problematisch gewesen wäre. Andere Möglichkeiten hätten sein können, daß einer von beiden sich zurückgezogen, die Kontrolle an sich gerissen oder mit Strafen, körperlichen Symptomen oder Zwanghaftigkeit reagiert hätte usw. Solche Kommunikationsformen sind bei Paaren, die in Schwierigkeiten stecken, nicht unüblich. In der Arbeit mit diesen Paaren können wir es mit strukturellen oder strategischen Interventionen versuchen oder auch systemische und historische Interpretationen heranziehen. Aber angesichts eskalierender Konflikte zwischen Partnern bleiben selbst unsere raffiniertesten Ansätze häufig erfolglos. Diese Erfahrung kennt jeder von uns allzugut. Was passiert hier? Wie kommt es, daß diese Interaktionen auf so destruktive Weise außer Kontrolle geraten?
Wenn wir mit Paaren wie Tom und Claire, die sich in so plötzlich auftretenden, explosiven Eskalationen verstricken, unser Tempo etwas verlangsamen und ihre Interaktion genauer untersuchen, stellen wir fest, daß die zugrundeliegende, unausgesprochene Dynamik Scham ist. Die Scham bringt Tom und Claire dazu, ständig übereinander und nie von sich selbst zu sprechen. Und die Scham ist es auch, die jedem Vorwurf den Beigeschmack der Demütigung verleiht. In anderen, ähnlich gelagerten Situationen zwischen Paaren kann die Scham dazu führen, daß die Partner den Rückzug und die Flucht nach innen antreten, starre Regeln aufstellen, um die Kontrolle zu bewahren oder körperlich aggressiv, dominant und/oder gewalttätig werden.
Das Problem bei der Arbeit mit Scham besteht darin, daß sie äußerlich kaum jemals sichtbar ist. Was wir beobachten können, sind die defensiven Verhaltensweisen, hinter denen die Partner sich zu verstecken und dem Erleben der Scham zu entkommen versuchen, wie etwa die verzweifelten Mittel (einschließlich der Gewalt), die sie ergreifen, um die unerträgliche Scham von sich selbst auf ihre Partner zu verlagern. In solchen, aber auch in weniger dramatischen Situationen kann ein Verständnis der Scham uns helfen, das Durcheinander in der Interaktion der Partner zu entwirren, das oft wie ein unlösbarer Knoten erscheint.
Scham beim einzelnen
Was ist Scham, und warum nimmt sie in unserem Leben einen so bedeutenden Platz ein? Die Allgegenwärtigkeit der Scham in der menschlichen Erfahrung spiegelt sich wider in der Vielfalt ihrer Namen: Schüchternheit, Peinlichkeit, Chagrin, Demütigung, geringes Selbstwertgefühl, Sich-lächerlich-Fühlen, Verlegenheit, Bekümmertsein, Irritation, Erniedrigung, Schmach, Schande, Kränkung, Degradierung, Unsicherheit, Mutlosigkeit, Schuld – und diese Liste ließe sich noch fortsetzen (Kaufman, 1989; Lewis, 1971; Retzinger, 1987). Von den vielen theoretischen Ansätzen, die sich mit dem Phänomen Scham auseinandergesetzt haben (vgl. Jordan, 1989; Lewis, 1971; Lynd, 1958; Nathanson, 1992; Tomkins, 1963), harmoniert die Theorie von Kaufman und Tomkins (Kaufman, 1989; Tomkins, 1963) aufgrund ihrer theoretischen Klarheit und phänomenologischen Begründung am besten mit der organismischen und kontextualistischen (Ich-Du) Weltsicht der Gestalttheorie.
Tomkins geht davon aus, daß Scham einer von neun angeborenen Affekten ist und damit zur Überlebensausrüstung gehört, mit der jeder Mensch von Geburt an ausgestattet ist. Die Funktion der Scham besteht nach Tomkins (1987) darin, die Affekte zu regulieren, die er als Interesse-Aufregung und Freude-Vergnügen bezeichnet. »Wenn das Verlangen stärker ist als die Erfüllung, so daß das Interesse abnimmt, ohne dabei jedoch zerstört zu werden, ist das Erleben von Scham für jeden Menschen unvermeidlich« (1963). Daher ist Scham in ihrer einfachsten Form als Schüchternheit und Peinlichkeit ein natürlicher Prozeß der Retroflektion oder der Zurückhaltung, und damit eine Schutzfunktion des Lebens. Die Scham schützt unseren persönlichen Raum in Bereichen wie Freundschaft, Liebe, Spiritualität, Sexualität, Geburt und Tod und bildet einen Schutzschild für den andauernden Prozeß der Selbst-Integration (Schneider, 1987). Mit Hilfe der gestalttheoretischen Perspektive können wir diese normale Schutzfunktion der Scham etwas anders beschreiben. Hier wird der Mensch als einer gesehen, der an der Grenze zwischen innerer und äußerer Welt verhandelt, konstruiert und forscht. So betrachtet kann Scham ein Signal dafür sein, daß der Zustand der Verbindung an der Grenze zwischen mir und meiner Welt bedroht ist oder Aufmerksamkeit verlangt. Insofern kann die Scham mich zur Zurückhaltung veranlassen, wie in Tomkins Modell, oder sie kann bewirken, daß ich mich dem anderen und seinem Bedürfnis mir gegenüber zuwende – möglicherweise um den Preis des zeitweiligen Verlustes meiner Fähigkeit des Selbstausdrucks. (Deshalb hilft uns der Gestaltansatz, die kreative Verbindung zwischen Scham und »Koabhängigkeit« zu sehen. Wenn ich »koabhängig« bin, gilt meine Aufmerksamkeit fast ausschließlich dem anderen, den ich unterstütze, um selbst gesehen zu werden, und das bedingt eine notorische Einschränkung meines Selbstausdrucks.)
Dies ist im großen und ganzen die gesunde Seite der Scham. Sobald die Scham aber in Form von Scham-Bindungen (Kaufman, 1989) internalisiert wird, gerät ihre natürliche Funktion aus dem Gleichgewicht und wirkt dadurch mitunter selbst zerstörerisch. Obwohl dieser Prozeß sich in jeder Lebensphase abspielen kann, beginnt er doch meistens während der Kindheit. Wenn die Sorgepersonen nicht in der Lage sind, beim Kind ein bestimmtes Bedürfnis, ein Gefühl oder eine Absicht zu erkennen, zu akzeptieren und angemessen darauf zu reagieren, hilft die normale Scham dem Kind, sich aus dem Kontakt zurückzuziehen, der auf die Erfüllung dieses Bedürfnisses oder Wunsches abzielt. Wiederholt sich dieser Prozeß oft genug oder hat er traumatische Qualität, dann entsteht eine innere Verbindung oder Kopplung zwischen der Scham und diesem speziellen Bedürfnis, Gefühl oder der Absicht (Kaufman, 1989). Die Unfähigkeit der Sorgeperson, angemessen bzw. überhaupt auf das Kind einzugehen, kann mit ihrer Reaktion auf die eigene internalisierte Scham zusammenhängen, vielleicht sogar mit der Unfähigkeit, zwischen dem Temperament und den Fähigkeiten des Kindes und den eigenen Fähigkeiten zu unterscheiden. In jedem Fall wird das Kind, sobald es dieses Bedürfnis oder diesen Drang später wieder verspürt, automatisch auch Scham empfinden. Im Laufe der Zeit und mit zunehmenden Schamerfahrungen geht das Bewußtsein des ursprünglichen Gefühls oder Bedürfnisses verloren; was bleibt, ist die Scham (Kaufman, 1989). Dadurch verliert das Kind die »Stimme« für diesen Teil seiner selbst – ein Teil seines Selbst ist abgespalten oder ausgeschaltet. Dieser Stimmverlust ist eine Reaktion auf die reale Erfahrung oder »Umweltbedingung«, daß niemand diese Stimme hört. Der Verlust der Stimme wird von einem Gefühl der Entfremdung und Unterlegenheit, der Unverbundenheit und der Wertlosigkeit begleitet. Dieses Gefühl der Entfremdung und Unterlegenheit ensteht aber nicht nur aufgrund der Erfahrung, daß die Stimme schambesetzt und nicht wert ist, gehört zu werden, sondern auch, weil selbst dann, wenn jemand kommt und bereit ist, zuzuhören, es dem Kind ohne diese Stimme viel schwerer fällt, dem anderen mitzuteilen, wer es ist. All dies ist Teil der Erfahrung internalisierter Scham.
Aus gestalttheoretischer Sicht stellt dieser Stimmverlust, diese Schambindung, ein negatives Introjekt dar, eine angenommene Überzeugung oder internalisierte Botschaft über das Selbst, die Welt und die Möglichkeiten zum Kontakt. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Negative Introjekte sind Schambindungen. Wenn wir die Scham verstehen, dann verstehen wir auch das Wesen negativer Introjekte.
Es ist unmöglich, keine Schambindungen zu entwickeln. Die kulturelle Unterstützung der Kindererziehung in unserer Gesellschaft basiert zum großen Teil auf Scham. Wenn sich bei Mädchen ein Gefühl für Konkurrenz in der Welt entwickelt, werden sie häufig beschämt – »Nette Mädchen sind nicht vorlaut« (Gilligan, 1982). Und Jungen werden häufig mit ihren Gefühlen von Kummer, Traurigkeit und der Scham selbst beschämt – »Große Jungen weinen nicht« (Balcom, 1991). Tatsächlich sind in unserer Kultur die Geschlechterrollen so eng mit der Scham verknüpft, daß fast jedes von der Geschlechterrolle abweichende Fühlen oder Verhalten mit großer Wahrscheinlichkeit als beschämend angesehen oder erlebt wird.
Jede Situation, in der die Gefühle oder Wünsche eines Menschen oder seine Art, in der Welt zu sein, konsequent übersehen oder ignoriert und nicht bestätigt oder respektvoll beantwortet werden, kann Schambindungen erzeugen. Dies geschieht vor allem in hierarchisch strukturierten Beziehungen, in denen einer auf den anderen angewiesen ist, um versorgt zu werden und Schutz (oder auch Macht) zu erhalten, wie in Eltern-Kind-, Lehrer-Schüler-, Trainer-Spieler-, Supervisor-Supervisand-, Therapeut-Klient- und Arzt-Patient-Beziehungen. In solchen Beziehungen kann die Macht entweder mißbraucht werden, oder ihr konstruktiver und einfühlsamer Gebrauch gerade dann, wenn es erforderlich wäre, ausbleiben oder fehlschlagen. Dasselbe gilt für die Erfahrung schwerer Verluste. Die schwerwiegendsten Schambindungen gehen auf traumatische Erfahrungen wie sexuellen oder körperlichen Mißbrauch, Verwahrlosung und schwere Verluste durch Krieg usw. zurück. Die Scham geht Hand in Hand mit der posttraumatischen Belastungsstörung.
Wir alle haben zumindest einen unbewußten Zugang zu diesem Prozeß, was sich im Englischen z.B. in den spontanen Äußerungen zeigt, die wir angesichts der Krankheit oder des Verlustes eines anderen Menschen machen: »What a shame!« (»Wie schrecklich«) Wenn wir uns dieses kulturelle Wissen einmal vergegenwärtigen, dann stellen wir fest, wie häufig wir darauf zurückgreifen und es mit einer ganzen Reihe von Situationen verbinden, die mit Verlust und Elend zu tun haben, und zwar vom Trivialen bis hin zum Tragischen, angefangen damit, daß wir den Bus verpassen, bis hin zu Situationen, in denen wir mit dem Grauen des Krieges konfrontiert werden. Ich denke an eine Klientin, der schmerzlich bewußt wurde, daß ihr neuer Freund sie immerzu kontrollieren wollte, um mit den Unterschieden zwischen ihnen fertigzuwerden. Sie führte dieses Verhalten darauf zurück, daß er als kleiner Junge damit fertigwerden mußte, daß sein Vater sehr plötzlich gestorben war und seine Mutter in ihrer Hilflosigkeit anfing, unklare und chaotische Forde...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Inhaltsverzeichnis
- Gordon Wheeler: Vorwort - Der Gestaltansatz im Kontext
- Die Herausgeber
- Die Autorinnen und Autoren
- Gordon Wheeler: Einführung - Warum Gestalt?
- Teil I: Theorie
- Teil II: Praxis
- Teil III: Perspektiven
- Stephanie Backman: Epilog - Der ästhetische Blickwinkel
- Anhang: Praxisadressenliste - Gestalttherapeutinnen & Gestalttherapeuten für Paare
- Weitere Informationen
- Zur Künstlerin des Covers: Georgia von Schlieffen
- Impressum