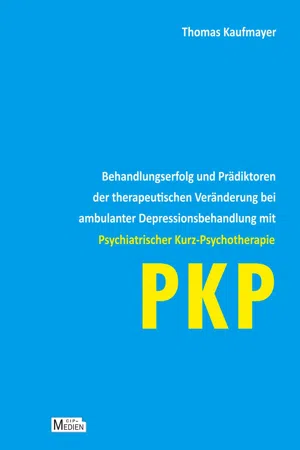
eBook - ePub
Behandlungserfolg und Prädiktoren der therapeutischen Veränderung bei ambulanter Depressionsbehandlung mit Psychiatrischer Kurz-Psychotherapie
PKP
- 236 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Behandlungserfolg und Prädiktoren der therapeutischen Veränderung bei ambulanter Depressionsbehandlung mit Psychiatrischer Kurz-Psychotherapie
PKP
Über dieses Buch
Es besteht eine fundierte Befundlage, dass die Psychiatrische Kurz-Psychotherapie (PKP) bei der Behandlung von Depression wirksam ist. Gegenanzeichen waren in Teilen gering oder nicht vorhanden. Kontrollierte randomisierte Untersuchungen stehen noch aus. Empfehlungen für zukünftige Forschung werden beschrieben.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Behandlungserfolg und Prädiktoren der therapeutischen Veränderung bei ambulanter Depressionsbehandlung mit Psychiatrischer Kurz-Psychotherapie von Thomas Kaufmayer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Geschichte & Theorie in der Psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Trotz der Häufigkeit, mit der depressive Störungen in der Allgemeinbevölkerung angetroffen werden, kommt es oft zu langen Wartezeiten in ambulanten und stationären Settings, auch einhergehend mit einer Nicht- oder Spätbehandlung von depressiven Erkrankungen. Die Situation lässt sich in folgenden Zahlen abbilden: Patienten mit Depression bilden den größten Anteil im psychiatrischen Versorgungssystem. Fast jeder fünfte Mensch in der Bundesrepublik Deutschland erlebt zumindest einmal in seiner Lebensspanne eine depressive Phase (DGPPN, 2015). Im Zeitraum zwischen 1997 und 2014 stieg die Anzahl von beruflichen Fehltagen aufgrund von Depression und anderen psychischen Erkrankungen um 209 % (DAK, 2015). Depression ist häufig eine wiederkehrende psychische Erkrankung (Fava & Kendler, 2000), die Remissionsraten sind unterschiedlich, z.B. bei einer einjährigen Behandlung mit Antidepressiva zwischen 17 % bis 35 % (Ansseau et al., 2009). Im sehr gravierenden Fall nehmen Depressionen einen tödlichen Ausgang und führen bei etwa 15 % der schwer depressiven Menschen zum Suizid (Angst, Angst & Stassen, 1999; Hautzinger, 2010).
Äußerliche Bedingungen können bei einer Depression als auslösende und aufrechterhaltende Faktoren fungieren. So leben wir heute in einer Zeit, in der unter anderem Leistungsstreben und Erhalt von Anerkennung in wirtschaftlichen, zwischenmenschlichen und sozialen Kontexten eine Triebfeder darstellt. Schnelllebigkeit, geringe Achtsamkeit gegenüber der eigenen Person und der Umwelt sowie sich daraus entwickelnde Belastungen und Konflikte können bedingende Variablen für depressive Erkrankungen darstellen, ebenso Schicksalsschläge oder körperliche Erkrankungen. Zu Anfang kann dabei eine Depression einen kaum bemerkbaren Krankheitsverlauf einnehmen; relevante Risikofaktoren wie Überforderung, Stresserleben, Unzufriedenheit und Verlust der Freude können zunächst übersehen werden. Im Störungsverlauf einer klinisch relevanten Depression entsteht dann ein Zustand, welcher als stark belastend und stark einschränkend erlebt wird. Oft erst, wenn die depressive Erkrankung fortgeschritten ist und beispielsweise in stärkere Antriebslosigkeit, Schlaf- und Appetitveränderungen oder sogar Suizidgedanken mündet, wenden sich die Betroffenen an ihren Hausarzt oder begeben sich in professionelle psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung (Wittchen, Höfler & Meister, 2000).
Dass im Behandlungssetting dann oft mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, überrascht Betroffene. Diese Suche nach einem geeigneten und finanziell tragbaren Therapieplatz kann erkrankte Personen nicht nur überfordern, sondern auch deren Behandlungsmotivation verringern. Viele Leitlinienbehandlungen werden angeboten, jedoch bleiben etwa drei Viertel der depressiven Störungen unbehandelt (Bertelsmann-Stiftung, 2014). In diesem Zusammenhang taucht auch die Forderung auf, therapeutische Konzepte zur Behandlung von beispielsweise depressiven Erkrankungen in engeren zeitlichen Rahmen durchzuführen und deutlich schneller zugänglich zu machen. Dies steht auch vor dem Hintergrund eines volkswirtschaftlichen Interesses. Durch Depressionen entstehen dem Gesundheitssystem in Deutschland Kosten von mehreren Milliarden Euro jährlich (Statistisches Bundesamt, 2015). Die Zahlen ähneln denen in anderen westlich geprägten Industrieländern und es besteht steigendes Interesse und die Relevanz, wirksame und effiziente Therapiemethoden der Versorgung zur Verfügung zu stellen.
Einen Therapieansatz, der seit mehr als zwanzig Jahren in der psychotherapeutischen Praxis angewandt wird, ist die Strategische Kurzzeittherapie (SKT) nach Sulz (1994), die später umbenannt wurde und heute als Strategisch-Behaviorale Therapie (SBT) angewendet wird. Dieses Konzept verfolgt das Ziel einer effizienten Behandlungsmethode, unter anderem von depressiven Störungen. Der verhaltenstherapeutisch orientierte Ansatz integriert nach Sulz und Hauke (2010) Aspekte unter anderem der Emotionspsychologie (Sulz & Lenz, 2000), der Persönlichkeits- (Sulz, 2001) und Entwicklungspsychologie (Sulz & Höfling, 2010). Studien zur SBT zeigen gute Ergebnisse in Bezug auf die Effizienz und Effektivität in der Minimierung von Symptomen bei unterschiedlichen Krankheitsbildern in Form von Achse-I-, also klinischen Störungen und Achse-II-Störungen wie Persönlichkeitsstörungen (Sulz & Hauke, 2010).
In dieser Arbeit soll die Wirksamkeit einer aus der Weiterentwicklung dieser Behandlungsmethode heraus entstanden Therapie der third wave Bewegung in der Psychotherapie untersucht werden, die Psychiatrische Kurz-Psychotherapie (PKP). Dieses Therapiekonzept wurde entwickelt, um Anforderungen nach verkürzter und effektiver Therapiezeit entgegenzukommen. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis und zur Anwendbarkeit der PKP bieten und Ergebnisse liefern, die den therapeutischen Effekt der PKP in der Behandlung von depressiven Störungsbildern abbilden.
1.1 Aufbau der Arbeit
Um eine verbesserte Lesbarkeit zu erreichen wird in dieser Arbeit auf eine kombinierte Verwendung von männlichen und weiblichen Sprachformen verzichtet. Die Personenbezeichnungen sind jedoch stellvertretend und gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlechter.
Die vorliegende Arbeit teilt sich in einen theoretischen Abschnitt, einen empirischen Teil und eine Diskussion. Um zunächst Einblick in die Grundlagen der durchgeführten Studie zu vermitteln, wird im Theorieteil Information über Psychotherapie mit besonderem Augenmerk auf die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), die Strategisch-Behaviorale Therapie (SBT) und die Psychiatrische Kurz-Psychotherapie (PKP) dargestellt. Eingegangen wird dabei auf die Wirksamkeit von ambulanten und stationären psychotherapeutischen Behandlungskonzepten. Neben der Darstellung des Forschungsstands in der Psychotherapieforschung erfolgt eine vergleichende Darstellung von empirischer Forschung und klinischer Praxis. Weiter wird über die Theorie der Emotionsregulation und die Theory of Mind berichtet und eine Übersicht zur affektiven Erkrankung Depression dargestellt. Neben Basisinformationen werden dort Entstehungsbedingungen, Aspekte der Diagnosestellung sowie differenzialdiagnostische Fragestellungen beschrieben. Es wird ein Zusammenhang mit Suizidalität sowie ein Überblick über aktuelle Behandlungsansätze von Depression gezeigt. Die der Untersuchung zugrundeliegenden Fragestellungen und die daraus abgeleiteten Hypothesen schließen die theoretischen Abhandlungen ab.
Der empirische Teil befasst sich zunächst in Kapitel 3 mit der Methodik der Studie und beschreibt das Studiendesign sowie den Untersuchungsablauf. Anschließend werden die Stichprobe beschrieben, die allgemeinen Ein- und Ausschlusskriterien definiert und deskriptiv-statistische Erläuterungen vorgenommen. Zudem erfolgt eine Analyse der Diagnoseverteilung, die Beschreibung der Dropoutraten sowie die des zeitlichen Verlaufs der Therapien. Im Weiteren werden die verwendeten Messinstrumente sowie statistische Methoden der Datenanalyse dargestellt. Einen Hauptteil der Empirie stellen die in Kapitel 4 präsentierten Ergebnisse dar, wo deskriptive Resultate, Gruppenunterschiede und Effektstärken der untersuchten therapeutischen Methode beschrieben werden. Im Diskussionsteil unter Kapitel 5 findet eine Interpretation der Ergebnisse und eine Einbettung in die aktuelle Forschung statt. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der durchgeführten Studie sollen hier Denkanstöße gegeben und Aspekte von möglichen zukünftigen Forschungsvorhaben diskutiert werden.
1.2 Einordnung und Zielsetzung
Die kognitive Verhaltenstherapie im Allgemeinen gilt als vergleichbar junge Richtung der psychotherapeutischen Behandlungsansätze, sie zeichnet sich durch ihre konkrete, regelgeleitete Arbeitsweise aus. In dieser psychotherapeutischen Methode ist es möglich und vorgesehen, konkret und lösungsorientiert an den Problemen des Patienten zu arbeiten. Die Strategisch-Behaviorale Therapie (Sulz, 1994) im Speziellen gilt als erfolgreiche Therapie der third wave-Bewegung in der kognitiven Verhaltenstherapie, mit der eine stärkere Beachtung von Emotionen in der therapeutischen Arbeit in den Fokus rückte. Die Interventionstechnik der third-wave Therapien gilt nach der empirischen Datenlage als gut fundiert und umfasst beispielsweise Konfrontationsverfahren, Entspannungs- und körperbezogene Techniken sowie achtsamkeitsbasierte Verfahren (Kahl, Winter & Schweiger, 2012). Die SBT selbst kann durch reges Forschungsinteresse hinsichtlich ihrer Wirksamkeit als empirische abgesichert gelten, sie befindet sich seit mehr als zwanzig Jahren in praktischer Verwendung und unterliegt einer weiten anwendungsbezogenen Verbreitung bei der Behandlung von Achse-I- und Achse-II-Störungen (Hebing, 2012).
Zunehmend ist in der Behandlungspraxis eine Annäherung verschiedener Therapieschulen zueinander zu beobachten. Dies birgt die Möglichkeit, dass psychotherapeutische Behandlungen multimodal und integrativ gestaltet werden können.
Hier ordnet sich die Psychiatrische Kurz-Psychotherapie (PKP) ein. Diese aus der Weiterentwicklung der SBT (Sulz, 1994; Sulz & Hauke, 2010) entstandene Therapiemethode wurde 2012 durch die Arbeitsgruppe um den Begründer der SBT, Sulz, entwickelt. Basierend auf der SBT und unter Integration weiterer als wirksam erwiesener Therapiemethoden soll sie sowohl im ambulanten als auch im stationären Setting zur Behandlung von verschiedenen Störungsbildern Anwendung finden. Die PKP arbeitet mit gedrucktem Kartenmaterial, den sogenannten Sprechstundenkarten (SSK). Ziel ist dabei unter anderem, den Behandlungsverlauf zu strukturieren und die Behandlung in einem zeitlich kompakten Rahmen durchzuführen. Die PKP zeichnet sich durch grundsätzliche Regelgeleitetheit und ihre vergleichbar einfache Handhabung und Durchführung aus und versucht, über eine starke Symptomorientierung in der Behandlung möglichst effizient zu intervenieren. Prinzipiell soll dieser therapeutische Ansatz Therapiemöglichkeiten auch dort zur Verfügung stellen, wo ein zeitlich begrenzter Rahmen existiert, zum Beispiel in hausärztlichen und psychiatrischen Praxen.
Die hier durchgeführte Studie liegt in ihrer naturalistischen Ausrichtung nahe am Versorgungsalltag und kann der Phase IV-Forschung zugeordnet werden. Ihr liegt eine Feldforschungsausrichtung zu Grunde, womit ein hoher Grad an Generalisierbarkeit zu erwarten ist. In Literatur und psychotherapeutischer Praxis wird gefordert, dass Therapiemethoden stetig weiterentwickelt und verbessert werden sollen. Anhand vieler randomisiert-kontrollierter Studien (Phase III-Forschung) ist Psychotherapie in der Versorgung psychischer Störungen allgemein legitimiert (Lambert & Ogles, 2004). Hier soll eine Untersuchung der Wirksamkeit der PKP unter Praxisbedingungen stattfinden.
Insgesamt soll die vorliegende Arbeit einen weiteren Schritt zur Evidenzbasierung von verhaltenstherapeutischen Methoden zur Behandlung von Depression liefern und auch zeigen, dass Verhaltenstherapie unter Annahme einer flexiblen Regelgeleitetheit wirksam ist. Das untersuchte Vorgehen stellt einen kurzzeittherapeutischen Behandlungsansatz dar. Es wird die Frage behandelt, ob signifikante therapeutische Veränderungen bei einer ambulant durchgeführten Psychiatrischen Kurz-Psychotherapie von Depression entstehen und welche Prädiktionsfaktoren für einen guten und nachhaltigen Behandlungserfolg auszumachen sind.
2 Theorie
Der theoretische Teil befasst sich zunächst mit dem aktuellen Stand der Psychotherapieforschung im Bereich Verhaltenstherapie sowie mit einer grundlegenden Darstellung zur Erkrankung Depression. Es wird ein Einblick in die theoretischen Grundlagen der Arbeit gegeben und die Forschungshypothesen werden dargestellt.
2.1 Aktuelle Forschungsergebnisse zu Verhaltenstherapien
Nach einer allgemeinen Einführung zur Psychotherapieforschung wird ein Überblick über den wissenschaftlichen Kontext bei Verhaltenstherapien gegeben. Es wird dabei auf Grundaspekte von verhaltenstherapeutischen Therapien eingegangen, der Stand der derzeitigen Forschung aufgezeigt und der Behandlungsansatz der SBT als spezifische Form der Verhaltenstherapie eingeordnet. In Weiterentwicklung der SBT, teilweise durch Integration weiterer psychotherapeutischer Ansätze, wurde die PKP entwickelt, die darauffolgend dargestellt wird. Weiterhin wird die Bedeutung von Emotionen in der Psychotherapie beleuchtet und das Konzept der Theory of Mind beschrieben.
2.1.1 Therapieforschung, Wirkung und Nebenwirkung von Psychotherapie
Das Ziel der Psychotherapieforschung ist die Erforschung von Wirksamkeit und Wirkweise psychotherapeutischer Verfahren. Die Forschungsergebnisse sollen dabei für die praktische therapeutische Anwendung Information liefern (Grawe, 1997). Durch mehrere Metaanalysen und systematische Reviews gilt die allgemeine Wirksamkeit von Psychotherapie als belegt, weitgehend ohne Einschränkung der Therapieschule oder des Settings, die Wirkfaktoren von Therapien sind dabei neben den inhaltlichen Therapieaspekten unter anderem die Hoffnung auf Heilung und die therapeutische Beziehung (Franz & Frank, 2007). Wie Psychotherapie exakt wirkt, konnte insgesamt jedoch bisher nur unzureichend erklärt werden (Wampold et al., 1997), wobei es wichtig ist, die Datenlage unter Hinzuziehung von oft vorliegenden komplexen differenzialtherapeutischen Aspekten zu betrachten.
Wirksamkeit von Psychotherapie lässt sich in Effektstärken ausdrücken. Nach Cohen (1988) bestehen Bereiche von kleinen Effekten ab einer Effektstärke von 0.20, von mittleren Effekten ab 0.50 und große Effekten ab einem Wert von 0.80. Ergebnisse zur Wirkung von Psychotherapie sind im Bereich von mittleren bis großen Effekten angesiedelt. So fanden Smith et al. (1980) in einer Metanalyse eine durchschnittliche Effektstärke von 0.85, mit engeren Forschungskriterien von Shadish el al. (1997) korrigiert auf einen Wert von 0.60. Lipsey und Wilson (1993) berichten in einer Sammlung von Metanalysen eine mittlere Effektstärke von 0,47.
Für die Therapieforschung sind ebenfalls Einflüsse auf die Therapieergebnisse durch die Therapeutenpersönlichkeit und durch Faktoren, die der Patient mitbringt, von Interesse. So belegen Untersuchungen, dass bestimmte depressive Patienten innerhalb eines therapeutischen Settings schneller Fortschritte zeigen als andere (Hardy et al., 2001). Solche Wirkungsunterschiede können nicht vollständig durch einzelne Settingformen, wie Individual- oder Gruppensetting oder ambulante oder stationäre Psychotherapie erklärt werden (National Collaborating Center for Mental Health, 2004). Als Ursachen hierfür kommt in Frage, dass einige depressive Patienten in der prämorbiden Belastung, in Persönlichkeitsanteilen und durch die individuellen Lebensgeschichten stärker eingeschränkt sind als andere. Dies steht vor dem Hintergrund von Disposition und biografischen Lebensereignissen, wie beispielsweise (frühkindlichem) Missbrauch, häuslicher Gewalt oder traumatischen Erlebnissen. Ferner spielen intrapsychische Vorgänge, die Ausprägung von Selbstreflexionsbereitschaft und -fähigkeit, von psychosozialen Kompetenzen und gegenwärtigen beziehungsbezogen Probleme eine Rolle (DGPPN, 2015). Nach Caspar & Jacobi (2005) ist die Forschung jedoch noch stark entwicklungsbedürftig, was Merkmale über die Diagnose als moderierende Variable hinaus angeht.
Weiter ist in der Psychotherapieforschung die Komponente der Wirtschaftlichkeit der Therapie von Bedeutung. Psychotherapie kann dabei finanziell günstiger sein als eine andere medizinische Behandlung und die Krankheitsfolgekosten werden reduziert (Baltensperger & Grawe, 2001). Bezüglich der Wirtschaftlichkeit von Psychotherapie spielt die Dosis-Wirkungs-Beziehung, d.h. die Menge an eingesetzter Therapie für das Erreichen eines bestimmten Ergebnisses, eine wichtige Rolle. Dabei existiert ein positiver Zusammenhang zwischen Therapiedauer und Veränderung (Cartwright, 1955), der Veränderungszuwachs nimmt jedoch mit zunehmender Therapiedauer ab, das bedeutet, mehr Therapie hilft mehr, jedoch helfen frühere Therapieeinheiten mehr als spätere (Kopta et al., 1994). Wichtig in Bezug auf die Ökonomie von Therapien ist die Frage danach, welche Therapiemenge ausreichend ist. Hierzu fanden Lambert und Ogles (2004) in einer Metaanalyse verschiedener Dauer-Wirkungs-Studien, dass bis zu einer Therapiedauer von 20 Sitzungen die Hälfte der Patienten noch nicht klinisch hinreichend verbesserte Werte aufweist. Ein weiteres Viertel der Patienten benötigte mehr als 50 Therapiestunden um eine wesentliche Veränderung der Symptome signifikant messbar zu machen. Howard et al. (1993) gehen von einem dreiphasigen Veränderungsmodell in Psychotherapien aus, nachdem sich nach dem Wohlbefinden die Symptomatik, dann die allgemeine Funktionsfähigkeit steigert. Aktuellere Metaanalysen (Cuijpers, 2014; Johnsen & Friborg, 2015) kommen zum Ergebnis, dass erfolgreiche Psychotherapien und Pharmakot...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Zusammenfassung
- Abstract
- Key words
- Inhaltsverzeichnis
- II Tabellenverzeichnis
- III Abbildungsverzeichnis
- IV Verzeichnis der Anhänge
- V Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorie
- 3 Methodik
- 4 Ergebnisse
- 5 Diskussion
- 6 Literaturverzeichnis
- 7 Anhang
- Danksagung
- Impressum