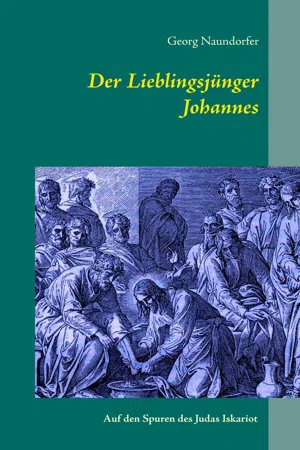![]()
Das Evangelium des Johannes
Mit dem sich zunehmend konkretisierenden Konsolidierungsprozess des Judentums und der damit verbundenen, sich nun stärker abzeichnenden Zurückweisung der Pläne des Johannes, die Christen wieder mit dem Judentum zu vereinigen, wird Johannes auch persönlich in die Defensive gedrängt. Um mit seinen Konzepten nicht isoliert zu werden, sucht er einen Ausweg. Dabei bietet sich ihm das Christentum an, was er kennt, und in dem er akzeptiert ist, ungeachtet seiner Bemühungen, es wieder ganz im Judentum aufgehen zu lassen.
Er entnimmt ihm die noch nicht ganz zu Ende entwickelte Idee des Gottessohnes und baut sie für sich passend nun endgültig aus, um einen erneuten Anlauf auf die Macht zu starten. Was dabei entsteht ist Das Evangelium nach Johannes. Dieses Johannes-Evangelium weicht nun nicht nur inhaltlich, im Bezug auf das Leben Jesu, sondern vor allem von der geistigen Konzeption her völlig von den Synoptikern ab.
Es steht jetzt gleichberechtigt neben den anderen drei, grenzt sich aber deutlich von ihnen in einer Art ab, die man schon von der Anlage her als übergeordnet empfinden soll. Die inhaltlichen Überschneidungen erscheinen uns, obwohl die Evangelien sich handlungsmäßig alle gleichen, nur gering.
Dieses Evangelium beginnt jetzt in einer bombastischen Sprache, die ganz abgehoben und überirdisch, ganz vergeistigt und mystisch daherkommt. Diesen Text muss man sich nun in einer hohen Tempelhalle von der getragenen Stimme eines stimmgewaltigen Priesters vorgetragen denken, während ein gläubiges Publikum ihm atemlos lauscht. Da ist nichts Irdisches mehr. Es täuscht die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Welt vor, ist aber in Wirklichkeit, auf den tatsächlichen Inhalt reduziert, etwas ganz anderes.
Als zuletzt erarbeitete Unterlage ist es mit seiner schon einführend aufgesetzten abgehobenen und geheimnisvollen Mystik nichts, was zu einer Religion passt, die von Wanderpredigern auf den Plätzen dem Volk vermittelt werden soll. Dahinter steckt höhere Theologie. Es macht Gott zu einer Sache, die über uns herrscht und uns schützt, was am deutlichsten aus dem Beginn des Anfangskapitels hervorgeht (Joh. 1,1-18). Es ist ein Evangelium für Schriftgelehrte. Die Gleichnisflut und auch die der Wunder, mit der uns die Synoptiker überschütten fehlen hier. Sie sind nicht mehr nötig. Das Johannes-Evangelium wendet sich an den gefestigten Gläubigen, der mehr von Gott wissen will. Der erste Eindruck beim Anlesen dieses Evangeliums: Es ist allein der Verherrlichung Jesu zum Gott gewidmet. Die erzählten Vorgänge scheinen ins Überirdische entrückt. Vorkommende Menschen sind schon durch ihre Erwähnung geheiligt. Alles unterliegt einem Sinn, der Vorsehung und Gottes unerforschlichem Ratschluss. An dieses Evangelium geht man normalerweise mit dem Vorurteil heran: Vom Menschen Jesus von Nazareth erfahren wir nur noch, dass es ihn gab, und zwar als Hülle für Gottes Sohn. Vom Rabbi Jehoshua erfahren wir nichts mehr. Waren die Jünger bisher nur Statisten und Stichwortgeber, dann finden wir nun nur noch einen Hofstaat von Heiligen.
Das ist aber nur so, wenn es durch die erst später daraus entwickelte geistige Brille der paulinischen Verheißungen unseres Glaubens gelesen wird und damit ein großer Irrtum. Es steht durchaus etwas von dem Menschen Jesus in diesem Evangelium, vielleicht sogar einiges zu viel. Auch von seinen Jüngern steht dort manchmal mehr, als uns lieb sein kann. Dieses Evangelium führt uns aber an einen Jesus heran, der typisch für die Denkweise des Johannes ist und es scheint über weite Strecken auch von einem Augenzeugen verfasst zu sein, der uns geradezu demonstrativ vermitteln will, dass er Augenzeuge war.
Dieses Evangelium ist wohl anfangs in Unkenntnis der Dinge, die es uns tatsächlich vermittelt, in den Kanon der Kirche hineingenommen worden, und als man entdeckte, was wirklich darin steht, hätte man es gern wieder herausgenommen. Weil es aber als einzige der bis dahin erstellten schriftlichen Unterlagen die theologisch saubere und auch widerspruchsfreie Herleitung der Legende vom wahren Sohn Gottes enthielt, ließ man es im Kanon. Die Anordnung der katholischen Kirche, den Laien die Bibellesung zu verbieten, und auch das Verbot der Übersetzung der Bibel in die Volkssprache, hatten schon ihre nachvollziehbaren Gründe. Man flickte es sinnwidrig zwischen das Evangelium des Lukas und seine Fortsetzung, die Apostelgeschichte des Lukas hinein und ergänzte es dann sogar noch um ein Kapitel, um diesen Evangelienfremdkörper da unterzubringen und trennte es damit sogar von der Offenbarung ab, die man wohl gar nicht als Fortsetzung des Johannes-Evangeliums wahrnahm.
Die Methodik, theologische Schriften unabhängig von dem Umfeld ihrer Entstehungszeit und in ihrer Beziehung zu anderen Schriften isoliert zu betrachten und auszuwerten, hat auch beim Johannes-Evangelium zu den verschiedensten Annahmen zu seiner Entstehung geführt, denen man in der Fachliteratur nachgehen kann, ohne dass sich Klarheit über das tatsächliche Geschehen gewinnen ließe. Die ganzen akrobatischen Geisteskonstruktionen der Theologie um den in diesem Evangelium plötzlich auftauchenden Logos, dem sich beispielsweise Bultmann gleich zu Beginn seiner Erklärung dieses Evangeliums wirklich erschöpfend widmet, haben das aber alles nur weiter verdunkelt und die historisch wichtigen Indizien um die Entstehung dieses Evangeliums verdeckt. Was aber auch von Bultmann als außerhalb aller Wahrscheinlichkeit liegend gar nicht erst in Erwägung gezogen wird, ist die Tatsache, dass das Johannes-Evangelium aus den Synoptikern herausgewachsen ist, ohne sie gar nicht vollinhaltlich verstanden werden könnte, und in allen Evangelien die Lehre des Täufers, nachdem man sie entschärfte und domestizierend ergänzte, unter dem Namen Jesu verkauft wird, weil sich dann der Jesus des christlichen Glaubens auch für ihn komplett verflüchtigt hätte.
Nachstehend werde ich dieses Evangelium nun vorrangig auf Dinge abklopfen, die mir im Bezug auf den Autor und seine Absichten wichtig erscheinen. Was in diesem Evangelium steht, dient nicht mehr dem Ziel einer Rückführung der Christen unter das Dach des jüdischen Glaubens, wie sie Johannes mittels der synoptischen Evangelien von Jesus betreiben lässt. Das ist jetzt konzeptionell schon eine Stufe weiter, und muss als eine von Johannes erstellte Gegenfassung zu den Synoptikern betrachtet werden, die trotzdem auf ihnen aufbaut.
Ohne die Synoptiker würde dem Johannes-Evangelium die Basis fehlen. Es wäre streckenweise sogar unverständlich. Johannes wendet dabei wiederum eine ganz eigene Strategie an, die auf ein klares Ziel angelegt ist, auf welches aber tatsächlich erst aus seiner Offenbarung zurückgeschlossen werden kann. Auch wenn sich das jetzt als Rätsel liest, es ist nicht nur darstellungsmäßig, sondern auch aus den historischen Fakten heraus nicht anders zu erklären. Es ist ein Anti-Evangelium zu den Synoptikern und gleichzeitig das einzige wirkliche Evangelium im Sinne unseres heutigen Glaubens.
Betrachten wir aber, was uns Johannes schreibt. Das Evangelium heißt zwar Das Evangelium nach Johannes, aber es steht nicht dabei, welches Johannes. Auch der Täufer heißt so. Der uns nie namentlich genannte Lieblingsjünger, welcher durch dieses Evangelium geistert, weist aber unmissverständlich auf Johannes, den Jünger Jesu hin. An den Stellen Joh. 19,35 und 21,24 bezeugt dieser Jünger die Wahrheit seines Berichtes.
Die Rangelei dieses Zebedäussohnes Johannes aus den Episoden der Synoptiker um den besten Platz bei Tische, seine aufbrausende Art der Vergeltungssucht (Luk. 9,54), als er wegen einer Zurückweisung Feuer legen will, und seinem Konkurrenzdenken (Luk. 9,49), welches keine Parallelmission duldet, machen ihn uns dafür nicht sehr sympathisch (Mk. 9,38). So einem Ehrgeizling wäre andererseits zuzutrauen, dass er uns dieses Evangelium serviert.
Der Lieblingsjünger wird ziemlich oft erwähnt. Er hält seinen Namen heraus. Sein Bruder Jakobus wird wohl auch deshalb in diesem Evangelium nicht namentlich erwähnt, dafür hat aber wie schon bei den Synoptikern der Jünger Simon Petrus eine Vorzugsrolle. Wer sucht, wird noch mehr bei den Synoptikern agierendes Personal vermissen. Dieses Evangelium dient Johannes auch zu anderen Zwecken, als der Vollständigkeit der Berichterstattung.
Der mystische Anfang des ersten Kapitels (Joh. 1,1-18), handelt von Johannes dem Täufer, dem von Gott gesandten Menschen, der uns Jesus predigt, und dessen Verkündigung, dass Jesus uns Gott predigen werde. Der Täufer tauft auch bei Johannes und die Priester und Leviten aus Jerusalem befragen ihn (Joh. 1,19-28). Er bestreitet der Christus zu sein und er ist auch nicht Elia, der Prophet, obwohl er tauft. Er vertritt eine Lehre, aber er will kein Anführer einer politischen Bewegung sein.
Nun kommt Jesus zum Täufer. Der erkennt in ihm sofort Gottes Sohn und bezeugt alles, was bei den Synoptikern noch untergeschobene Mystik ist, als tatsächlich von ihm erlebt. Er sagt sogar, dass ihn Gott persönlich beauftragt, Jesus zu taufen (Joh. 1,33): …Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist’s … Der Täufer bekräftigt es uns (Joh. 1,34): Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Das kann man aber schon alles in der Tora bei Samuel lesen (1.Sam. 16,3): …dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und (1. Sam. 16,12): …Auf, salbe ihn, denn der ist’s. Da salbt Samuel den David zum König. Dort ist das abgeschrieben.
Was man außerdem beachten muss: Die Taufszene des Jesus gibt es bei Johannes gar nicht. Die Taufe wird uns im Evangelium aus zweiter Hand berichtet. Johannes übermittelt uns nur einen Bericht des Täufers von einer Vision, die er ihm hier aber tatsächlich nur unterstellt. Da kann alles passiert sein, oder auch gar nichts. Bei Johannes muss man aufpassen, was er schreibt.
Mit dieser Methode der Darstellung hat er uns schon in der Apostelgeschichte den Magus (Paulus) durch Jesus in die Diaspora zur Heidenmission schicken lassen (Apg. 22,21). Es steht bei Johannes nicht immer das da, was wir zu lesen denken. Befremdlich ist auch, dass hier der Täufer seinen lt. Lukas angeblichen Cousin Jesus gar nicht zu kennen scheint, was er sogar zweimal ausdrücklich betont (Joh. 1,31/1,33): Und ich kannte ihn nicht...
Die Essener erwarteten damals nicht nur einen Messias, sondern zwei. Den Priestermessias aus dem Hause Aaron und den Königsmessias aus dem Hause David. Der Täufer stammt nach dem Lukas-Evangelium mütterlicherseits aus Aarons Linie. Wenn das als Hinweis dafür anzusehen ist, entspricht Jesus dem essenischen Königsmessias aus dem Hause Davids. Als bemerkenswerte Feinheit: Beide stammen nur über die mütterliche Linie aus ihren jeweiligen Geschlechtern, worüber es natürlich keine Nachweise gibt, weil die Abstammungsregister schon damals nur über die männliche Linie geführt wurden. Das bedeutet aber trotzdem, dass der Täufer den Priestermessias der Essener verkörpert und Jesus deshalb übergeordnet wäre. Der Täufer steht damit über Jesus und Jesus ist der, dem das Martyrium bevorsteht. Das weiß auch der Täufer. Ganz deutlich die dem Täufer untergeschobene Aussage, als er Jesus zu sich kommen sieht (Joh. 1,29): …Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wer jetzt nicht an den daraus heranwachsenden Sündenbock denkt (3. Mose 16), der hat es nicht verstanden. Im Hebräerbrief (Hebr. 13,11) wird uns Jesus sogar direkt als der uns entsündigende Sündenbock vorgeführt. Auch Johannes, als Evangelist, sieht im Täufer den Priestermessias und in Jesus den Königsmessias. Und auch für ihn ist dieser zweite für das Martyrium vorgesehen.
Der Täufer setzt am nächsten Tag sogar mit den eben zitierten Worten gezielt zwei seiner Leute auf Jesus an: Johannes, den späteren Lieblingsjünger und Andreas (Joh. 1,35-39). Das ist eine ungeheuerliche Unterstellung, aber sie ist zumindest bei Johannes bewiesen, der nachweisbar im Dienst des Sanhedrins stand, wie sich indizienmäßig zumindest aus der Apostelgeschichte ergibt, und was uns Josephus in seiner Vita auch historisch untermauert.
Was uns Johannes mit der Taufszene wirklich verzapft ergibt sich aus der Gegenlesung zur Taufe bei Matthäus (Mt. 3,14): Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Diese Szene dreht Johannes hier um. Dort betrachtet der Täufer es als unverdiente Ehre, Jesus zu taufen. Hier ist es fast so, als greife der Täufer sich eine Beute. Die Information des johanneischen Einführungstextes, kann demnach nicht stimmen.
Der Täufer ist bei Johannes damit nicht nur kein Vorreiter Jesu. In Wirklichkeit war er, wie sich aus den Texten noch heute nachweisen lässt, auf der politischen Bühne sogar Jesu Gegenspieler, was uns damit deutlich gemacht wird, ohne dass diese Tatsache Konsequenzen für die Erzählung hätte, die ganz im Sinne der Synoptiker weiterläuft. Johannes und Andreas, der auch gleich seinen Bruder Simon Petrus mitbringt, bleiben nun bei Jesus als Jünger. Jesus benennt diesen Simon Petrus sofort um und nennt ihn Kephas, Fels. Die Worte Petrus und Kephas bedeuten jeweils Fels. Warum er das tut, einen der schon Fels heißt nochmals zum Fels zu ernennen, ist schleierhaft, wenn man nicht weiß, dass hier darüber verdeckt informiert werden soll, was man sich nur mühsam, aus der Apostelgeschichte erarbeiten kann. Es ist die zurückdatierte und nie erfolgte Umbenennung des Simon Petrus zu Kephas, um die in der Apostelgeschichte gezielt betriebene Aufwertung des Phantoms Simon Petrus/Kephas zu zementieren.
Unabhängig davon sind Petrus und Kephas, sobald man sie nach ihren Tätigkeiten trennt, stets sehr konkret beschriebene Personen mit sehr unterschiedlichen Funktionen. Auch der Simon Petrus war ganz bestimmt existent und ist keineswegs eine spätere Rückprojektion des Kephas in die Evangelien. Im Galaterbrief, bei der Beschreibung des Apostelkonzils werden uns Petrus und Kephas ganz deutlich voneinander getrennt und nach Josephus ist er zumindest ein Verwandter, oder sogar ein Bruder des Johannes.
Petrus ist in diesem Evangelium übrigens nicht, wie bei den Synoptikern der erste Jünger Jesu. Er ist aber der erste Angeworbene! Philippus und Nathanael werden nun Jünger. Bemerkenswert ist dabei Nathanaels Ausspruch (Joh. 1,49): …Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel! Die Bedeutung ist für den heutigen Christen ganz klar ein theologisches Glaubensbekenntnis. Nathaniel leistet aber hier tatsächlich einem irdischen König von Israel den Treueschwur. Auch wenn wir es gleich setzen, die Titel eines Königs von Israel und eines Königs von Juda waren zwei verschiedene Titel, wie aus der Geschichte und der Tora ganz klar hervorgeht. Johannes stellt hier etwas heraus, was bisher kaum näher untersucht wurde. Jesus wird hier als König von Israel eingesetzt, aber am Ende von Pilatus als König von Juda gekreuzigt. Jesus spricht nun erstmals vom Menschensohn, über dem die Jünger den Himmel offen sehen werden samt den Engeln Gottes, die hinauf und hinab fahren. Er bekräftigt damit, dass seine Mission tatsächlich religiös gestützt ist. Das bezeugt in der Apostelgeschichte auch Stephanus, was dort der Grund dafür ist, ihn offiziell zu steinigen (Apg. 7,56). Jesu eigentliche Mission als Aufstandsverschwörer wird uns damit auch hier bekanntgegeben.
Er rekrutiert nun alle seine Jünger aus einem sehr eng begrenzten Gebiet Galiläas, aus Bethsaida. Sie kennen sich gegenseitig und holen ihre Freunde und Bekannten nach. Wir haben nun: Johannes, Andreas, Simon (Kephas/Petrus), Philippus, Nathanael. Es sind fünf. Von mehr Jüngern spricht Johannes erst später (Joh. 6,70). Da erwähnt er die Zwölfzahl in Verbindung mit Judas, dem Sohn des Iskariot. Jakobus muss demzufolge auch vorhanden sein, denn er gehört zu den Zwölfen. Auch Thomas, der Zwilling taucht erst spät auf (Joh. 11,16).
Dieses Evangelium ist das, welches zuletzt geschrieben wurde. Es enthält keine Geburtsgeschichte Jesu. Auch das ganze Brimborium um die Jungfrauengeburt der Maria lässt Johannes aus. Kein Abstammungsnachweis Jesu in der Form eines Stammbaumes. Wir werden aber doch über den Status des Jesus informiert, und zwar im ersten Kapitel bei der Anwerbung der Jünger, wo es ganz schnell überlesen wird. Philippus sagt da zu Nathanael: (Joh. 1,45): …Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josephs Sohn, aus Nazareth.
Dass Jesus unabhängig von Dingen, die uns entweder verschwiegen werden oder ihm nachgeredet wurden, als Josephs Sohn galt, ist demnach sicher. Ob Jesus aber wirklich aus Nazareth stammte, bleibt offen. Das Wortspiel zwischen den verwendeten Begriffen Nazareth, Nasiräer und Nazarener, was jeweils etwas anderes bedeutet, legt das nahe. Wenn aber Philippus in Bethsaida den Vater des Jesus als aus Nazareth stammend bezeichnet, dann meint er, dass Jesus aus einer zugezogenen Familie stammt, die nun in Bethsaida ansässig ist, welche sie alle kennen. Es wird demnach bei der Familie Jesu mit der Erwähnung Nazareths auf den Status der Zugezogenen hingewiesen. Damit ist die besondere Kennzeichnung Jesu besser zu verstehen als sie uns die bisherigen Deutungsversuche bieten. Diese Besonderheit finden wir übrigens an anderer Stelle der Evangelien auch bei Maria Magdalena, der stets in der Umgebung Jesu erwähnten Maria aus Magdala.
Nun finden wir Jesus mit seiner Mutter und mit seinen Jüngern auf der Hochzeit zu Kana. Das liegt aller...