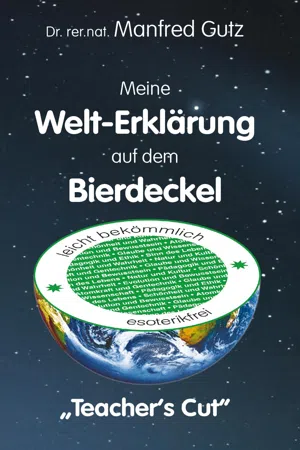![]()
Kapitel 1
Prometheus sei Dank!
Vom Wesen und Werden menschlicher Technik
„Messer, Gabel, Schere, Licht...“ sind zwar nichts für kleine Kinder, aber sind die Kinder einmal herangewachsen, wird von ihnen nicht nur der vertraute Umgang mit Messer und Gabel, sondern auch die sichere Beherrschung von Maschinen, Motoren und anderen komplizierten Geräten verlangt.
Der Mensch hat seinen natürlichen Organismus um vielerlei „künstliche Organe“ erweitert. Und das nicht ohne Grund: „Der Mensch ist“, wie der Philosoph und Soziologe Arnold Gehlen formulierte, „im Gegensatz zu allen höheren Säugern hauptsächlich durch Mängel bestimmt“. Statt eines warmen Fells besitzt er eine nackte Haut, statt scharfer Krallen stumpfe Nägel, und auch was die Schärfe seiner Sinne angeht, übertreffen ihn die meisten anderen Tiere. Außerdem kommt der Mensch mit der Auflage zur Welt, erst durch mühsames Lernen aus Erfahrung klug zu werden, statt durch angeborene Instinkte vor aller Erfahrung klug zu sein.
Schon früh in seiner Geschichte versuchte der Mensch, diese Mängel auszugleichen: Er vervielfachte seine schwachen Kräfte durch Anfertigen von Werkzeugen und Waffen, legte sich zur besseren Orientierung weitere „Augen“ und „Fühler“ zu und steigerte seine Beweglichkeit durch die Erfindung „auto-mobiler“ Wasser-, Land- und Luftfahrzeuge. Mit anderen Worten, er emigrierte aus der Welt der Natur in die Welt der Technik.
Mängelwesen mit Begabung
Die Technik verdankt der Mensch, wenn man dem griechischen Philosophen Plato glauben will, den Titanensöhnen Prometheus und Epimetheus. Sie erhielten, von den Göttern den Auftrag, die von Götterhand frisch geformten Lebewesen so mit Eigenschaften und Fähigkeiten auszustatten, dass sie auch überleben könnten. Da Epimetheus ein besonderes Interesse an dieser Aufgabe äußerte, überließ Prometheus seinem Bruder die Zuteilung: Dem einen Lebewesen verlieh Epimetheus scharfe Krallen, dem anderen schnelle Hufe, ein gutes Auge dem einen, ein sicheres Versteck dem anderen. So verfuhr er auch bei der Zuteilung von Nahrung und Nachkommenschaft, stets darauf bedacht, die Lebewesen vor gegenseitiger Ausrottung zu bewahren. Als dann schließlich auch das Menschengeschlecht an die Reihe kommen sollte, musste Epimetheus mit Entsetzen feststellen, dass sein Vorrat an Überlebensinstrumenten schon aufgebraucht war. So ganz ohne Schutz konnte er aber den Menschen nicht in die Natur entlassen! In seiner Not bat er Prometheus um Hilfe. Entschlossen, seinem Bruder zu helfen und der Menschheit das Überleben zu sichern, schlich er sich in die Werkstatt der Götter und stahl „dem Hephaistos und der Athena ihr kunstreiches Handwerk samt dem Feuer – denn es war unmöglich, es ohne Feuer zu erwerben oder nutzbar zu machen – und schenkte beides dem Menschen ... “ Natürlich rächten sich die Götter: Prometheus musste, an einen Felsen des Kaukasus geschmiedet, für seine Freveltat büßen, und über die mit den göttlichen Gaben beschenkte Menschheit ergossen sich Elend und Übel aus der Büchse der Pandora.
Es ist das Wesen großer Geister, dass sie die Wahrheit, auch wenn sie sie nicht sehen können, doch erahnen. Plato hat insbesondere in zweierlei Hinsicht Recht: Zum einen stimmt der Mythos von Prometheus mit den Aussagen der modernen Evolutionstheorie darin überein, dass gerade die mangelhafte Ausstattung des Menschen mit Spezialorganen und seine wahrhaft göttlich zu nennende Begabung mit „Hand und Hirn“ – mit der Kunstfertigkeit des Hephaistos und der Weisheit der Athena – die typischen Merkmale des Menschen darstellen. Sie sind es auch, die dem Menschen den Zugang zur Technik (techne, griech.: jede Art von praktischer Tätigkeit) erschließen und ihm damit nicht nur das Überleben sichern, sondern ihn sogar, zumindest in den Augen der Biologen, zum „Volltreffer der Evolution“ werden lassen. Zum anderen betont Plato zurecht die große Bedeutung des Feuers für den Menschen und damit jener körperfremden Energiequellen, die den Menschen erst in die Lage versetzen, sein Wissen und Können in den Dienst der Technik zu stellen: Pflanzen und Tiere vermögen körperfremde Energien, sofern sie ihnen überhaupt zuträglich sind, lediglich in Wachstums- und Vermehrungsprozesse des eigenen Körpers einfließen zu lassen. Anders verhält es sich beim Menschen. Er kann sie darüber hinaus für die Herstellung und den Betrieb von körperfremden Gebrauchs- und Luxusgegenständen nutzen. So kommen wir in den Genuss von warmer Kleidung und elektrischem Licht, von Auto und Fernseher. Prometheus sei Dank! Aber – und das konnte Plato nicht wissen – Kunstfertigkeit und Weisheit als auch die Fähigkeit zur Nutzung körperfremder Energiequellen, wie die des Feuers oder des Windes, wurden der Menschheit nicht einfach als Geschenk in die Wiege gelegt, sondern sind im Verlauf langer Entwicklungsprozesse erworben worden. Dabei ging es insbesondere um die biologische Evolution von „Hand und Hirn“ und im Anschluss daran um das Auffinden und Ausnutzen immer effektiverer „Feuer“ zur Herstellung immer leistungsfähigerer technischer Produkte. Diesen beiden geschichtlichen Prozessen gilt es nachzuspüren, wenn man das Wesen und Werden menschlicher Technik besser verstehen will.
Vom Greifen zum Begreifen
Bei den Lebewesen unterscheiden wir zwischen Pflanzen und Tieren. Pflanzen sind in unseren Augen „moralische“ Geschöpfe: Sie nehmen mit ihren Blättern die Energie der Sonnenstrahlen in sich auf und produzieren mit ihrer Hilfe aus Wasser, Kohlenstoffdioxid und Salzen energiereiche organische Stoffe. Sie erwecken sozusagen Totes zum Leben. Tiere dagegen sind „unmoralisch“: Sie töten, um aus der energiereichen Substanz des Getöteten – ob Pflanze oder Tier – jene Kraft zu ziehen, die sie für ihr eigenes Leben benötigen. Um stets genügend Beute machen zu können, entwickelten die Tiere Sinnes- und Bewegungsorgane, „erfanden“ mehr oder weniger erfolgreiche Waffen und legten sich zur besseren Koordination und Steuerung all dieser Organe ein Nervensystem mit einem Gehirn als Schaltzentrale zu. Dabei zeigte sich: Je besser das Nervensystem, desto umfangreicher die Beute und umso größer das Durchsetzungsvermögen des Tieres. Die Primaten, zu denen die Affen und Menschen gehören, wurden die Primi unter den Tieren, da sie das beste Nervensystem ausbildeten. Dies war ihnen möglich, weil sie sich bei der Neuverteilung des „Pflanzenkuchens“ vor etwa siebzig Millionen Jahren, als die Säugetier-Prototypen die weniger leistungsfähigen Saurier-Veteranen verdrängten, für die „Rosinen des Kuchens“, das heißt, für die süßen Früchte in den Bäumen, entschieden. Früchte aber sind im Blattgewirr der Bäume schwer auszumachen. Außerdem ist eine große Geschicklichkeit erforderlich, um an sie heranzukommen. Deswegen waren nur diejenigen im Geäst der Bäume erfolgreich, die insbesondere ein gutes räumliches Sehen, eine exakt zupackende Greifhand und ein schnell arbeitendes Nervensystem entwickelten. Die Greifhand ermöglichte zudem das Festhalten und Zerkleinern der Beute. Bei den handlosen Säugern muss diese Arbeit ein starker Kiefer übernehmen. Er wurde deshalb relativ groß bei diesen Tieren. Der Kiefer des Primaten dagegen konnte klein bleiben und Platz lassen für die Vergrößerung des Vorderhirns. Ohne Hand kein Hirn! Hand und Hirn gingen eine erfolgreiche Ehe ein. Zum „Kinderzeugen“ war es allerdings noch zu früh ...
Solcherart ausgestattet, wagte sich ein Teil der Baumbewohner auch unter die Bäume und in die freie Ebene. Sie ließen das Gewirr der Baumstämme, das wie ein Gitterwerk den schon so regen Geist gefangen hielt, hinter sich und eröffneten als Aufrechtgeher Hand und Hirn neue Freiheiten: Das sich weiter vergrößernde Vorderhirn bildete in sich eine Art Projektionsschirm aus, in dem sich das Lebewesen gleichzeitig als Subjekt und Objekt, als Handelndes und Behandeltes, betrachten konnte. Das Greifen hatte zum Begreifen geführt: zur Ausbildung des Bewusstseins! Die Natur hatte damit das Lebewesen „Tier“ aus der paradiesischen Geborgenheit der Instinkte als „Mensch“ in die riskierte Freiheit der Selbstbestimmung entlassen.
Erfahrung wird zum Wissen
Erste Hinweise für ein erwachtes Bewusstsein sieht die Wissenschaft in der Herstellung und dem Gebrauch von Werkzeugen. Die ersten Werkzeuge waren bezeichnenderweise solche, die die Effektivität der Hand verbesserten: Faustkeile und Knüppel, Hämmer und Speere erhöhten die „Hand“-lungsfähigkeit und „Macht“ des Menschen gewaltig. Aber dabei blieb es nicht. Das Gehirn verbesserte jetzt das von der Hand geführte Werkzeug, das künstliche Organ, und dieses wiederum wirkte verbessernd auf das Gehirn: Aus dem geworfenen Stein wurde die Kanonenkugel, aus dem Lagerfeuer das Herdfeuer und aus dem Karren die Nobelkarosse.
Beschleunigt wurde die Entwicklung durch die Informationsträger Sprache und Schrift, mit denen sich das Bewusstsein Gehör verschafft und zu dokumentieren versteht. Bisher hatte sich die Natur zur Speicherung der Information des Erbguts und zu ihrer Weitergabe der mühsamen Fortpflanzung bedient. Indem der Mensch die Information in Worte packte, sie später sogar visualisierte und digitalisierte, machte er sie unabhängig vom Lebewesen, beschleunigte ihre Weitergabe und erschloss ihr neue Speichermöglichkeiten. Ein neu erworbenes erfolgreiches Verhalten brauchte jetzt nicht mehr in natura demonstriert und ein effektiveres Werkzeug nicht mehr neu erfunden zu werden. Jede neue Generation konnte nun auf dem Wissensfundus der älteren Generation aufbauen und noch komplexeres Wissen erschließen (siehe Kapitel 4).
In gleichem Maße wie dank neuer Informationstechniken Raum und Zeit für die Speicherung und den Transport von Wissen schrumpften, beschleunigte sich die Akkumulation von Wissen. Es erreichte einen Stand, der einige Wissenschaftler ermutigte, nach der Vervollkommnung so vieler anderer Organe durch Werkzeuge, sich nun auch der Verbesserung des Gehirns zuzuwenden und ein „Denkzeug“ zu entwickeln. Neuartigen Computern soll mit Schaltungen nach dem Vorbild des Gehirns das Denken beigebracht werden. Ob dies je gelingt, darüber wird augenblicklich heiß diskutiert: „Wie durch die Computersimulation eines Verdauungsprozesses keine Pizza verdaut werden kann, so vermag auch die Simulation von Denkprozessen keine Gedanken zu erzeugen“, argumentieren die Skeptiker. Die Befürworter halten dagegen: „Von einem Gerät, das fliegen kann, wird ja auch nicht verlangt, dass es Eier legt!“ Hinter diesem so wortgewaltig geführten aktuellen Streit steht im Grunde das Eingeständnis, noch nichts Genaues über das Wesen des Denkens zu wissen. Wen wundert’s! Handelt es sich doch beim Gehirn um das jüngste und wohl komplizierteste Organ auf unserem Planeten. Eines steht aber heute schon fest: Die Kulturtechniken Rechnen und Schreiben beherrschen selbst die herkömmlichen Computer bereits besser als wir Menschen!
Ein Spezialist für alle Fälle
Wenn über die Vorgänge in unserem Gehirn, die zum Denken führen, auch noch weitgehend Unklarheit herrscht, so besteht doch Klarheit darüber, was wir unserem Gehirn verdanken: Es schenkte dem Menschen die Technik! Mit Hilfe seiner vom Gehirn erdachten und mit den Händen manipulierten künstlichen Organe, seiner Kleider und Werkzeuge, seiner Maschinen und Instrumente, gelang es dem Menschen, die Mängel seiner geringen körperlichen Anpassung an die Natur zu kompensieren. Mehr noch! Sie verliehen ihm die Herrschaft über das Pflanzen- und Tierreich. Dass dies möglich war, erklärt sich aus dem besonderen Charakter jener künstlichen Organe.
Die Tatsache zum Beispiel, dass künstliche Organe im Gegensatz zu den natürlichen nicht mit dem Körper verbunden sind, ermöglicht dem Menschen, sich nach Bedarf und Belieben zu spezialisieren und das in einer Weise, die keine Konkurrenz, auch nicht die der besten Spezialisten unter den Tieren, zu fürchten braucht: Mit dem Flugzeug fliegt er jedem Vogel davon, am Steuer eines Baggers entwickelt er Bärenkräfte, und mit dem Fernglas in der Hand vermag er seinem Blick die Schärfe eines Adlerauges zu verleihen ... Außerdem gestatten ihm seine künstlichen Organe, selbst die unwirtlichsten Regionen der Erde als Lebensräume zu erschließen. Und gerade jetzt unternimmt er Versuche, sich auch im Weltraum einzurichten.
Die Tiere mit ihren natürlichen Spezialorganen sind diesbezüglich weniger flexibel. Da ihr Spezialistentum angeboren ist, sind sie mit ihrem speziellen Lebensraum und ihren darauf abgestimmten Spezialorganen auf Gedeih und Verderb verbunden. Sich ändernde Umweltbedingungen können für sie deshalb schnell katastrophale Folgen haben. Welches Schicksal erwartet die auf Zehenspitzen laufenden Huftiere, wenn Steppen und Savannen versumpfen ...?
Hervorzuheben ist auch, dass künstliche Organe nicht aus lebendem Gewebe bestehen. Ihre Herstellung und Handhabung kann deshalb auch unter extrem lebensfeindlichen Bedingungen erfolgen. Außerdem bleiben sie über den Tod ihres Besitzers hinaus funktionsfähig und können so, anders als bei den natürlichen Organen, an die Nachkommen weitergegeben werden.
Ein künstliches Organ ist zudem meist eine Neuschöpfung und sein Herstellungsprozess nicht an seine Entstehungsgeschichte als Rezept gebunden mit all ihren Irr- und Umwegen. Es sei hier nur an die entwicklungsgeschichtlich bedingten Herz- oder Gefäßanomalien mancher Neugeborener erinnert und an den entbehrlichen blinden Fleck in unserem Auge.
Ohne künstliche Organe gäbe es im übrigen kein Handwerk und kein Gewerbe, keine Industrie und keine Geldwirtschaft, denn künstliche Organe müssen nicht von demjenigen hergestellt werden, dem sie dienen sollen. Sie können gekauft oder verkauft, gemietet oder vermietet, gepflegt, repariert oder „recycled“ werden.
Von besonderer Bedeutung für den Aufstieg des Menschen aber muss die Tatsache angesehen werden, dass das Herstellen und Betreiben von künstlichen Organen nicht an die begrenzten Kräfte des menschlichen Organismus gebunden ist. Der Mensch kann sich auch körperfremder Energien bedienen, zum Beispiel der Zugkraft des Ochsens, der Hitze des Feuers oder der Druckkräfte von Wasser und Wind. Am wichtigsten für den Menschen aber war und ist die Energie, die ihm das Feuer zur Verfügung stellt. Wie der Mythos von Prometheus lehrt, haben dies auch schon die alten Griechen erkannt. Aber mit der Technik selbst wollten sie möglichst wenig zu tun haben. Ihr Interesse galt vielmehr der Philosophie. Die praktische Tätigkeit überließen sie liebend gern den Sklaven und Fremden. Diese wurden von ihnen als Banausen (banausos, griech.: Mensch ohne geistige Interessen) verspottet. Und nicht umsonst wurde dem hilfreichen Hephaistos, dem Techniker unter den Göttern, von den schönheitsverliebten Griechen Hässlichkeit und ein lahmes Bein angedichtet ...
Die Zähmung des Feuers
Das Feuer benötigt allerdings, wie auch das natürliche Organ, zur Unterhaltung seiner Funktion einen Energieträger. Beim Feuer ist es zum Beispiel das Holz, beim natürlichen Organ die Nahrung. Da beim Feuer, im Gegensatz zum natürlichen Organ, die Freisetzung von Energie sehr komprimiert erfolgt, ist es ein relativ gefährlicher Mittler zwischen dem Energieträger und dem vom Benutzer angestrebten Leistungsziel. „Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht“, belehrt uns Schiller in seinem „Lied von der Glocke“. Das Braten von Fleisch, das Brennen von Ton sowie das Erschmelzen und Schmieden von Metallen benötigen Feuer pur. Für den Transport von Steinen, das Ziehen eines Pfluges oder das Drehen eines Mahlsteins war es aber in dieser „unbezähmten“ Form nicht zu gebrauchen. In der Antike wurde diese Arbeit deshalb im wesentlichen von Menschen- bzw. Tierkraft verrichtet; im Mittelalter setzte man verstärkt auf die Wasser- und Windkraft.
Die Zähmung des Feuers gelang erst mit der Erfindung der Dampfmaschine Ende des 18. Jahrhunderts. Mit ihr begann das Zeitalter der industriellen Revolution: Die Dampfmaschine vermochte das Feuer durch „Portionierung“ so zu bändigen, dass seine Energie nun endlich den Fabriken und Bergwerken als dringend benötigte Kraftquelle für ihre Webstühle, Förderanlagen und Schienenfahrzeuge zum Beispiel zur Verfügung stand. Die industrielle Revolution war auch in anderer Hinsicht revolutionär: Während sich die Menschen in Frankreich etwa zur gleichen Zeit von den Fesseln feudalistischer Bevormundung befreiten, emanzipierte sich die Technik von der Eingebundenheit in die Energieumsätze der Natur, indem sie jetzt, bei sich verknappendem Holz, auf den fossilen Energieträger Kohle zurückgriff.
Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Bohrungen nach Erdöl, einem weiteren fossilen Energieträger, endlich erfolgreich waren, kündigte sich eine neue technologische Epoche an: Mit der Erfindung des Benzin- und Dieselmotors gelang es, die Energie des Feuers noch erfolgreicher zu zähmen und sie somit den immer präziser arbeitenden Werkzeugen und Maschinen noch besser anzupassen. Den wirklichen Durchbruch in dieser Beziehung brachten jedoch erst die Entdeckung des dynamo-elektrischen Prinzips und die Erfindung des Elektromotors gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Elektrischer Strom vermag sowohl große als auch sehr kleine Geräte anzutreiben. Seine Energie ist in alle Energieformen umwandelbar, kann über weite Strecken geleitet werden und lässt sich vom Verbraucher „im Handumdrehen“ ein- und ausschalten. Mit der Elektrizität fand die Technik auch Eingang in die Haushalte und bescherte den Menschen einen ungeahnten Komfort und Luxus. Wir sollten jedoch bedenken, dass wir unser aktuelles, noch relativ preiswertes Angebot an Energie hauptsächlich der „Kolonialisierung der Vergangenheit“ verdanken. Diese Energie, die heute Fernseher und Kühlschränke betreibt, wurde vor etwa 300 Millionen Jahren von den mittlerweile zu Kohle gewordenen Wäldern des Karbonzeitalters gesammelt. Der Vorrat an Kohle und Erdöl reicht aber, wie Schätzungen ergaben, nur noch bis zum Ende...