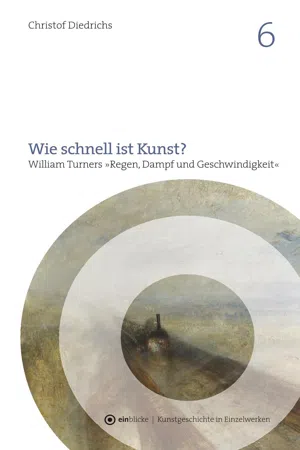![]()
AUS NATUR WIRD KUNST
Es sei nicht die Aufgabe des Künstlers, die Wirklichkeit abzubilden. So hat es – nicht als erster,33 aber mit erkennbarem Bezug auf William Turner – der englische Schriftsteller, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph John Ruskin (1819–1900) 1843 im ersten Band von Modern Painters geschrieben.
„Ein Maler, der ein Naturobjekt getreulich darstellt, ist dadurch so wenig ein großer Künstler, wie ein Mensch, der sich grammatikalisch und sprachlich melodiös ausdrückt, damit schon ein großer Dichter ist.“34
Ruskin war einer der einflussreichsten Denker seiner Zeit. Mit Modern Painters, dessen erster Band hauptsächlich Turner gewidmet ist, wurde er zum kunsttheoretischen Anwalt des um 44 Jahre älteren Malers. „Als Dreiundzwanzigjähriger war er der offiziellen Kritik allein entgegengetreten und hatte überzeugt.“35
Ruskin war es auch, der als einer der ersten den Begriff ‚Moderne‘ für die Malerei des 19. Jahrhunderts verwendete und dabei eine theoretische Begründung der modernen Kunst entwickelte. Die sichtbare Wirklichkeit bzw. die ‚Natur‘ nachzuahmen, so schreibt Ruskin im Anschluss an das oben angeführte Zitat, stelle lediglich das technische Handwerkszeug des Künstlers dar, sei mithin nichts als die notwendige Voraussetzung, um mit ihrer Hilfe Kunst erschaffen zu können.
Allerdings stellt sich dann die Frage, was Kunst zur Kunst macht, wenn dies nicht, wie es weit verbreitete Meinung war, die Fähigkeit zur Mimesis* ist.
Ruskin entwickelt seine Antwort auf diese Frage ausgehend von einer Beobachtung: Er wirft exemplarisch einen Blick auf eine Pfütze am Wegrand. Diese könne man auf ganz verschiedene Weisen sehen, bevor es an die künstlerische Umsetzung geht; je nach der Art, wie man die Pfütze sehe, könne man unterschiedliche Dinge darin erkennen:
„Es ist in dein Belieben gestellt, ob du den Unrat der Straße oder das Bild des Himmels darin erschaust.“36
Der gewöhnliche Mensch wie ein mittelmäßiger Maler, der sich der Kunst nicht bewusst ist, lasse sich beim Sehen grundsätzlich von seinem (Vor-)Wissen leiten. Entsprechend werde das Sehen davon überlagert und geprägt. Der Mensch weiß, Ruskin zufolge, dass eine Pfütze nichts Edles oder Sehenswertes, sondern etwas Alltägliches und Schmutziges ist. Entsprechend erwarte er, dass sie ihm trüb und dreckig erscheinen wird. Aufgrund dieser vom Wissen geprägten Erwartung werde er sie weder genauer ansehen, noch etwas Besonderes in ihr entdecken. Eine Pfütze ist gewissermaßen durch eine allgemeine Vorstellung von ihr profaniert.
Der echte, große Künstler dagegen sehe sie auf eine andere Weise. Er lasse sich nicht durch sein Vorwissen leiten, sondern ausschließlich durch sein Auge:
„Der große Maler blickt unter und hinter die braune Oberfläche [und] malt, was er da gewahrt, und wenn es ihn einen ganzen Tag Arbeit kostete.“37
Für ihn hat die Pfütze also nichts Profanes und Alltägliches. Sie bildet vielmehr einen unbekannten Mikrokosmos, in dem es Vieles und Wunderbares zu entdecken gibt. Und Ruskin wünscht, dass nicht nur die großen, sondern auch die gewöhnlichen Maler
„auf die nächste Wiese gehen möchten, an den nächsten schmutzigen Teich und den genau malen; nicht daran denkend, dass sie Wasser malen, und dass Wasser auf eine besondere Weise gemalt werden muss, sondern nur malen, was sie sehen …“
Dann würden sie beispielsweise entdecken, dass
„kaum ein Teich an der Landstraße [liegt], der nicht so viel Landschaft in sich als über sich hätte. Die Pfütze ist nicht braun, sumpfig oder öde; sie hat ein Herz wie wir, auf dessen Grunde die Zweige der hohen Bäume, die Halme des wehenden Grases und alle Farbentöne wechselnden lieblichen Himmelslichts wohnen. Selbst die hässliche Lache, die sich über den Ableitungsröhren im Innern der schmutzigen Stadt bildet, ist nicht gänzlich gemein; wenn du tief genug blickst, wirst du das dunkle ernste Blau des fernen Himmels und die vorüberziehenden reinen Wolken darin erblicken.“38
Ruskin nennt diese Art zu sehen den „umfassenderen Blick“.
Eben dieser Aspekt, das Sehen nur mit dem Auge, nicht aber mit Bewusstsein und auf der Grundlage von Vorwissen und Erwartung, wird einige Jahrzehnte später programmatisch von den Impressionisten favorisiert. So wird vor eben diesem Hintergrund Émile Bernard (1868– 1941) Claude Monet (1840–1926) „Auge des Lichts“ nennen, „das die Tore der Malerei zur Unendlichkeit des Himmels, des Meeres und der Ebenen aufgestoßen hatte.“39 Und Paul Cézanne (1839–1906) sieht in Monet noch umfassender ‚das Auge schlechthin‘: „Monet ist ein Auge,“ sagt er um 1900 über ihn, „das wunderbarste Auge, seit es Maler gibt.“40
Diese Konzentration des Künstlers auf den Akt des unvoreingenommenen Sehens, die es erst seit dem Beginn der Moderne mit ihrer Einführung von Subjektivität und Individualität in die Kunst gibt, führt dazu, dass sich der Maler nicht allein über die Gegenständlichkeit seiner Werke Gedanken macht, sondern auch über die angemessene Darstellungsweise, die seinen eigenen, subjektiven Eindruck richtig wiedergibt. ‚Richtig‘ bedeutet hier aber nicht mehr, dass allgemein anerkannten, ‚objektiven‘ Kriterien Genüge getan wird, die von außen bestimm- und überprüfbar wären, sondern dass der individuelle, meist situationsbedingte, ephemere (vorübergehende, flüchtige) Eindruck so wiedergegeben und damit fixiert wird, dass er auch später noch nachvollziehbar ist, wenn die Situation längst vorüber ist und sich Bild und Betrachter an einem anderen Ort befinden.
Dies, einen rein persönlichen, augenblickshaften, vergänglichen Eindruck auf der Leinwand oder dem Aquarellpapier festzuhalten und damit reproduzierbar, erinnerbar, wieder-erlebbar zu machen, bedeutet, ein natürliches Phänomen, auch ‚Wirklichkeit‘ oder ‚Natur‘ genannt, mit den Mitteln der Kunst in Kunst zu verwandeln. Auf diese Weise wird aus ‚Natur‘ Kunst.
Auf dem Weg dieses Akts der Transformation entdecken die modernen Künstler jedoch, dass ihnen Vieles hinderlich ist, was in den voraufgegangenen Jahrhunderten entwickelt worden ist und als ‚klassisches Wissen‘ in den Akademien gelehrt wird. Dazu gehört beispielsweise die Linear-, Fluchtpunkt- oder Zentralperspektive*, die Turner selbst seit 1811 als Professor der Royal Academy unterrichtet, aber ebenso viele Theorien der Farbgebung, die gerade am Beginn des 19. Jahrhunderts stark von Goethes 1810 erschienener Farbenlehre beeinflusst werden. Alles dieses über Jahrhunderte als selbstverständlich vorausgesetzte Wissen muss nach der neuen Ausrichtung der Kunst überprüft werden und vieles davon wird von den ‚modernen‘ Künstlern als untauglich eingestuft angesichts ihres Bemühens, das auszudrücken, was sie in ihren Werken ausdrücken wollen und was eben nicht (mehr) mimetische Widergabe der äußerlich sichtbaren Wirklichkeit ist.
Das gilt nicht zuletzt für William Turner, der als Künstler nicht selten in eklatanter Weise von dem abweicht, was er als Professor in der Royal Academy lehrt.41
Regen und Dampf und Geschwindigkeit
Das Gemälde Regen, Dampf und Geschwindigkeit gehört zu den spätesten Werken, die Turner gemalt hat. 1844 war er fast siebzig Jahre alt. Eigentlich sollte man erwarten, dass er damit kein Neuland mehr betritt und keine weiteren Erfindungen mehr macht.
Aber gerade diese Erwartung durchkreuzt Turner, nicht zuletzt indem er dem Bild einen überraschenden Titel gibt. Regen und Dampf sind beides flüchtige Elemente, die in einem Ölbild zu fixieren an sich schon schwierig ist. Aber Geschwindigkeit ‚auszudrücken‘ – um diese Formulierung Honoré de Balzacs aufzunehmen42 – musste für seine Zeitgenossen als gänzlich unmöglich gelten, nicht zuletzt da das Phänomen der Geschwindigkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ein ganz neues, viel bestauntes und kontrovers diskutiertes war.
Darstellung von Bewegung
Tatsächlich wurde noch am Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass die Kunst des gesamten Jahrhunderts nicht allein Geschwindigkeit, sondern sogar jede Form der Bewegung schlicht ignoriert habe.43
Turners Altersgenosse John Constable (1776–1837) hatte dies erst kurz vor der Entstehung von Regen, Dampf und Geschwindigkeit unfreiwillig bewiesen: In seinem Gemälde Das springende Pferd (Abbildung gegenüberliegende Seite) erscheint das namengebende, stämmige Pferd wie in der Bewegung festgefroren – wie ein Spielzeugpferd, das auf die Bewegung durch die Kinderhand wartet.
John Constable, Das springende Pferd, 1824/25 (Detail);
London, Royal Academy of Arts
Das Pferd, das Constable ohne ersichtlichen Grund auf einer grob gezimmerten Holzbrücke zu einem schwerfälligen Sprung ansetzen lässt, gleicht nicht zuletzt aufgrund seiner optischen Erstarrung mehr der herrschaftlichen Levade* als der sportlichen Überwindung eines Hindernisses. Constable transportiert damit wahrscheinlich eher inhaltliche Konnotationen, als dass ihn die Darstellung von Bewegung oder gar Geschwindigkeit interessieren würde. Auch hier wird dieses Phänomen also offensichtlich ignoriert.
Das findet sich ganz ähnlich in vielen anderen Bildern dieser Zeit. Auch Théodore Géricaults Rennpferde beim Derby in Epsom (1821; Abbildung gegenüberliegende Seite, oben) erscheinen trotz des gestreckten Galopps, in dem sie sich befinden sollen, wie in der Luft festgefroren, statt dass sie glaubwürdig den Eindruck von rasender Geschwindigkeit vermitteln würden. Und das ist selbst noch bei dem größten Pferdemaler des 19. Jahrhunderts, dem zu seiner Zeit höchst-berühmten Ernest Meissonier (1815–1891, Abbildung gegenüberliegende Seite, unten), so, der es trotz aufwändigsten Studiums der Bewegungsabläufe von Pferden im vollen Galopp nicht vermochte, den Bildern den Eindruck von geradezu verzweifelter Erstarrung zu nehmen, sie also optisch-illusionistisch in Bewegung zu versetzen.44
Annähernd systematisch thematisiert wurde Bewegung in der Kunst erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts bzw. um die Jahrhundertwende, als die neu entwickelte Technik der Fotographie Verfahren entwickelt hatte, mit deren Hilfe Bewegung seriell aufgenommen und abgebildet werden konnte. Der Serien- und der Chronophotographie, wie sie maßgeblich der britische Fotograph Eadweard Muybridge (1830–1904) und der französische Erfinder Etienne-Jules Marey (1830–1904) entwickelten, folgten nach der Jahrhundertwende neben dem eigentlichen Film die kubistischen und futuristischen Auseinandersetzungen mit dem Phänomen der Bewegung, beispielsweise in Marcel Duchamps Akt, eine Treppe hinabsteigend von 1912 (Philadelphia Museum of Art) oder im ersten futuristischen Manifest aus dem Jahr 1909, in dem mehr als 60 Jahre nach Entstehung von Regen, Dampf und Geschwindigkeit so getan wird, als sei Geschwindigkeit überhaupt erst jetzt erfunden worden; darin erklärt Filippo
Théodore Géricault, Das Derby in Epsom, 1821;
Paris, Louvre
Ernest Meissonier, 1807. Friedland (Detail), ca. 1861–1875;
New York, Metropolitan Museum
Tommaso Marinetti (1867–1944), „daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit“.45
Sehen von Bewegung
Das Sehen ist heute durch ganz andere Gewohnheiten und nicht zuletzt andere Geschwindigkeiten geprägt, als das noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fall war. Wir sind mit der Filmtechnik vertraut und darin geübt, Einzelbilder einer Serienfotografie zu einer vor unseren Augen ablaufenden Bewegung...