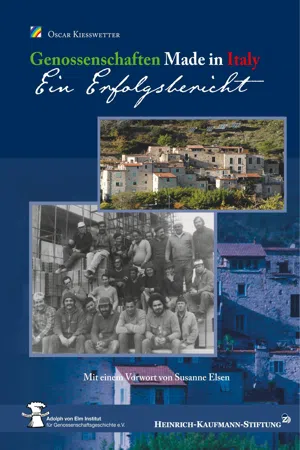
- 224 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Genossenschaften Made in Italy - Ein Erfolgsbericht
Über dieses Buch
Bei 60 Millionen Einwohnern gibt es in Italien insgesamt rund 80.000 Genossenschaften, in Deutschland sind es bei 80 Mio. Einwohnern nur 8.000. Wenn man das Buch von Oscar Kiesswetter liest, bekommt man eine Ahnung von den Ursachen dieses Unterschiedes. Die italienische Verfassung enthält einen unmissverständlichen Auftrag an die Staatsorgane, die Genossenschaften wirksam zu fördern. Kiesswetter beschreibt, wie vielfältig die Initiativen waren und sind, diesem Auftrag nachzukommen. Zahlreiche Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Steuerregelungen und Gerichtsurteile, die vielfach keine Entsprechung in Deutschland finden, legen Zeugnis davon ab.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Genossenschaften Made in Italy - Ein Erfolgsbericht von Oscar Kiesswetter im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Business allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Zum Geleit
Bei 60 Millionen Einwohnern gibt es in Italien insgesamt rund 80.000 Genossenschaften, in Deutschland sind es bei 80 Mio. Einwohnern nur 8.000.
Wenn man das Buch von Oscar Kiesswetter liest, bekommt man eine Ahnung von den Ursachen dieses Unterschiedes.
Die italienische Verfassung enthält einen unmissverständlichen Auftrag an die Staatsorgane, die Genossenschaften wirksam zu fördern. Kiesswetter beschreibt, wie vielfältig die Initiativen waren und sind, diesem Auftrag nachzukommen. Zahlreiche Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Steuerregelungen und Gerichtsurteile, die vielfach keine Entsprechung in Deutschland finden, legen Zeugnis davon ab.
Selbsthilfe in vorbildlicher Form bieten die Mutualitätsfonds, in die alle Genossenschaften drei Prozent ihres Reingewinns einzahlen und aus denen genossenschaftliche Projekte, u. a. Neugründungen finanziert werden.
Einen großen Vorteil bieten die teilweise steuerfreien Gewinnzuweisungen an die unteilbaren Rücklagen der Genossenschaft, die maßgeblich zur Sicherung des Eigenkapitals beitragen und die niemals an die Mitglieder ausgezahlt werden dürfen.
Neue gesellschaftliche Herausforderungen werden mit neuen genossenschaftlichen Formen beantwortet, wie z. B. den Sozialgenossenschaften oder den Genossenschaften zur Übernahme insolventer Firmen durch die Belegschaften und schließlich die Bürgergenossenschaften, die vor allem in ländlichen Zonen Infrastrukturaufgaben übernehmen, die von staatlichen und kommunalen Einrichtungen nicht mehr geleistet werden können.
Dies alles kann nur funktionieren, weil es offenbar in den Parlamenten, den staatlichen und kommunalen Verwaltungen, den Parteien, der Kirche und nicht zuletzt in den Genossenschaftsverbänden Menschen gibt, die begeisterte Genossenschafter*innen sind, die neue Ideen aufgreifen und vorantreiben.
Die deutsche Genossenschaftsdiskussion beschränkt sich oft auf die Frage, ob Buchhaltung und Bilanzen der Genossenschaften genauso geprüft werden müssen, wie bei Kapitalgesellschaften. Das kreative Potential, das in den Genossenschaften steckt, fällt dabei hinten runter.
Dieses Buch bietet nicht nur einen Ausflug in eine andere Genossenschaftswelt. Es gibt Anregungen, zu erkennen, wieviel Chancen auch bei uns bestehen, das Leben in viel größerem Umfang genossenschaftlich zu gestalten. Hier wie in Italien gilt der Grundsatz: „Mehr Genossenschaft – mehr Wohlbefinden.“
Burchard Bösche
Heinrich-Kaufmann-Stiftung
Vorwort
Gilt die Sehnsucht vielleicht etwas,
was sie aus der Ferne idealisieren?1
was sie aus der Ferne idealisieren?1
Dem Autor dieses Bandes, einem intimen Kenner des Italienischen Genossenschaftswesens ist zu danken, dass er diese Dokumentation und Kommentierung der Besonderheiten der Italienischen Genossenschaftskultur vorlegt und sie in Bezug setzt zum deutschsprachigen Nachbarraum.
Oscar Kiesswetter ist Südtiroler und bewegt sich somit auf der Nahtstelle zwischen italienischsprachigem und deutschsprachigem Kulturraum. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Entstehungshintergründe, der zeithistorischen Entwicklungen und die Ausprägungen der spezifischen Genossenschaftskulturen in diesen beiden europäischen Ländern lassen sich aus der alpinen Höhenperspektive deutlich erkennen und benennen.
Wie alle Genossenschaften sind auch die italienischen und die deutschen den internationalen Grundsätzen verpflichtet, die von der International Cooperative Alliance (ICA) 1995 formuliert wurden. Doch auch wenn beide Länder dies, sowie nicht nur eine ihrer Sprachen und kulturelle Prägungen als Gemeinsamkeit haben, verweist bereits die Gegenüberstellung der gesetzlichen Grundlagen der italienischen und der bayerischen Verfassung auf zwei verschiedene Linien, die sich seit dem frühen 20. Jahrhundert herausgebildet und im weiteren Verlauf, auseinanderentwickelt haben. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns mit einigen historischen Weichenstellungen in beiden Ländern befassen: Artikel 45 der italienischen Verfassung von 1947 besagt: Die Republik erkennt die soziale Funktion der Kooperation, der Gegenseitigkeit und der nicht spekulativen Ziele an.2 Die gesellschaftliche Funktion von Genossenschaften und ihr nicht primär profitorientierter Charakter werden also explizit betont. Dies definiert Genossenschaften als soziale und solidarische Unternehmen und als Gegenentwürfe zur Ökonomie der Profitmaximierung.
In Italien entwickelte sich eine diversifizierte Genossenschaftslandschaft von unten, die aus dem Kontext der Zivilgesellschaft, kreativ und wirksam auf sich je verändernde gesellschaftlichen Fragen und Problemlagen antwortete.
Dies hat Kiesswetter ausführlich dargestellt und die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen skizziert. Er dokumentiert dabei auch die analogen Phasen gesellschaftlicher und genossenschaftlicher Entwicklungen, von der Organisation von Arbeit, Existenzsicherung und grundlegender Versorgung bis in die 1970er Jahre, zum anschließenden Aufbruch der Sozialgenossenschaften zur Organisation der sozialen und gesundheitlichen Dienste, die der Veränderung der Familienstrukturen, der Urbanisierung und der wachsenden Erwerbstätigkeit der Frauen Rechnung tragen sowie der Bürgergenossenschaften, die komplexe Aufgaben des Gemeinwesens, wie den Erhalt der Infrastrukturen oder die öko-soziale Entwicklung des Gemeinwesens verfolgen und auch als Alternative zur Privatisierung anzusehen sind.
Bewundernswert auch, der Kampf der kleinen Sozialgenossenschaften der Libera-Terra-Bewegung gegen das organisierte Verbrechen. Dies ist ein weltweit einzigartiges und heldenhaftes Beispiel des erfolgreichen Zusammenspiels zivilgesellschaftlicher Kräfte der Genossenschaftsbewegung mit staatlichen Kräften im Kampf für eine Kultur der Legalität.
Bemerkenswert am italienischen Weg ist, dass der Veränderungsdruck von unten auch zur permanenten Anpassung der gesetzlichen Grundlagen geführt hat, während Deutschland fast fünfzig Jahre an einer einzigen Genossenschaftsreform gearbeitet hat, die dann 2006 endlich erlassen wurde.
Das italienische Genossenschaftswesen konnte zudem die historische Phase des italienischen Faschismus weitgehend unbeschadet überleben, denn in Italien existieren gesellschaftstragende Strukturen unterhalb der jeweiligen Regime. Darum ist Italiens Genossenschaftskultur so lebendig. Sicher liegt einer der Gründe darin, dass Menschen in Italien vielfach Lösungen für politische, soziale und ökonomische Probleme immer selber schaffen mussten. Es gibt, insbesondere im Süden Italiens Bereiche, bei denen man von Staatsversagen sprechen kann und was den Arbeitsmarkt betrifft, auch von Marktversagen. Die neueste Studie über das organisierte Verbrechen im Umgang mit Geflüchteten in der Landwirtschaft zeigt erschreckende Zahlen aber keine staatliche Intervention.3
Mit Blick auf die Sozialgenossenschaften, die oft als beispielhafte Ansätze sozialer Innovation anzusehen sind ist zu betonen, dass es in Italien vielfach an Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens mangelt und Betroffene bzw. ihre Angehörigen zur genossenschaftlichen Selbsthilfe griffen und greifen müssen. Während Deutschlands Wohlfahrtswesen unter der Macht und dem Eigeninteresse der Wohlfahrtskonzerne erstarrt und sich immer weiter von den Interessen der Anspruchsberechtigten des Sozialstaates entfernt, hat Italien zwar kreative lokale Sozialgenossenschaften, aber diese sind keine Regeleinrichtungen und garantieren damit nicht die generelle Versorgung im jeweiligen Bereich.
Für das deutsche Verständnis des Genossenschaftswesens lässt sich stellvertretend Artikel 153 der bayerischen Verfassung von 1946 heranziehen, der zwar zunächst erstaunlich kritisch klingt, jedoch auch den spezifisch mittelständischen Charakter des deutschen Genossenschaftswesens spiegelt: Die selbständigen Kleinunternehmen und Mittelstandsbetriebe (…) sind in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen. Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu sichern, vom Staat zu unterstützen. (…)
Der sozialreformerische Charakter von Genossenschaften wurde in Deutschland seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur vernachlässigt, sondern z. T. explizit negiert. Genossenschaften dienten der Stärkung der Kleinunternehmen gegenüber den großen industriellen Konzernen aber auch gegenüber den Habenichtsen, die als nicht selbsthilfefähig4 deklariert wurden. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Genossenschaften als demokratische Strukturen systematisch bekämpft und der Großteil bis Anfang der 1940er Jahre aufgelöst (Brendel 2011).
Genossenschaften als demokratische Alternativen, die von den Mitgliedern demokratisch gesteuert werden, waren nicht mit dem Führerprinzip vereinbar. Die kapitalorientierten Genossenschaften im Kredit- und Wohnungsbereich wurden dem Führerprinzip unterstellt – verloren aber damit ihren Kern genossenschaftlicher Wirtschaftskultur – und wurden zum Zusammenschluss in große Einheiten gezwungen, was mit einem Verlust der Mitgliederidentifikation einherging. Sozialreformerische Konsum- und Produktivgenossenschaften wurden verboten.
Deutschlands Genossenschaftswesen hat sich von diesem Identitätsverlust auch in der Nachkriegszeit und den folgenden Jahrzehnten nur schwer erholt. Das historische Gedächtnis für die genossenschaftliche Alternative war gelöscht und monopolartige Verbände kontrollierten und kontrollieren weiterhin die Genossenschaftslandschaft, die in der Folge erstarrte und auch aufgrund der hohen Kosten und des enormen Aufwandes kaum neue Gründungen verzeichnete.
Hierzu trug auch die besondere Entwicklung im Osten Deutschlands bei, wo staatskollektivistische Genossenschaften kaum Bezüge zur demokratischen Genossenschaftskultur erkennen ließen. Gerade in der Phase der Wende hätten genossenschaftliche Lösungen für zahlreiche DDR-Betriebe eine Alternative zur Schließung oder zur Übernahme durch Investoren dargestellt, doch sowohl die mächtigen Kapitalinteressen als auch die Hoffnungen der Bevölkerung nach den Erfahrungen der Mangelwirtschaft ließen diese Lösungen nicht zu. Das falsche Verständnis, das mangelnde öffentliche Interesse und das fehlende historische Gedächtnis waren sowohl Folgen als auch Ursachen einer marginalen Position der Genossenschaften in der deutschen Unternehmenslandschaft.5
Genossenschaften als lebensweltlich verankerte Form des Wirtschaftens, gewinnen vor dem Hintergrund der ökosozialen Wende eine neue Bedeutung. Sie kompensieren nicht nur Mängel und Fehler der Funktionssysteme Staat und Markt, sondern sind durchaus auch in ihrer eigenen Logik als gesellschaftliche Innovatoren, Korrektive und Gegenentwürfe zur reinen Kapitallogik zu betrachten. Aus der Perspektive der gesellschaftlichen Erfordernisse sind Genossenschaften Medien der Transformation und einer Entwicklung im Kontext der reflexiven Modernisierung.6 Die Auseinandersetzung mit dem italienischen Genossenschaftswesen öffnet die Perspektive für neue Politiken der Möglichkeit.
Susanne Elsen
Prof. Dr. Susanne Elsen
Full Professor Social Sciences
Free University of Bolzano
Viale Ratisbona 16
I - 39042 Bressanone (BZ)
1 Giovanni di Lorenzo Saviano, R./Di Lorenzo, G.: Erklär mir Italien! Köln, 2017, S. 9.
2 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
3 CGIL FAI 2016 Agromafie e Caporalato. Roma: EDIESSE
4 Elsen, Susanne 2007 Die Ökonomie des Gemeinwesens. Weinheim und München: Juventa.
5 Elsen, Susanne, Walk, Heike 2016 Genossenschaften und Zivilgesellschaft. Historische Dynamiken und zukunftsfähige Potentiale einer öko-sozialen Transformation. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen. 29. Jahrgang, Heft 3, 2016, S. ...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Zum Geleit
- 2. Vorwort
- 3. Warum dieses Buch?
- 4. Die Aktualität des genossenschaftlichen Gedankens aus italienischer Sicht
- 5. Die Entstehung der italienischen Genossenschaftsbewegung
- 6. Besonderheiten des italienischen Genossenschaftswesens
- 7. Die Sozialgenossenschaften – Cooperative sociali
- 8. Cooperative di comunità – Die Bürgergenossenschaften
- 9. Weitere genossenschaftliche Erfolgsmodelle in Italien
- 10. Südtirol als Schnittstelle unterschiedlicher Genossenschaftskulturen
- 11. Schlusswort
- 12. Anlage
- Über den Autor
- Impressum