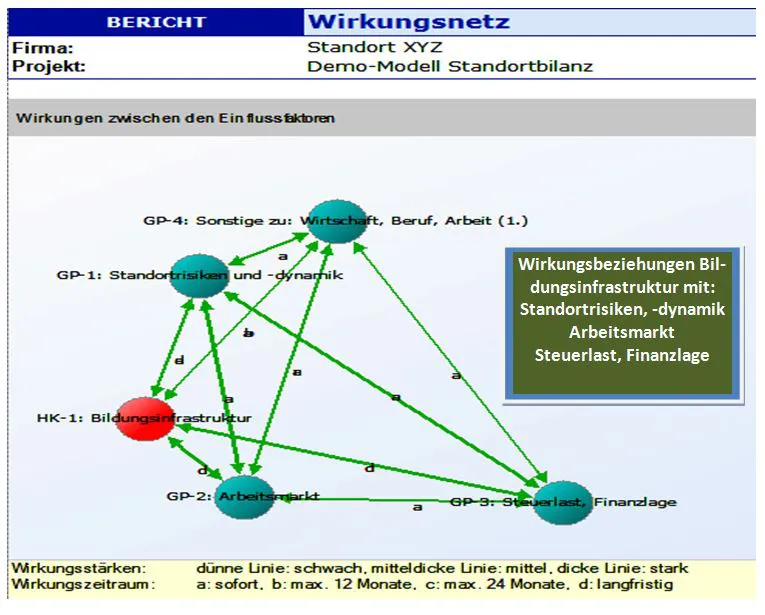![]()
1 Schulen im
Netz der Standort-Wirkungsbeziehungen
Methodische Aufbereitung anhand graphischer Wirkungsnetze –
Analyse von Stärke und Dauer. Es wäre zu einfach, bestimmte
Einflussfaktoren eines Standortes nur isoliert betrachten zu
wollen: die Aussagekraft solcher Indikatoren hängt vielmehr von
ergänzenden Informationen und Darstellungen zu den sie umgebenden
Bedingungsverhältnissen ab. Komplexe Sachverhalte, wie sie bei
komplexen Wirkungsbeziehungen zwischen einem Standort und dort
angesiedelten Schulen gegeben sind, lassen sich nicht bequem mit
einigen reduzierten Kennzahlen aufbereiten.
Vgl. u.a. Kabarett Bildung
http://www.youtube.com/watch?v=M_sVIX8axiI
Damit daraus abgeleitete Ergebnisse zu einer wirklichen
Informationsquelle und hilfreichen Entscheidungsunterstützung
werden können, müssen sie mit Hilfe einer geeigneten Methodik
sowohl hinsichtlich ihrer Entstehungsverhältnisse als auch in ihrem
gesamten Beziehungsgeflecht transparent gemacht werden. Zur
Veranschaulichung können hierzu graphische Wirkungsnetze einen
wesentlichen Beitrag leisten. Zur richtigen Bewertung einer
spezifischen Standortsituation und -problematik geht es
darum, ein System zur möglichst vollständigen Erfassung aller
relevanten Wirkungsmechanismen zu entwickeln
Wie alle anderen auch ist eine Schule auch, aber nicht nur, im
Internet „verwebt“. Noch weit mehr ist sie aber mit vielen,
vielleicht allen der sie umgebenden Standortfaktoren Teil eines
dynamischen Wirkungsnetzes. Eine Schule bleibt nach dem Abgang
ihrer Schüler nicht etwa in ihrer eigenen Welt zurück, sondern ist
Bestandteil eines höchst komplexen Standort-Umfeldes. Glaube man
nicht, dass Schulen von auf uns alle einstürmenden Entwicklungen
der Globalisierung ausgenommen seien. Grundsätzlich betrachtet
könnte im Rahmen einer Analyse und Darstellung von
Wirkungsbeziehungen Standortfaktor für Standortfaktor klargemacht
werden, welche Wirkungen berücksichtigt werden müssen
beispielsweise für die Beziehungen zwischen: Bildung, Wissenschaft,
Innovation einerseits, sowie andererseits:
Wirtschaft, Beruf, Arbeit
Kultur, Tourismus, Freizeit
Verkehr, Bauen, Wohnen
Familie, Gesundheit, Soziales
Oder der Fokus wird darauf gerichtet, in welcher Form,
Stärke und Dauer der Einzelfaktor Bildungsinfrastruktur auf die
übrigen angenommenen Faktoren, d.h. u.a.:
Standortrisiken und -dynamik
Arbeitsmarkt
Steuerlast, Finanzlage
Kulturinfrastruktur
Fremdenverkehr
Lebensqualität + Image
Gründer- und Patentintensität
Wissensintensive Dienstleistungen
Erreichbarkeit
Wohnungs- und Häusermarkt
Gewerbeimmobilien
Bevölkerungsstruktur, Demografie
Medizinische Versorgung, Pflege, Kita
Kaufkraft/BIP pro Einwohner
aktiv einwirkt bzw. umgekehrt von jedem dieser Faktoren jeweils
auch passiv beeinflusst werden kann (Rückkoppelungseffekt).
![]()
2
Flickenteppich Schullandschaft
G9, G8 oder doch wieder lieber G9 ? Lehrpläne und Qualität des
Unterrichts – Reife und Sozialverhalten – Beherrschung Lernstoff –
Transfer und Anwendung von Wissen – Kompetenzen sichern. Seit der
Umstellung von G9 auf G8 gilt immer häufiger: alles kehrt marsch,
marsch. Zweifel sind angebracht, ob dies wirklich alles nur zum
Wohle der Betroffenen – gemeint sind diese selbst und nicht deren
Eltern – geschieht. Da gibt es Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 oder
die Möglichkeit, auch einmal eine Klasse überspringen zu dürfen.
Doch zukünftige Arbeitgeber zeigen sich unzufrieden, denn:
Schulabgänger würden den gelernten Stoff nicht beherrschen
Schulabgänger könnten ihr Wissen nicht richtig anwenden
Abiturienten hätten noch eine gewisse geistige Unreife und
Defizite im Sozialverhalten
Abiturienten würden nicht mehr dieselbe Reife mitbringen, wie es
vor der G8-Einführung der Fall war
Trotz allen guten Willens der Akteure sind dies unüberhörbare
Warnzeichen. Zwar wird allgemein anerkannt, dass es besser sei,
früher in den Beruf einzusteigen, als später in Rente zu gehen.
Stattdessen wird erwartet, dass sich viele G8-Abiturienten erst
einmal ein Jahr Auszeit gönnen, um noch an Lebenserfahrung und
Kompetenz zu gewinnen. Unabhängig von allen Reparaturversuchen gilt
jedoch wie eh und je: wichtigste Erfolgsfaktoren sind Entschlackung
der Lehrpläne sowie Qualitätsniveau von Unterricht und Lehrern.
![]()
3 Schule auf
der Waagschale des Standortes
Faktor Bildung im Standortvergleich - Pisa kreiert pädagogische
Einheitswährung – Gleiche Bildungskompetenzen – humanistisches
Ideal –– Kontrollbürokratie – Pisa und Zwang zur Anpassung.
Wenn Standorte heute miteinander mehr und mehr auch nach dem Faktor
Bildung verglichen werden, sitzt jede der an einem Standort
befindlichen Schulen mehr oder weniger direkt mit in diesem Boot.
Denn immer sind gerade Schulen eine der wichtigsten Komponenten in
einem Bildungsmonitor. D.h. Schulen entscheiden nicht nur darüber,
wie es ihnen selbst ergeht, sondern ebenso mit darüber, welche
nachhaltigen Perspektiven und Potenziale der gesamte sie tragende
Standort auf die Waagschale bringt.
Hierfür wurde beispielsweise auf Ebene der Bundesländer ein
spezieller Bildungsmonitor entwickelt: für den Bildungsmonitor
werden keine eigenen Studien gemacht, sondern vorhandene
Statistiken ausgewertet. Zum Beispiel: die Ergebnisse der Länder
bei den Pisa- und Iglu-Studien, die Leistungen von Mittelstufen-
und Grundschülern in den Bundesländern vergleichen. Losgelöst von
nationalen und regionalen Bildungstraditionen wird mit Pisa so
etwas wie eine pädagogische Währung kreiert. Ebenso wie hinter der
Einführung des Euro das politische Streben nach mehr
wirtschaftlicher Gleichheit stand wird mit der Betonung von Pisa so
etwas wie eine Gleichheit der Bildungskompetenzen angestrebt. Durch
Pisa als pädagogisch vereinheitlichte Währung werden auf nationaler
Ebene Anpassungsreaktionen vom Kindergarten bis hin zur Universität
erzwungen: wer nicht mitmacht, verliert international an
Ansehen.
Im immer härteren Kompetenzwettbewerb droht das humanistische
Ideal des selbstverantwortlichen Individuums unterzugehen.
Kreativität und Flexibilität stehen gegen outputorientierte
Lehrpläne. Schulen werden zu wirtschaftsbezogenen Quasimärkten mit
Merkmalen wie u.a. Konkurrenzstreben, Performancekontrolle,
Ertragskalkulationen oder Marktkonformität. Im Vordergrund einer
Kontrollbürokratie steht über allem die Nutzenoptimierung. Die
Auswirkungen auf Soziale Kompetenz, Solidarisches Verhalten,
Urteilsvermögen oder Wohlbefinden werden nirgendwo vermessen.
Bleibt zu hoffen, dass die pädagogische Einheitswährung Pisa nicht
zu gleichen Problemen führt wie die monetäre Einheitswährung Euro,
mit der bereits ganze Staaten bis an den Rand des Abgrundes
gelangten.
![]()
4
Umgangssprache aus Sprachmischungen
Am Beginn eines allumfassenden Sprachwandels - Grammatisches
Rückbauunternehmen Zukunftsdeutsch – Satzstrukturen versimpeln –
Formenreichtum des heutigen Deutsch verschwindet – grammatische
Feinheiten werden eliminiert. Unerheblich ist, wann genau
eigentlich die deutsche Sprachlandlandschaft in Bewegung geriet und
Elemente fremder Sprachen aufzunehmen begann. Ein
50-Jahre-Rückblick auf Abi63-Zeiten bietet jedoch Anlass, einmal im
Vergleich zu damals auf heutige Verschleifungen und Versimpelungen
der Umgangssprache, Sprachmischungen und grammatische Minimalismen
zu schauen. In der FAZ steht unter Bezug auf U. Hinrichs
(Multi-Kulti Deutsch) zur Zukunft des heutigen Deutsch geschrieben:
Kasusendungen werden abgeschliffen, grammatische Übereinstimmungen
zwischen den Wörtern im Satz spielen kaum noch eine Rolle.
Präpositionen stehen zur beliebigen Verwendung, das grammatische
Geschlecht ist eingedampft, Der Konjunktiv geht den Bach hinunter,
die Satzstrukturen versimpeln.
In Internet-Chats, Krawall-Shows und Vulgär-Comedies wird das
Ideal der deutschen Hochsprache mit Füßen getreten. Jugendliche
mischen aus verschiedenen Sprachfetzen einen sogenannten „coolen“
Slang. Grammatische Feinheiten werden brutal eliminiert, vom
Formenreichtum der deutschen Sprache bleibt kaum etwas übrig. Was
ein Satz bedeutet, hängt heute immer weniger von ihm selbst sondern
immer stärker vom umfließenden Kontext ab. Hauptsache ist:
Verständigung muss halbwegs funktionieren, für Feinheiten bleibt
dabei wenig Raum. Vielleicht bietet die englische Sprache mit ihrer
bereits am weitesten reduzierten Wortgrammatik Trost: „sie büßte
bereits im Munde der Kelten, Wikinger und Normannen über die
Jahrhunderte hinweg viele ihrer grammatischen Feinheiten ein (W.
Krischke).“
![]()
5 Abi63 und
Sozialkunde
Nicht systemrelevantes Nebenfach – Gegenüber manchem anderen
Ballast an Schulwissen gering geachtet - Acht Millionen
Wählerstimmen ohne Wert – Parteimitglieder ohne Mandat –
Großkoalitionäre Regierungsbildung. Im Rückblick von nunmehr 50
Jahren gab es zu Abi63-Zeiten ein Fach „Sozialkunde“. Als nicht
systemrelevantes Nebenfach leider wenig gewürdigt und schon gar
nicht geachtet. Sozialkunde – eher ein „Füllfach“ als
Verschnaufpause zwischen Systemrelevanten Fächern oder zum Ausklang
eines anstrengenden Schultages. Als mehr oder weniger lästiges
Beiwerk von hierin kaum ausgebildeten Lehrern, sondern als
Anhängsel eines gerade verfügbaren Hauptfach-Lehrers
unterrichtet.
So manches mühsam erworbenes Schulwissen wurde im späteren
Berufsleben als Ballast abgeworfen. Von jener so gering geachteten
Sozialkunde hätte man jedoch an vielen Stellen ein Mehr gebrauchen
können. So scheinen sich Bilder von seinerzeit vermittelten
Demokratie-Idealen mit der heutigen großkoalitionären
Regierungsbildung zu beißen. Obwohl rein formal wenig zu
beanstanden sind auf der einen Seite wohl über acht Millionen
Stimmen von FDP-und AfD-Wählern unter den Tisch gefallen.
Demgegenüber stehen wenige hunderttausend SPD-Mitglieder, die
darüber entscheiden, ob ein von den politischen Spitzen des Landes
ausgehandeltes Regierungsprogramm ihnen genehm ist oder nicht.
Parteimitglieder, die hierzu nicht einmal von der eigenen
Wählerschaft legitimiert worden sind. Vielleicht zog jener
Sozialkundeunterricht zu Abi63-Zeiten zu wenig Aufmerksamkeit auf
sich oder hinterließ einfach die falschen Eindrücke. Nämlich
solche, nach denen hier kein Vorbild an Demokratie, sondern eher
das Diktat einer Minderheit vorgeführt wird.
![]()
6 Nach dem Krieg - Umfeld Schule
Man hielt noch etwas mehr zusammen, die Gesellschaft war noch nicht so gespalten wie heute. Das ist die gute Seite, wenn alle nicht viel haben. Kein Neid und wenig Gier, auf was denn a...