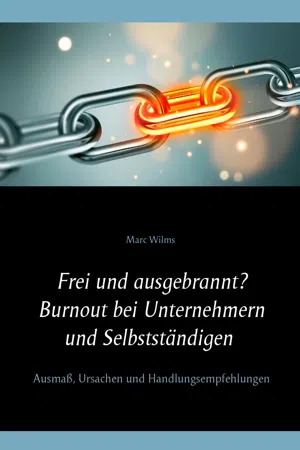![]()
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Untersucht wird die Problematik des Burnout-Syndroms in der Gruppe der nichtabhängig Berufstätigen. Hierunter fallen im Rahmen der vorliegenden Arbeit Freiberufler, Gewerbetreibende, Handwerker und Inhaber kleiner bis mittelständischer Unternehmen (= inhabergeführte Betriebe). Die Teilgruppe der Ein-Personen-Unternehmen wird in die Untersuchung einbezogen, da deren Inhaber in der Regel sowohl operativ als auch strategisch voll in den Arbeits- und Betriebsprozess eingebunden sind und ihnen weniger Instrumente zur Entlastung von Aufgaben zur Verfügung stehen als Lenkern größerer Organisationseinheiten (z.B. mangelnde Möglichkeit der Delegation von Aufgaben). Klein(st)unternehmer sind meist nahezu „alles in einem“ – vom Auftragsakquisiteur über den Finanzcontroller bis hin zum Strategen, der über den Tag hinaus planen muss. Häufig sind sie nur projektweise ohne längere Kündigungsfristen und für wenige Auftraggeber tätig. Dementsprechend sind Selbstständige vielfältigem Druck und zahlreichen Risiken (wie z.B. permanente Arbeitsüberlastung, fehlende Erholungsphasen, Machtlosigkeit, Zeitmangel, Perfektionsdrang aus Angst vor Auftragsverlust, ständige Erreichbarkeit und soziale Isolation) ausgesetzt, was zu Burnout führen kann – und des Einsatzes spezifischer Vorbeugungs- und Gegenmaßnahmen bedarf.
1.2 Leitfragen der Untersuchung
Wie stark sind Freiberufler und Gewerbetreibende vom Burnout-Syndrom betroffen? Welche Folgen hat dies beruflich/geschäftlich, privat und gesundheitlich für sie? Wie können sie vorbeugen und welche Gegenmaßnahmen stehen ihnen zur Verfügung?
1.3 Methode
Die Untersuchung stützt sich auf die Auswertung von Quellen: Die Fachliteratur zum Thema wird im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand resümiert.
![]()
2. Definitionen
2.1 Das Burnout-Syndrom
Bislang gibt es noch keine einheitliche Definition: Ärzte, Soziologen und Psychologen diskutieren kontrovers über die genaue Bedeutung und Abgrenzung von Burnout gegenüber anderen Erkrankungen (vgl. Krypta 2008, S. 17 f.). Immerhin sind nach übereinstimmender Expertenmeinung drei Kennzeichen für das Burnout-Syndrom typisch: emotionale Erschöpfung, das Gefühl der Entfremdung (Depersonalisation) und ein reduziertes Gefühl für die eigene Kompetenz bzw. abnehmende Leistungsfähigkeit (vgl. Karsten 2010, S. 27).
Letztgenannter Aspekt ist jedoch in Anfangsphasen von Burnout oft nicht zu erkennen, da die Betroffenen zunächst noch mehr arbeiten, um ihr Pensum zu bewältigen und der Leistungsabfall dann erst später sichtbar wird (vgl. Bergner 2010, S. 10). Konsens besteht darüber, dass sich Burnout in zwölf Stufen vollzieht (Abbildung nach Nagel 2010, S. 175):
| Stadium 1 |
Der Zwang, sich zu beweisen |
| Stadium 2 |
Verstärkter Einsatz |
| Stadium 3 |
Subtile Vernachlässigung eigener Bedürfnisse |
| Stadium 4 |
Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen |
| Stadium 5 |
Umdeutung von Werten |
| Stadium 6 |
Verleugnung auftretender Probleme |
| Stadium 7 |
Rückzug |
| Stadium 8 |
Beobachtbare Verhaltensänderungen |
| Stadium 9 |
Depersonalisierung, Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit |
| Stadium 10 |
Innere Leere |
| Stadium 11 |
Depression |
| Stadium 12 |
Völlige Erschöpfung, Zusammenbruch |
Bei Burnout handelt es sich stets um das Zusammenspiel mehrerer Stressfaktoren, die sich nach und nach aufstauen und letztendlich, wenn sie nicht gelöst oder bewältigt werden, im Zusammenbruch münden (vgl. Krypta 2008, S. 38). Nach dem international anerkannten Klassifikationssystem zur Diagnose von Krankheiten, das auch die Grundlage der Kommunikation zwischen Medizinern und Krankenversicherern bildet, ist Burnout allerdings gar kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern stellt lediglich eine Rahmen- oder Zusatzdiagnose dar (vgl. Nelting 2010, S. 31).
Burnout entsteht nie plötzlich, sondern entwickelt sich immer in einem längeren, fortschreitenden Prozess – häufig über Jahre hinweg. Dabei gilt es zwei Begriffe zu unterscheiden: „Burnout-Syndrom“ umfasst die Gesamtheit aller Gesundheitsstörungen des Betroffenen auf der körperlichen und psychischen Ebene. Im Gegensatz dazu bezeichnet „Burnout“ im eigentlichen Sinne einen Zustand, in dem der Patient bereits massiv erkrankt und akut behandlungsbedürftig ist (ebd, S. 30). In dieser Phase ist er meist schon depressiv und leidet an Herz- und Kreislaufstörungen sowie Magenbeschwerden, die Stresshormone und das Immunsystem sind aus dem Gleichgewicht geraten, die Wahrnehmung ist gestört, und es liegt ein ausgeprägter physischer und psychischer Erschöpfungszustand vor (ebd., S. 34).
Wissenschaftler nennen mehr als 130 mögliche Symptome, entsprechend schwierig gestaltet sich die Diagnose von Burnout. Die Behandlung durch Ärzte erfolgt dann häufig entsprechend symptombezogen mittels Psychopharmaka oder Schmerzmitteln, ohne die zugrunde liegenden Ursachen zu analysieren (vgl. Krypta 2008, S. 51, S. 99). Da viele dieser Beschwerden wenig spezifisch sind und sich mit anderen Gesundheitsstörungen überschneiden, fällt die Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern oftmals schwer; Experten vermuten daher bei den Fallzahlen eine hohe Dunkelziffer – hinter vielen diagnostizierten Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen, chronischen Erschöpfungszuständen, Herzinfarkten und Selbstmorden steht vermutlich in Wahrheit Burnout (vgl. Nelting 2010, S. 42).
Nach dem aktuellen Forschungsstand lassen sich die Anzeichen für Burnout in sieben Phasen einteilen. Demnach sind in der Anfangsphase erste Warnsignale zu erkennen wie verstärkter Einsatz für Ziele unter Inkaufnahme von Überstunden bei zunehmender Erschöpfung, und die Betroffenen widmen dem Privatleben weniger Zeit als früher. Bereits in der zweiten Phase kommt es zur Aversion gegenüber der eigenen beruflichen Tätigkeit und einer Reduktion des Engagements für Kunden und Familienmitglieder – verbunden mit emotionaler Kälte, Verlust an positiven Gefühlen und Einfühlungsvermögen. Die dritte Phase ist gekennzeichnet von Symptomen aus dem depressiven Formenkreis, schlechter Laune, Ärgerlichkeit und einer vorwurfsvollen Haltung gegenüber anderen.
In der vierten Phase treten ein Abbau der Kreativität, Motivation und geistigen Leistungsfähigkeit sowie die Ablehnung von Veränderungen ein. In der fünften Phase verflachen alle Emotionen, der Betroffene wird immer gleichgültiger und interesseloser, sowohl was den Beruf als auch soziale Kontakte und Freizeitbeschäftigungen angeht. In der sechsten Phase meldet sich der Körper mit massiven psychosomatischen Beschwerden zu Wort, und in der Endphase schließlich macht sich Verzweiflung breit: Der Erkrankte sieht keinen Sinn mehr und gibt alle Hoffnung auf. Kommt es nicht spätestens an diesem Punkt zur Intervention, folgt der Kollaps als vollendeter Burnout, in dem alle körperlichen und psychischen Kräfte kollabieren (vgl. Krypta 2008, S. 66 ff.). Zu bedenken ist allerdings, dass vereinzelte psychosomatische Beschwerden sich auch schon in früheren Phasen des Prozesses zeigen können (ebd, S. 99).
2.2 Unternehmer, Selbstständige und Ein-Personen-Unternehmen
In Deutschland sind mehr als vier Millionen Menschen und damit über elf Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung selbstständig tätig, die meisten davon entweder als Solo-Selbstständige oder Inhaber sehr kleiner Unternehmen, beispielsweise als freier Mitarbeiter im Dienstleistungssektor, klassischer Freiberufler, Kleingewerbetreibender oder Handwerker (vgl. Pröll/Udris 2009, S. 260). Vor allem die Zahl der Ein-Personen-Betriebe hat in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten stark zugenommen: Der Anteil der Alleinselbstständigen innerhalb der Unternehmerschaft liegt inzwischen bei 56 Prozent. Klein- und Kleinstunternehmen beschäftigen meist maximal zehn Mitarbeiter und arbeiten in der Regel voll mit (vg. Pröll, S. 298 f.).
Deutlich wird die Bedeutung des Mittelstandes für die deutsche Wirtschaft auch aus der übergreifenden Perspektive: Auf insgesamt 99,7 Prozent bringen es die kleinen und mittelständischen Unternehmen; viele von ihnen sind inhabergeführte Familienbetriebe, in denen sich der Chef und oftmals auch Angehörige mit ihrer Arbeitskraft einbringen. Großunternehmen bzw. Konzerne kommen hingegen lediglich auf einen Anteil von 0,3 Prozent (vgl. Brendt/Sollmann 2011, S. 3 f.).
Wesentliches Merkmal einer selbstständigen Tätigkeit sind das – im Gegensatz zu abhängig Beschäftigten – Fehlen der Weisungsgebundenheit sowie das Arbeiten und Auftreten am Markt in eigenem Namen und für eigene Rechnung. Selbstständige tragen die unternehmerische Verantwortung und übernehmen auch das finanzielle Risiko. Grob gliedern lassen sich die Selbstständigen in zwei Gruppen: Zu den Freiberuflern zählen beispielsweise Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Journalisten, Werbetexter, Architekten, Ärzte und Psychotherapeuten. Dem anderen großen Zweig der Selbstständigen gehören die gewerblichen Unternehmer aus Industrie, Handwerk und Handel an – exemplarisch auf eine Branche bezogen etwa Kfz-Werkstätten und der Pkw-Handel (ebda., S. 4 f.).
Obwohl auch Vorstände und Manager von Konzernen unternehmerisch tätig sind, zählen sie nicht zu den Unternehmern: Sie haften üblicherweise nicht finanziell und sind nicht in eigenem Namen und mit eigenen Produkten bzw. Dienstleistungen am Markt aktiv (vgl. Nelting 2010, S. 196).
![]()
3. Ausmaß von Burnout in Wirtschaft und Gesellschaft
3.1 Betroffene Personengruppen
In Deutschland leiden schätzungsweise mehr als sechs Millionen Erwachsene an Burnout (vgl. Nelting 2010, S. 44). Von den angestellten Berufstätigen sind laut Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissenschaft und Organisation mittlerweile zehn Prozent entweder von Burnout oder depressiven Erkrankungen betroffen (vgl. Ustorf 2011, S. 35).
Bezieht man in diesen Überblick auch noch das Phänomen des Stresses mit ein, wird deutlich, dass sich die Überlastungsproblematik sogar auf weite Teile der Bevölkerung erstreckt: Über 80 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich gestresst, jeder Dritte sogar permanent. Betroffen sind alle Bevölkerungsschichten, die Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren jedoch am stärksten (vgl. FAZ-Institut/Techniker Krankenkasse, S. 4 f.).
Für die kleineren und mittelständischen Unternehmen erwächst aus dieser hohen Zahl an gestressten oder sogar bereits ausgebrannten Personen eine besondere Herausforderung: Während in Konzernen die Personalabteilung und das betriebliche Gesundheitsmanagement für erkrankte Mitarbeiter zuständig sind, fühlen sich Betriebe ohne eine solche Struktur oftmals mit derartigen Erkrankungen überfordert – zum einen, weil Unkenntnis über den richtigen Umgang mit Betroffenen besteht, zum anderen aber auch, weil gerade in kleinen Betrieben bereits der Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters zu gravierenden Problemen führen kann (vgl. Ustorf 2011, S. 37).
Wurde Burnout in den 70er Jahren noch als ein Problem gesehen, das vornehmlich personennahe helfende und erzieherische Berufe wie Sozialarbeiter, Krankenschwestern, Lehrer und Ärzte betrifft, hat das Erkrankungsbild heute die Wissensökonomie – etwa den Medien- und IT-Bereich – in hohem Maße erfasst (vgl. Siebecke/Klatt/Ciesinger 2010, S. 49, S. 53).
Der Arbeitsmediziner Christian van de Weyer stellt fest, dass neben sozial Tätigen und Managern auch Freiberufler ein besonders großes Burnout-Risiko haben: Für viele von ihnen ist eine perfektionistische Einstellung kennzeichnend; diese Menschen wollen beruflich viel erreichen, um sich damit in ihrem Selbstwertgefühl zu bestätigen. Hochgradig gefährdet sind Menschen, die von zu Hause aus arbeiten und dadurch die Grenzen zwischen Beruf und Privatsphäre verschwimmen (vgl. Schiekiera 2...