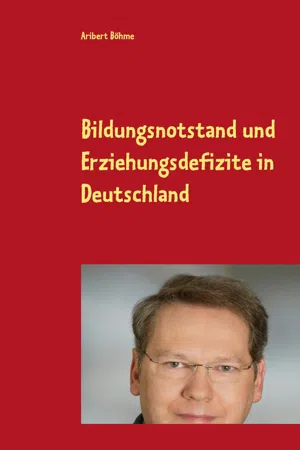![]()
01. Vorwort
In einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, das entscheidend auf die Ressource Bildung angewiesen ist, einem Land, dem nicht zuletzt durch die PISA-Studie dokumentiert worden ist, dass es empfindliche Defizite im Bildungsbereich hat, ist es an der Zeit eine ebenso schonungslose wie konstruktive Bestandsaufnahme vorzunehmen, die einerseits nach den Ursachen der zu beklagenden Misere fragt, anderseits Lösungswege zur Verbesserung des in Teilen bedenklichen Schulwesens aufzeigt.
Die u. a. in der PISA-Studie konstatierten Defizite sind nicht – wie leider vielerorts noch immer behauptet wird – ein „Naturgesetz“, bei dem sich eine wachsende Schülerzahl einer Situation gegenübersieht, die sozusagen „naturgegeben“ ist. Vielmehr ist unübersehbar, dass sich die in Teilen wenig erfreulichen Ergebnisse der PISA-Studie auf eine unheilvolle Mischung diverser Ursachen zurückführen lassen. Aus der Fülle möglicher Ursachen, die sich teils noch gegenseitig verstärken, seien hier nur genannt: Zunehmende Auflösung klassischer Familienstrukturen, eine wachsende Zahl Alleinerziehender, sich ausbreitende Ängste um die eigene wirtschaftliche Existenz, unstrukturierte und zuweilen chaotische Lebensverhältnisse, sinkende Leistungsbereitschaft, in Teilen mangelhafte Lehrerausbildung, fehlendes Einfühlungsvermögen in die Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen, eine offenbar wachsende Zahl überforderter Eltern, Missachtung elementarer Erziehungsregeln, fehlende Führungskompetenzen auf Seiten mancher Eltern sowie einiger LehrerInnen, fehlende Vorbilder, unkontrollierter Medienkonsum, fehlende Aufmerksamkeit Kindern gegenüber, wachsende Ignoranz, schwindendes Wertesystem, fehlende Vermittlung von Tugenden, zuweilen nicht ausgeprägte Konsequenz beim Durchsetzen wichtiger Erziehungsbausteine usw. Diese Liste ließe sich problemlos erweitern.
Im Interesse einer differenzierten Analyse sei klar gesagt, dass eine Pauschalkritik, wie sie andernorts zu lesen gewesen ist, bei der z. B. der Eindruck suggeriert werden sollte, alle LehrerInnen seien pädagogisch unfähig, einerseits schlichtweg falsch ist, anderseits nur als polemisch bezeichnet werden muss. Ebenso sei schon an dieser Stelle klar gesagt, dass es viele sehr engagierte Eltern gibt, die sich vorbildlich um die Erziehung und Bildung ihrer Kinder kümmern. Ebenso offensichtlich ist aber, dass es bedauerlicherweise eine wachsende Zahl Eltern gibt, die sich entweder nur noch sehr rudimentär, oder in Teilen auch gar nicht mehr um eine konstruktive und notwendige Erziehung ihrer Kinder kümmert. Auf Seiten der Lehrerschaft ist zudem mit Sorge festzustellen, dass die Unterrichtsqualität sowie vor allem auch pädagogische Fähigkeiten bei einer nicht unerheblichen Zahl von Lehrerinnen und Lehrern wenig rühmlich sind, mit der ebenso unerfreulichen wie perspektivisch bedenklichen Konsequenz, dass das u. a. in der PISA-Studie zu recht beklagte Leistungsniveau weiter sinken wird. Dem gegenüber gibt es fraglos auch viele LehrerInnen, die mit großer Fachkompetenz und sehr viel Engagement einen qualitativ hochwertigen Unterricht anbieten bzw. anbieten möchten. Ebenso bedauerlich wie bedenklich ist aber, dass es zunehmend schwieriger geworden ist, unter den sich teils dramatisch verschlechterten Rahmenbedingungen eine Unterrichtsqualität anzubieten, die einerseits mit Blick auf konstruktive Zukunftsperspektiven zwingend wäre, anderseits im Interesse einer persönlichen Weiterentwicklung auch wünschenswert ist. Ein unverhältnismäßig großer und nicht zu verantwortender Teil der täglichen Energie, die LehrerInnen aufbringen müssen, gilt nicht mehr den zu vermittelnden Wissensinhalten, sondern vielmehr einem nicht selten erfolglosen Versuch, undisziplinierte und zunehmend verhaltensauffällige Kinder zu bändigen, die in einem oftmals unerträglichen Ausmaß jeden noch so gut strukturierten Unterricht schon im Ansatz ersticken. Die ebenso unübersehbaren wie perspektivisch dramatischen Folgen dieses beklagenswerten Missstandes lauten dann nahezu zwangsläufig: Schlechte Zeugnisse, mangelhafte Ausbildungsmöglichkeiten, wirtschaftliche Not, Frustration über fehlende gesellschaftliche Anerkennung, überdurchschnittlich hohe Krankenstände, fehlender Lebenssinn usw.
Kurz: Ein Teufelskreis, der seinen Ursprung entscheidend in einer schlechten Erziehungs- und Bildungsarbeit findet, den es im Interesse unserer Kinder einerseits sowie im Interesse einer perspektivisch günstigen Weiterentwicklung unserer gesamten Gesellschaft anderseits, dringend zu korrigieren gilt.
Diese hier beschriebene Bestandsaufnahme aus der Sicht eines seit 1988 tätigen, freiberuflichen EDV-Dozenten, 28fachen Buchautors, Psychologischen Beraters sowie Privatlehrers, beleuchtet die Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven, so dass ein ebenso repräsentatives, wie in weiten Teilen einheitliches Bild gezeichnet wird, das zu der ebenso offensichtlichen wie elementaren Erkenntnis geführt hat, die da lautet: Wehret den Anfängen. Ganz gleich, ob die vielfach beschriebene Bildungs- und Erziehungsmisere aus der Sicht einer Grundschule, einer weiterführenden Schule, eines Weiterbildungsinstituts usw. betrachtet wird, zeigt sich immer wieder, dass es letztlich elementarste Erziehungsregeln (Vermittlung von Werten, ein Wissen um Recht und Anstand, Erziehung zu Respekt und Disziplin, Toleranz und Mitmenschlichkeit, Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer usw.) sind, die vielfach entweder gar nicht mehr, oder nur sehr punktuell vermittelt werden, mit der unübersehbaren Konsequenz, dass geordnete und somit konstruktive Lernprozesse zunehmend erschwert, nicht selten sogar unmöglich gemacht werden.
Sinn und Zweck dieser Bestandsaufnahme ist es keineswegs Pauschalkritik zu üben. Ebenso wenig wie es die SchülerInnen gibt, ist es sinnvoll von den Lehrerinnen und Lehrern, oder von den Eltern zu sprechen. Allerdings gehört zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme sicher auch, dass offensichtliche Missstände klar und deutlich benannt werden, bei der auslösende „Schwachstellen“, wie z. B. überforderte Eltern und pädagogisch unfähige LehrerInnen im Interesse einer notwendigen und wünschenswerten Verbesserung nicht geschont werden dürfen.
Die entscheidende Motivation zur Publikation dieses Buches ist darin zu sehen, dass der Autor seit vielen Jahren mit einer Mischung aus Verwunderung und Verärgerung beobachtet, dass immer wieder unverhältnismäßig viel Energie auf das Einfordern von „Selbstverständlichkeiten“ ver(sch)wendet werden muss, so dass konstruktive Lernprozesse in einem sehr bedenklichen Ausmaß blockiert werden, wobei die dramatischen Folgen dann u. a. in der PISA-Studie zum Ausdruck kommen. Gerade im Interesse unserer Kinder ist es unverantwortlich, dass ihnen die Chance für eine gute Bildung u. a. schon dadurch genommen wird, indem verantwortlich leitende Lehrpersonen tagtäglich mit „Nebenschauplätzen“ beschäftigt werden, die da lauten: Einfordern elementarster Anstandsregeln, Auseinandersetzungen mit teils völlig chaotischen Kindern, Austausch mit Eltern, denen nicht selten selbst einfachste Benimmregeln fremd zu sein scheinen, Schlichten von nicht selten gewalttätigen Auseinandersetzungen usw. Kurz: Nahezu täglich wird viel zu viel Energie darauf ver(sch)wendet, überhaupt erst einmal einen auch nur ansatzweise passablen Rahmen für einen dann folgenden Unterricht zu ermöglichen. Eine solche Situation, wie sie sich – nahezu unabhängig von der jeweiligen Schulform – täglich beobachten lässt, ist einerseits absurd, anderseits unverantwortlich. Im Interesse all’ derer, die eine Schule als einen Ort begreifen möchten, an dem Kinder eine gute und zukunftsweisende Bildung und Erziehung erhalten sollen, wird es allerhöchste Zeit, dass sich vor allem auch solche Eltern und LehrerInnen zu Wort melden, die erkennbar unter den oftmals chaotischen und völlig inakzeptablen Zuständen in alltäglichen Schulsituationen leiden.
Die hier vorliegende Bestandsaufnahme möchte alle Eltern und LehrerInnen dazu ermutigen, klar und unüberhörbar daran mitzuarbeiten, dass sich die in Teilen bedenklichen Zustände an unseren Schulen entscheidend verbessern. Solange viele Eltern und LehrerInnen nur „im kleinen Kreis“ oder „hinter hervor gehaltener Hand“ ihren berechtigten Unmut äußern, gibt es kaum eine realistische Chance, dass vor allem solche Leute zum Umdenken gezwungen werden, die durch nicht selten verantwortungslose Ignoranz und Arroganz entscheidend dazu beitragen, dass es solche beklagenswerten Zustände an unseren Schulen gibt.
Vor dem Hintergrund unzähliger Gespräche mit Eltern und Lehrern, die der Autor im Laufe seiner langjährigen Lehrtätigkeit geführt hat, weiß er nur zu gut, dass es schon lange einen Nährboden für eine längst überfällige Veränderung chaotischer Zustände gibt. Bedauerlicherweise, wenngleich in Teilen auch nachvollziehbar, schrecken bisher viele Eltern aus Sorge vor möglichen Sanktionen gegen ihre eigenen Kinder davor zurück, klar und deutlich zu fordern, dass sich entscheidende Dinge im Schulalltag verändern müssen, damit Kinder überhaupt eine Chance auf eine gute Bildung bekommen. Ebenso offensichtlich ist es, dass auch viele LehrerInnen aus Angst sich im Lehrerkollegium zu outen, davor zurückschrecken, die Argumente, die sie „unter vier Augen“ kommunizieren, genauso deutlich anderen Kolleginnen und Kollegen sowie der Schulleitung gegenüber, offen aussprechen. Kurz: Offensichtlich chaotische und inakzeptable Zustände im Schulalltag werden nicht selten dadurch zementiert, indem verantwortlich „entscheidende“ Stellen zuweilen – wider besseres Wissen – Augen und Ohren verschließen, anstatt sich endlich um elementar notwendige Veränderungen zu kümmern. Es wird allerhöchste Zeit, dass sich alle Eltern und LehrerInnen guten Willens unübersehbar Gehör verschaffen, denn Schulen sollten nicht etwa ein Ort sein, an dem es sich einige Leute sehr bequem gemacht haben, auf Kosten derer, die aus naheliegenden Gründen noch nicht erkennen können, wohin eine „Reise“ geht, die von zuweilen pädagogisch unfähigen Lehrerinnen und Lehrern, begleitet wird.
Was wir brauchen sind einerseits Eltern, die erkennen, dass eine konstruktive Erziehung eben keineswegs einen Selbstzweck darstellt, sondern vielmehr eine elementare Voraussetzung dafür ist, Kindern einen konstruktiven und somit zielführenden Schulbesuch erst zu ermöglichen. Anderseits brauchen wir LehrerInnen, die sich nicht nur – wie zuweilen zu beobachten – Pädagogen nennen, sondern auch als solche handeln. Es ist schon mehr als befremdlich, zu sehen, dass es auf Seiten der Lehrerschaft Personen in einer nicht unerheblichen Zahl gibt, deren pädagogische Fähigkeiten alles andere als hinreichend sind. Ernsthaft verwundern kann dies nicht, da dieser so wichtige Teilbaustein im Rahmen der bisherigen Lehrerausbildung nicht in dem Maße geschult wird, wie es schlussendlich für alle Beteiligten notwendig und wünschenswert wäre.
In diesem Buch wird es nicht darum gehen „den schwarzen Peter“ nur von einer Seite zur anderen Seite zu schieben. Es ist auch nicht das erklärte Ziel, schon durch die Wortwahl einen Nährboden zu bereiten, der primär nur der Befriedigung einer billigen Polemik dient. Begriffe wie sie andernorts zu lesen sind, wie z. B. „Hass“, werden hier bewusst vermieden. Zum einen deswegen, weil eine derartige Wortwahl leicht dazu neigt, diffuse Ressentiments noch weiter zu schüren, zum anderen auch deswegen, weil dadurch Menschen abgeschreckt werden könnten, die letztlich entscheidend zur Verbesserung der teils sehr bedenklichen Situation im Schulalltag beitragen könnten. Zu einer schonungslosen Bestandsaufnahme gehört aber sehr wohl, dass klar als solche erkennbare und inakzeptable Verhaltensweisen seitens mancher Beteiligter (SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, Schulleitungen, Schulverwaltungen usw.) deutlich und ungeschönt dargestellt werden. Dies ist nicht zuletzt deshalb dringend notwendig, weil sich u. a. in vielen Gesprächen mit Betroffenen immer wieder gezeigt hat, dass noch immer vielen Eltern offenbar gar nicht bewusst zu sein scheint, unter welch’ extremen Bedingungen ihre Kinder an manchen Schulen lernen „dürfen“. Insofern ist eine schonungslose Beschreibung eine wesentliche Voraussetzung zum Einfordern und Begleiten sich verbessernder Rahmenbedingungen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die folgende Beschreibung subjektiv gefärbt ist, wobei sich der Autor nach besten Kräften darum bemüht, sachbezogen zu argumentieren. Jede Leserin und jeder Leser, der über ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen verfügt, wird nach der vollständigen Lektüre vermutlich nachempfinden können, dass es aber auch die eine oder andere Passage gegeben hat, bei der auch persönliche Befindlichkeiten bzw. Gefühlsdarstellungen vermittelt worden sind. Dies zu leugnen wäre unehrlich, und ist zudem auch nicht gewollt. Vor dem Hintergrund der Fülle einerseits sowie zuweilen eingedenk der persönlich verunglimpfenden Erfahrungen anderseits, die der Autor mit einigen Menschen machen „durfte“, wäre es wohl eher ungewöhnlich, wenn nicht auch zum Ausdruck gebracht worden wäre, dass hier eine Mischung aus Enttäuschung und Verärgerung entscheidend dazu beigetragen hat, deutlich mehr Eltern und LehrerInnen dahingehend zu sensibilisieren, endlich konsequent und nachhaltig dafür zu sorgen, dass eine immer wieder eingeforderte „gute Bildung für unsere Kinder“ nicht nur in schönen Sonntagsreden vorkommt, sondern vielmehr im gelebten Schulalltag.
Schon an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine äußerst komplexe Thematik handelt, die sicher nicht mit einem „Patentrezept“ gelöst werden kann. Anderseits soll aber klar und deutlich beschrieben werden, dass es entscheidend „elementarste Regelverletzungen“, gepaart mit einer in Teilen unübersehbaren Ignoranz und Arroganz seitens mancher Leute, sind, die maßgeblich dafür verantwortlich zeichnen, dass sich im Schulalltag chaotische und höchst bedenkliche Tendenzen haben entwickeln können, um nicht zu sagen, auf dem Vormarsch sind.
Diese hier vorliegende Bestandsaufnahme versucht Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, die sich „wie ein verhängnisvolles Krebsgeschwür“ durch weite Teile des Erziehungs- und Bildungswesen, ziehen.
Nicht zuletzt durch die interdisziplinäre Tätigkeit des Autors entsteht ein umfassendes Bild, das nicht bei einigen Teilaspekten verharrt, sondern es soll deutlich werden, welche Abhängigkeiten zwischen a) mangelhafter Erziehungsarbeit, b) schlechten Rahmenbedingungen in Teilen des Bildungswesens und c) Chancen im weiteren Lebensverlauf, bestehen.
Zur Person
Der Autor arbeitet seit 1988 als freiberuflicher EDV-Dozent in der Informatik-Ausbildung. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er ca. 8000 – 9000 Menschen; quer durch nahezu alle Bildungsschichten, in EDV-technischer Hinsicht unterrichtet. Zu seinem Kundenstamm gehören ebenso regional tätige Institute, wie weltweit operierende Softwareunternehmen. Des weiteren hat der Autor an öffentlichen Schulen diverse Unterrichtsangebote (EDV, Schach usw.) verantwortlich begleitet und ist als Leiter einer Hausaufgabenbetreuung tätig gewesen. Seine bis dato 24 Sachbücher und 3 Romane sowie seine Entwicklungsarbeit in der Neuroinformatik (Implementierung eines Neuronalen Netzes zur Prognose von Sportwetten) führten zur ehrenvollen Aufnahme in das WHO-IS-WHO-Lexikon (Deutschland & Europa). Regelmäßig unterrichtet und begleitet der Autor PrivatschülerInnen unterschiedlicher Schulformen, wobei er ein Schwergewicht auf die Vermittlung und das Training hilfreicher Lerntechniken legt. Abgerundet wird das Profil durch einen abgeschlossenen Fernlehrgang zum Psychologischen Berater, auf dessen Grundlage der Autor vor allem Kinder und deren Eltern psychologisch begleitet, die oftmals durch den Schulalltag sowie durch familiäre Rahmenbedingungen überfordert sind.
Nun wünsche ich Ihnen eine ebenso anregende, wie nachdenklich stimmende Lektüre, die hoffentlich ein wenig dazu beitragen kann, Eltern und LehrerInnen zunehmend dafür zu sensibilisieren, konstruktiv und tatkräftig daran mitzuwirken, dass sich die in Teilen schlimmen Zustände an unseren Schulen sowie die ebenfalls in Teilen beklagenswerten Rahmenbedingungen im häuslichen Umfeld, signifikant verbessern, damit unsere Kinder die Voraussetzungen zur Teilhabe an einer perspektivisch lebenswerten Zukunft bekommen.
Düsseldorf, im Frühjahr 2019, Aribert Böhme
![]()
02. Rahmenbedingungen
Schaut man nach möglichen Ursachen für die teils unübersehbar bedenklichen Zustände an unseren Schulen, sieht man sich zunächst einer hohen Komplexität gegenüber, die sich in unterschiedlichen Formen darstellt. Bei näherer Betrachtung wird aber schnell klar, dass ein erheblicher Teil der zu recht beklagenswerten Umstände auf relativ wenige Elementardefizite zurück geführt werden können, die da z. B. lauten:
- Fehlen klarer und verbindlicher Strukturen
- Zunehmende Respektlosigkeiten
- Missachtung klar formulierter Regeln
- Mangelhafte Erziehung
- Wenig ausgeprägter Gemeinschaftssinn
- Überforderte Eltern
- Zerrüttete Familienstrukturen
- Verwahrlosung der Sprache
- Fehlende Aufmerksamkeit
Darüber hinaus ist die Feststellung, dass die finanziellen Spielräume häufig unerfreulich begrenzt sind zwar richtig; ebenso wahr ist aber auch, dass ein nicht unerheblicher Teil der nachfolgend geschilderten Defizite entweder gar nichts, oder nur sehr rudimentär mit einer knappen Ausstattung von Finanzmitteln zu tun haben. Vielmehr fällt auf, dass es oftmals sehr elementare Erziehungsdefizite sind, die dann gehäuft zu beklagenswerten Folgen führen, wie sie hier aufgeführt werden. Von daher besteht eine konstruktive Problemlösung nicht ausschließlich in einer Aufstockung finanzieller Mittel, sondern vielmehr darin, Kinder wieder dahingehend zu erziehen, elementare Kompetenzen zum Besuch einer Schule zu erwerben, deren Grundlagen maßgeblich schon in den Elternhäusern erworben werden sollten. Allein die konsequente und nachhaltige Erziehung zu Werten wie Respekt, Toleranz, Empathie, Ordnungsliebe u. e. m. könnte entscheidend dazu beitragen, dass viele der beklagenswerten Rahmenbedingungen entweder gar nicht erst entstehen, oder zumindest deutlich reduziert werden.
Aus der Fülle der beobachtbaren Missstände seien hier einige zentrale Aspekte genannt, die sich nahezu täglich in weiten Bereichen des schulischen Umfelds machen lassen.
Schon beim Betreten mancher Schulhöfe bzw. Schulgebäude sieht man sich nicht selten verschmierten Wänden gegenüber, sieht überquellende Papierkörbe, mutwillig zerstörte Einrichtungsgegenstände, wie z. B. eingetretene Türen, abgerissene Kabel, verdreckte Klassenräume, deren Böden mitunter mehr einer Müllhalde gleichen usw.
Ein Blick in viele Toilettenräume treibt auch hartgesottene Zeitgenossen schnell in einen Zustand von ekelerregender Übelkeit. Fehlendes Toilettenpapier, nicht vorhandene Seife, übel riechende Räumlichkeiten, verdreckte Toilettenbrillen, defekte Wasserspülungen usw. Das alles trägt nicht gerade dazu bei, dass sich Kinder dort wohl fühlen können. Selbstredend ist sicher, dass solche Bedingungen schon unter hygienischen Aspekten nur als äußerst bedenklich eingestuft werden müssen.
Vor dem Hintergrund teils knapper Finanzmittel ist sicher nachvollziehbar, dass Schulbücher mitunter über mehrere Jahre von Kindern nachrückender Klassen benutzt werden. Nicht ernsthaft nachvollziehbar aber ist, dass sich viele Schulbücher schon nach kürzester Zeit in einem erbarmungswürdigen, oder besser, in einem unwürdigen Zustand befinden. Nur zu oft ist zu beobachten, dass manche Kinder keinerlei Sorgfalt beim Umgang mit Schulbüchern walten lassen. Da werden Schulbücher durch Klassenräume geworfen, da werden bereits auf dem Boden liegende Bücher mit Füßen getreten, da werden Bücher zu individuellen Bastelarbeiten missbraucht, es werden Schmierereien in den Büchern angebracht, Seiten mutwillig heraus gerissen usw. Kurz: Alles Verhaltensweisen, die entscheidend darauf zurück geführt werden können, dass vielen Kindern ein achtsamer Umgang mit wertvollen Materialien vielfach nicht beigebracht worden zu sein scheint. Die ebenso offensichtlichen wie bedenklichen Folgen solcher Grobheiten zeigen sich dann u. a. darin, dass nachrückende Klassen mit Lehrmaterial „versorgt“ werden, das schon auf den ersten Blick erkennen lässt, welch’ schlimmes Schicksal dem einen oder anderen Buch widerfahren sein muss. Nicht zuletzt aus lernpsychologischer Sicht ist leicht nachvollziehbar, dass eine ohnehin schon oftmals schwach ausgeprägte Lernmotivation bei einigen Kindern durch den Anblick derart vergammelter Lehrmaterialien nicht positiv verstärkt wird. Perspektivisch verhängnisvoll ist der Umgang mit verdrecktem und zers...