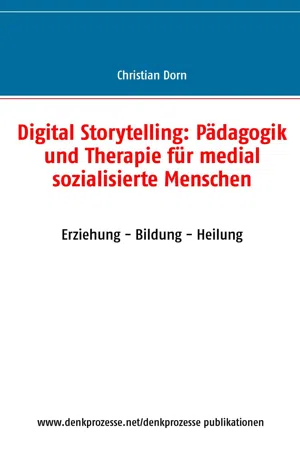![]()
Ein sich änderndes Bewusstsein ruftnach veränderter Technik, und eine veränderte Technik verändert das Bewusstsein.
(Flusser)
Kultur (und Medialität ist nichts anderes als durch „mediale Durchdringung“ transformierte Kultur) ist nicht gegeben, sie ergibt sich vielmehr aus erzähltem Erleben, das in Form erinnerter Geschichten kulturelle Identität resümiert, damit auch konzipiert und in Artefakten sowie Bewusstseins- und Handlungsstrukturen Gestalt annimmt. Diese kulturelle Matrix wird durch artikulationsgelenkte Aufmerksamkeit zu Bewusstsein und findet in einem Prozess der Rückbezüglichkeit von Erinnerung und Handeln ihre Fortsetzung. Mit Hilfe von in Erzählungen gefasster sprachlicher und nichtsprachlicher Zeichen und Symbole besteht die Möglichkeit, diese Matrix und ihre Wirkungen zu interpretieren, in Frage zu stellen und sie auch zu revidieren. Durch den Verlust der Sprache als Werkzeug der Kritik, deren Reduktion durch z.B. SMS, Chat, Foren, Werbung etc. sowie deren Substitution durch manipulierte digitale Kommunikate (Bilder, Videoclips, Filme) sind aber vor allem Kinder und Jugendliche kaum noch in der Lage, zu reflektieren, kritisch zu rezipieren und in Folge ihre Lebenswirklichkeit in einem sozialen Kontext autonom zu gestalten. Das, was Menschsein ausmacht, wird immer weniger begreifbar und auf über Binärcodes Erfassbares reduziert. Indem die Geschichte(n) der realen Vorbilder (keine ideologischen, sondern authentisch-greifbare Autoritäten wie z.B. Eltern und Lehrerinnen) im Wettbewerb denen der medialen Heldinnen unterliegen, wird der Prozess der Rückbezüglichkeit – durch eine Unterbrechung der Weitergabe von Generationenerfahrung – unterlaufen. Erinnerung wird so zu einem Produkt der herrschenden Medialität,…
…deren Wirkung auf Bewusstseins- und Handlungsstrukturen durchschlägt.
Die massenhafte Verbreitung und Anwendung (Medialisierung)…
…von auf digitalen Datenformaten basierenden Kommunikationsoptionen (Neue Medien)…
…konstituiert für die Kinder und Jugendlichen, die zu Beginn dieses Prozesses der massenhaften Verbreitung von Computer, Internet und Privatfernsehen ab 1990 nicht älter als 2 Jahre waren,…
…eine neue Lebenswirklichkeit (Medialität), der sie sich als Produkt der überwiegend medialen Sozialisation nicht entziehen können. Diese von der Wirkung digital manipulierter Kommunikate durchdrungene Lebenswirklichkeit (Mediale Durchdringung),…
…die die post-digital Sozialisierten im Rahmen ihrer Entwicklung als Realität internalisieren und die im Moment des Erlebens zu persönlichkeitsbildender Erinnerung wird, zieht zunehmend auch eine Transformation der Bewusstseins- (Fröhlich 2000, S. 97) und Handlungsstrukturen (Fröhlich 2000, S. 216) nach sich. Dieser Prozess mündet in einen Verlust des Bewusstseins von der „Selbstkonsistenz und Kontinuität über die Zeit hinweg“ (Erikson 1973, S. 23) und unterläuft so eine sowohl durch intrapsychische als auch interpersonelle Komponenten (vgl. Akhtar und Samuel 1996) determinierte Identitätsbildung. Damit wird die Rückbezüglichkeit der in der Medialität wirksamen medialen Transformationspotenziale deutlich: Das Bewusstsein und folglich das Handeln werden durch eine medial-technisch determinierte Umwelt verändert. In der Folge führt ein solchermaßen fremdbestimmtes Handeln zu veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die dann wiederum sowohl auf die interpersonellen als auch intrapsychischen Dimensionen wirken.
Eine zentrale Eigenschaft der Konstitution post-digital sozialisierter Jugendlicher besteht im Verlust der Auswahlkompetenz zu Gunsten einer fragmentarischen, konsumdeterminierten Rezeption vor einem immer diffuseren Wertehintergrund. Es wird überwiegend unreflektiert und manipuliert konsumiert: Das gilt für persönliche, humane Bezüge ebenso wie für die zahllosen Fernsehprogramme, für Musik oder die Inhalte des Internets, das ja auch als Trägermedium der technologieunterstützten Wissensvermittlung fungiert. In Konsequenz dessen legen sich Kinder und Jugendliche, deren Psyche zudem extrem plastisch ist, kaum noch fest, sind insgesamt sehr sprunghaft und darüber hinaus hoch suggestibel.1 Dieses auf den ersten Blick der natürlichen Neugier der Kinder und Jugendlichen entsprechende Verhalten, das aber durch die mediale Sozialisation zunehmend weit über die Norm hinaus forciert wird, mag zwar im Hinblick auf die Orientierung innerhalb immer schneller und unbeständiger werdender Bezüge scheinbar hilfreich sein, führt aber aufgrund der Hegemonie der medialen Sozialisation immer häufiger zur Überlastung und Fragmentierung der identitätsbildenden Erinnerung. Erinnerung wird erlebt, noch bevor sie in propositionale Netze eingebettet und zu der Erinnerung geformt werden kann, die Persönlichkeit macht (vgl. Schachter 2001). So verschwimmt real Wahrgenommenes mit medial Suggeriertem, das aufgrund der mangelnden Fähigkeit zur Selbstbeschränkung durch medial manipulierte Erinnerung zunehmend dominiert wird.
In einer schnelllebigen, überstimulierenden, auf Konsum ausgerichteten digitalen Ökonomie (Glotz 1999) muss der „Normalitätsbegriff“ von Lernbereitschaft und Lernbefähigung sowie von psychischer Gesundheit (nicht nur) bei Kindern und Jugendlichen neu überdacht werden. Nach Haffner et al. (2001 u. 2002) erscheinen Kinder heute aus Sicht der Eltern und PädagogInnen zunehmend eigenwillig, (medial) kompetent und fordernd. Sie zeigen ein ausgeprägtes Konkurrenzverhalten und ein hohes Maß an Aktivität, die gerade im Rahmen von Frontalunterricht als störend empfunden werden. Gleichzeitig haben sie aber große emotionale Bedürfnisse und mehr Schwierigkeiten, sich ihrem schulischen und sozialen Umfeld anzupassen. Die beobachteten Auffälligkeiten von Kindern könnten demnach auch als normale Bewältigungsversuche und Anpassungsprozesse an veränderte, durch die Quantität des Komplexen und die Qualität des Illusorischen determinierten Lebensbedingungen (vgl. Haffner et al. 2001 u. 2002) interpretiert werden. Sowohl Kinder und Jugendliche als auch deren Eltern und PädagogInnen müssen neue Formen der Bewältigung der hohen Alltagsanforderungen entwickeln. Weder mit aufoktroyierten Strategien wie z.B. dem Benimmunterricht an Schulen noch mit dem politischen Populismus vom Ende der Spaßpädagogik lässt sich die Wirkung des rückbezüglichen Regelkreises der Medialität im Hinblick auf eine menschzentrierte Bildungsintention zielführend instrumentalisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man sich zuallererst Klarheit über die Konstitution der Kinder und Jugendlichen verschaffen, respektive über das sie umgebende Umfeld, das diese bedingt, um dann in Ableitung davon Informationen hinsichtlich ihrer Befindlichkeiten, ihrer Bedürfnisse oder möglicher Beweggründe für „auffälliges“ Verhalten zu erlangen.
Genau diese Zeit lässt ein Schulbetrieb aktueller Ausprägung nicht m...