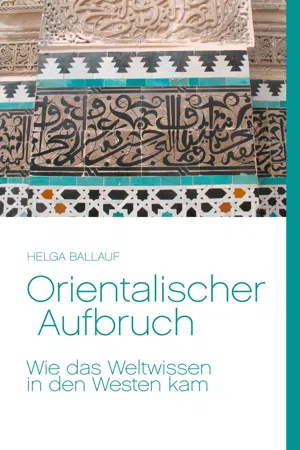![]()
1 Schillernde Sprache:
Vom Orient, der arabischen Wissenschaft und dem Mittelalter.
Kaum zu glauben, aber wahr: In Berlin, im Museum für Islamische Kunst, ist eine originale Kuppel aus der Alhambra in Granada von 1320 installiert. Ein paar Räume weiter liegt das sog. Aleppo-Zimmer von 1603 mit aufwändig bemalter Holzvertäfelung. Es stammt aus einem christlich-orientalischen Wohnhaus in Syrien. Außerdem besitzt das Museum die reich mit Reliefs verzierte Steinfassade eines arabischen Kalifenschlosses aus Mschatta im heutigen Jordanien, erbaut im 8. Jahrhundert. Was verbindet diese Ausstellungsstücke? Was haben sie in Berlin verloren?
Alhambra-Kuppel und Aleppo-Zimmer wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von deutschen Sammlern vor Ort gekauft. Die Kalifen-Fassade ließ sich Kaiser Wilhelm II. 1903 vom osmanischen Sultan Abdülhamid II. schenken. Drei Objekte, die mit der Orient-Begeisterung zu tun haben, die zu jener Zeit hierzulande herrschte. Es überwog die romantische Vorstellung vom ganz Anderen, von einer exotischen Welt. Dieser Orient weckte Sehnsüchte – nicht nur unter den Deutschen. Kein Wunder, dass der Luxuszug, der seit 1883 von London über Paris nach Konstantinopel fuhr, »Orient-Express« hieß – auch wenn er lediglich den Balkan durchquerte.
Tatsächlich legen die drei »orientalischen« Ausstellungsstücke in Berlin Zeugnis ab für eine lange Epoche, in der Kultur und Wissenschaft blühen, aber eben nicht im Okzident. Die Zeitspanne reicht, grob gerechnet, vom 7. bis zum 15. Jahrhundert. Schauplatz ist ein Gebiet, das heute Usbekistan, Afghanistan, Teile Pakistans, den Iran und die arabische Halbinsel umfasst. Und das sich an der nordafrikanischen Küste entlang bis weit in den Westen, nach Marokko und auf die Iberische Halbinsel fortsetzt. Spätestens bei dieser Aufzählung wird klar: Das »Orientalische« der Alhambra in Granada, das neben deutschen Sammlern auch romantische Maler und Dichter Ende des 19. Jahrhunderts stark anzog, lässt sich nicht geografisch erklären. Es sind vielmehr kulturelle Moden und historische Muster, die hier den Orient vom Okzident trennen.
Gibt es eine Klammer, die ein zeitlich und räumlich so ausladendes Panorama zusammenhält? Der Begriff »arabische Wissenschaft« bietet sich an. Es geht darum, wie das aus der Antike vorhandene Weltwissen aufgenommen, weiter entwickelt, verändert und weiter getragen wurde. Wichtige Impulse gingen von der islamischen Expansion aus sowie von der arabischen Sprache, die zunächst zum allumfassenden religiösen Verständigungsmittel wurde und danach zur führenden Wissenschaftssprache. Gelehrte, die zur »arabischen Wissenschaft« beitrugen, forschten und publizierten auf Arabisch, das aber häufig nicht ihre Muttersprache war. Die Wissenschaftler arbeiteten zwar meist im Auftrag islamischer Herrscher und Mäzene. Doch sie mussten nicht notwendigerweise zur muslimischen Glaubensgruppe gehören. Viele bedeutende Beiträge zur arabischen Wissenschaft kamen im Laufe der Jahrhunderte von nestorianischen und römischen Christen, von Juden und Anhängern Zarathustras (Zoroastrier).
Die Astronomen, Mathematiker, Mediziner, Philosophen und Kartographen der »arabischen Wissenschaft« verfügten nicht über den ausgefeilten naturwissenschaftlichen Methodenschatz ihrer Kolleg/innen des 21. Jahrhunderts. Ihr Denken, Schreiben und Lehren war oft noch von metaphysischen Vorstellungen durchdrungen. Aber sie waren wissbegierig. Sie überprüften Theorien, setzten auf Beobachtung und empirische Befunde, machten Experimente und werteten sie aus. So trennte sich langsam die Alchemie von der Chemie und die Astrologie von der Astronomie.
Ein schönes Beispiel fürs exakte Forschen wird vom Bagdader Hof des Kalifen al-Mam’un im 9. Jahrhundert berichtet: Für seine Astronomen stand fest, dass die Erde eine Kugel ist. In den antiken Schriften des Ptolemäus’ fanden sie den Umfang mit 180.000 stadia angegeben. Doch es ließ sich nicht eindeutig heraus finden, wie groß eine stadia war. Also schickte der Kalif seine Leute los zum Vermessen, um auf dieser Basis den Erdumfang (neu) berechnen zu können. Das blieb nicht der letzte Stand: Sobald man über exaktere Instrumente verfügte, wurden Messungen wiederholt.
All das ereignet sich im »Mittelalter« – eine Epochenbezeichnung, die es in sich hat. Europäische Gelehrte im 18. Jahrhundert verwenden sie, um die historische Phase zwischen »Altertum« und »Neuzeit« zu charakterisieren. Das Mittelalter erstreckte sich demnach auf deutschem Boden immerhin von ca. 500 bis ca. 1500 christlicher Zeitrechnung. Es war, so die nachträgliche Deutung, nur eine Periode des Übergangs. Die glorreiche Antike war lange vorbei und die fortschrittliche Neuzeit musste erst noch anbrechen. Eine eher konturlose Zwischenzeit mit positiven und negativen Zügen: Hier die Vorstellung vom »finsteren Mittelalter«, einer Zeit feudaler Ordnung, menschenverachtender Grausamkeit, verordneter Geistlosigkeit und pseudoreligiöser Tyrannei. Dort das romantisch verklärte Bild einer historischen Periode, in der die Menschen in harmonischen und überschaubaren Zusammenhängen lebten, eine Zeit ritterlicher Helden und poetischer Einfachheit. Erklärungsmuster, die beides bedienen: Abscheu und Faszination.
In der arabischen Welt schätzt man diese Wahrnehmung nicht – aus gutem Grund. Wie soll auch die Konstruktion »Mittelalter«, die mehr schlecht als recht auf die wechselvolle Geschichte der Völker in (West)europa passt, auf den Orient zutreffen? Hier handelt es sich bei der Phase zwischen dem 7. und dem 15. Jahrhundert ja gerade nicht um eine Zwischenepoche, die Historiker am liebsten vernachlässigen würden. Vielmehr ist es eine Hochzeit arabischer Kultur und Wissenschaft, eine Zeit, in der die arabische Welt einen originären Beitrag zur Entwicklung der gesamten Menschheit liefert.
Das »goldene Zeitalter« des Ostens gewissermaßen. Aber das ist eine weitere romantische Verklärung – eine Haltung, die keineswegs nur ein Privileg des Westens ist. Unter muslimischen Gläubigen, aber auch bei vielen Intellektuellen des arabisch-islamischen Raums gelten Granada und das maurische Spanien bis heute als »verlorenes Paradies«. Und man versucht, Ursachen und Folgen dieses Verlusts zu begreifen.
Vom Aufstieg und Fall einer Kultur, deren Impulse dem Westen zur führenden Rolle in der folgenden Epoche, der Neuzeit, verhalfen, werden die folgenden Kapitel berichten.
![]()
2 Übersetzungskünste:
Hätte Aristoteles sein Werk wieder erkannt?
Die Geschichte klingt abenteuerlich. Im Stenogramm: Schriften griechischer Denker – über Astronomie, Medizin oder Philosophie – werden im 8. und 9. Jahrhundert in Bagdad ins Arabische übersetzt. Nicht direkt zumeist, sondern aus syrisch-aramäischen Vorlagen. Mit der Ausbreitung des Islams gelangen diese arabischen Texte nach Westen, die nordafrikanische Küste entlang bis auf die Iberische Halbinsel. Der inzwischen vielfach kommentierte und erweiterte Wissensfundus wird schließlich in Toledo im 12. und 13. Jahrhundert zunächst ins Lateinische und später ins Spanische übersetzt. So gelangen die alten Griechen an die Universitäten von Oxford, Bologna und Paris. Eine lange Kette von Übertragungen, Weitergaben, Aneignungen.
Wem kommt da nicht das Spiel »Stille Post« in den Sinn, bei dem eine Botschaft allein durchs geflüsterte Weitersagen von Ohr zu Ohr oft nahezu auf den Kopf gestellt wird? Nicht nur interessierte Laien fragen sich, was nach einem so langen Weg der Anverwandlung von dem Inhalt dessen bleibt, was beispielsweise ein Aristoteles erdachte, lehrte, schrieb. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Phänomen – sowie die Literatur.
»Die Geschichte kennt kaum Schöneres und Bewegenderes als diese Hingabe eines arabischen Arztes an die Gedanken eines Menschen, von dem ihn vierzehn Jahrhunderte trennten.« So beschreibt der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges in einer Erzählung das Verhältnis zwischen Aristoteles und seinem bedeutendsten islamischen Kommentator, Ibn Rushd (vgl. Kap. 8). Dieser wirkte im 12. Jahrhundert zwischen Córdoba, Sevilla und Marrakesch. Bei uns ist er besser unter seinem latinisierten Namen Averroes bekannt. Borge schreibt: »Dieser Grieche, Urquell aller Philosophie, war den Menschen gesandt worden, um sie alles, was sich wissen lässt, zu lehren: Seine Schriften auszulegen, … war Averroes’ schwieriges Vorhaben.« Schwierig und anspruchsvoll auch deshalb, weil Ibn Rushd weder Griechisch noch Syrisch beherrschte, vielmehr »mit der Übersetzung einer Übersetzung arbeitete.«
Damit nicht genug: Der in einer arabisch-islamisch geprägten Welt lebende Aristoteles-Kommentator stolpert über Begriffe, die ihm nichts sagen – Tragödie und Komödie zum Beispiel. Er kennt zwar kunstvolle Formen des Rezitierens in arabischer Sprache. Jede Art theatralischen und dramaturgischen Gestaltens ist seiner Kultur jedoch fremd. Dafür fehlt ihm die Vorstellungskraft. So nennt Borges seine Erzählung »Averroes auf der Suche«. Und beschreibt, wie Ibn Rushd fündig wird, auf seine Art und im Rahmen seiner Welt: Er übersetzt Tragödie mit Lobrede und Komödie mit Satire oder Spottgedicht. Da wird nun Umberto Eco munter und spottet seinerseits: »Das krasseste Beispiel eines kulturellen Missverständnisses.« Der italienische Schriftsteller fährt fort: »Man stelle sich vor, was wohl der lateinische Übersetzer unter solchen Umständen von Aristoteles und seinen subtilen Analysen verstanden hatte.«
Hatte Eco, der als Semiotiker gut Bescheid wusste über Zeichensysteme und -prozesse aller Art, recht mit seiner Skepsis? Wer es genauer wissen will, kann die wissenschaftliche Literatur durchforsten, kann die Forscher/innen aus Arabistik, Semitistik, Graeco-Arabistik oder Romanistik, aus Wissenschaftsgeschichte, Linguistik, Translationswissenschaft oder Mittelalterforschung befragen. Sie haben – jeweils aus dem Blickwinkel ihres Fachs – diverse Beispiele des Missverstehens, Fehlinterpretierens oder Zurechtbiegens in den Übersetzungen aus der arabisch-islamischen Welt des Mittelalters entdeckt. Gleiches gilt für die zweite Phase, als aus dem Arabischen ins Lateinische übertragen wurde.
Die griechischen Götter, ihre Kämpfe untereinander und ihre Beziehungen zu den Menschen sind beispielsweise ein Stoff, der für den streng monotheistischen Islam wenn nicht inakzeptabel, dann zumindest sehr fremd ist. Kein Problem, findige Übersetzer machen aus Apoll und Dionysos, aus Aphrodite und Hades einfach Engel. Die existieren in der muslimischen Überlieferung sehr wohl, einschließlich der gefallenen ihrer Art. Und wenn die Götter unisono etwas von den Menschen verlangen, ist es noch einfacher: Da mutiert der Plural zum Singular – und schon steht Gottes (Allahs) Wille auf dem Papier. So etwa beim Hippokratischen Eid, der ethischen Grundlage des Arztberufs aus dem 4. Jahrhundert v. Ch. Hippokrates schwört die Mediziner auf klare Regeln ein und ruft die griechischen Götter Apoll, Asklepios, Hygieia und Panakeia als Zeugen auf. In der arabischen Übersetzung heißt es dann schlicht: »Ich schwöre bei Gott, dem Herrn des Lebens und des Todes...«
Eine andere bewährte Methode der gelehrten Übersetzer ist es, einfach wegzulassen, was unverständlich ist oder Anstoß erregen könnte: In Aristoteles’ Lehrbuch Historia animalium tauchen in der lateinischen Version jene Tiere, die man vor Ort nicht kennt, erst gar nicht auf.
Und im Zweifelsfall, wenn die weltliche oder geistliche Hierarchie gegen fremdes Gedankengut, das in den eigenen Herrschaftsbereich getragen werden soll, opponiert, sind einfach die Übersetzer an allem schuld. Eine besonders schöne Geschichte dazu ist von Robert Bacon überliefert. Der Franziskaner und Philosoph hielt Anfang des 13. Jahrhunderts Vorlesungen über Aristoteles an der Universität Oxford. Danach erlebte er an der Universität in Paris, dass die Bischofssynode intervenierte – und die Lehre des Aristoteles als unchristlich verboten wurde. Aus der Sicht des Franziskaners Bacon war dies ein Fehler. Er argumentierte nun, der griechische Denker sei sehr wohl tragbar. Komme es im Einzelfall zu Widersprüchen mit der christlichen Überlieferung, liege das lediglich an der sprachlich schlampigen Übertragung der Texte. So hoffte Bacon, den Bannstrahl von Aristoteles ablenken zu können. Wer so weit gelesen hat, mag sich wundern, dass die Fachwelt heute die Qualität der arabischen Texte aus dem Mittelalter lobt und als hohe kulturelle Leistung würdigt. Ein ähnliches Urteil gilt übrigens, wenn auch nicht ganz so einhellig, für die Ergebnisse der zweiten Übersetzungswelle ins Lateinische.
Überraschend wirkt die hohe Anerkennung auch deshalb, weil die Forscher/innen zugleich sehr detailliert die Hürden und Fallen beschreiben auf dem Weg vom Griechischen übers Syrisch-aramäische zum Arabischen und weiter ins Lateinische – und eventuell in die daraus entstehenden Volkssprachen. Selten standen den Übersetzern Originalhandschriften zur Verfügung. Vielmehr hatten sie es mit Manuskripten mehr oder weniger sorgfältiger Kopisten zu tun. Eine Wort-für Wort-Übertragung schwer verständlicher Passagen bot sich eher nicht an, weil man – vom indogermanischen Griechisch ins semitische Arabisch und zurück ins indogermanische Latein – jeweils auch die Sprachfamilie und Satzstruktur wechselte. Außerdem gaben die Schriften Anlass für Mehrdeutigkeiten und Missverständnisse: Das arabische Alphabet beispielsweise besteht nur aus Konsonanten. Vokale können durch eine Punktierung gesetzt werden; oft jedoch wird darauf in profanen Texten verzichtet. Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Dechiffrierung, nicht nur bei Eigennamen. Das kennen wir: Heißt der Prophet Mohammed oder Muhammad? Steht die halb zerstörte Kalifenstadt bei Córdoba unter dem Namen Medina Azahara oder Madinat al-Zahra? (vgl. Anhang: »Schreibweisen«)
Es existierten keine verbindlichen Glossare zwischen den Sprachen; im selben Text wechselten die Übersetzer oft die Terminologie. Sie waren nicht immer perfekt in der Zielsprache. In Bagdad und Toledo war eine Übersetzung in der Regel Gemeinschaftswerk. Die intensive Teamarbeit ist eine Übersetzungstechnik, die den Rahmen bietet, um gemeinsam über den eigenen Arbeitsprozess nachzudenken und ihn zu professionalisieren. Allerdings fragt sich, wie oft der gemeinsam gefundene Konsens auch dazu diente, kritische, widerständige, »nicht zeitgemäße« Thesen der ursprünglichen Autoren zu schleifen.
»Jeder Text ist auf Deutung angewiesen«, sagt dazu Jekatharina Lebedewa, Leiterin des Seminars für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Heidelberg. Und die Professorin fügt hinzu: »Die von jedem Übersetzer unbedingt zu erbringende intellektuelle Eigenleistung ist die Interpretation.« Sie beschreibt damit den heutigen Stand der ...