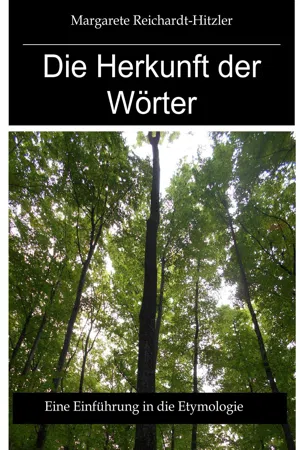
- 172 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Dieses Buch erklärt logisch und in sich schlüssig, wie unsere Wörter entstanden sind und was sie wirklich bedeuten. Auf welche Art und Weise, wo und wann ist die deutsche Sprache entstanden? Wer schuf sie? Darauf gibt das Buch Antwort. Zudem erhält mit diesem Buch die Sprachwissenschaft die bisher entbehrte naturwissenschaftliche Grundlage.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Herkunft der Wörter von Margarete Reichardt-Hitzler im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Langues et linguistique & Linguistique. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kapitel 1

Methoden der Etymologie
Es gibt zwei verschiedene Methoden, den Ursprung eines Wortes herauszufinden.
1. Methode
Die erste Methode ist die Erklärung eines Wortes aus der vergleichenden Sprachwissenschaft. Man untersucht verschiedene Sprachen auf Ähnlichkeiten der Wörter. Wenn ein Wort bereits in einer sehr alten, heute nicht mehr gesprochenen (toten) Sprache existiert hat, hat man im Allgemeinen den Ursprung des Wortes und seine damalige Bedeutung. Denn in dieser alten Sprache, die heute nicht mehr gesprochen wird, ist das Wort sozusagen so konserviert worden, wie es damals hieß und in seiner damaligen Bedeutung.
Ich bringe als Beispiel das bereits erwähnte Wort "Paradies". Die etymologische Erklärung im Herkunftswörterbuch des Duden lautet:
Paradies: Der biblische Name für den Garten Eden, mhd. paradis(e), ahd. paradis (vgl. aus anderen europäischen Sprachen z. B it. paradiso, span. paraiso, frz. paradis), geht über kirchenlat. paradisus auf griech. parádeisos "Paradies", eigentlich "Tiergarten, Park" zurück, das aus mpers. *pardez (= awest. pairi-daeza) "Einzäunung" stammt.
Awest. ist die Abkürzung von awestisch, eigentlich avestisch, einer altiranischen Sprache, die für die Zeit von 1200 bis 600 vor Christus nachgewiesen ist (Quelle Wikipedia). Awestisch ist demnach eine alte Sprache, die älteste, der man laut dem obigen Dudeneintrag das Wort Paradies zuordnen kann. Leider kann uns diese Erklärung im Duden über Paradies nichts Neues oder überhaupt Wesentliches sagen. Ein Paradies ist also eine Einzäunung?
2. Methode
Bei der zweiten Methode wird ein Wort aus sich selbst heraus erklärt. Hierbei lauscht man auf den Klang des Wortes und betrachtet die Silben und Buchstaben des Wortes gesondert. Man betrachtet also jede Silbe und jeden Buchstaben für sich und versucht so die Bedeutung herauszufinden. Möglicherweise wird uns dann aus dem Unterbewußtsein, aus dem Unbewußten die Bedeutung des Wortes zugeflüstert. Diese Methode ist zunächst eine Spielerei, die täglich in den Mußestunden betrieben werden kann. Man kann sie als sinnende Betrachtung ausüben, kann darüber meditieren, man kann sie als Rätselaufgabe betreiben, die uns überraschende Erkenntnisse bringt. Die Spielerei hört auf in dem Moment, wo uns das Wort Auskunft gibt über sich selbst, seinen Ursprung, seine wahre Bedeutung und uns Geheimnisse aus der Vorzeit übermittelt.
Nehmen wir als Beispiel das Wort "Ast". Wir sprechen das Wort aus und lauschen ihm nach: "Aa-s-t". Zusätzlich betrachten wir die Buchstaben. Das Wort Ast besitzt drei Buchstaben. Davon ist einer ein Vokal (Selbstlaut), nämlich das A. Zwei sind Konsonanten (Mitlaute), das S und das T. Das Besondere am Wort Ast ist, daß die beiden Konsonanten hintereinander stehen, anstatt das A einzufassen, zu umrahmen in der Form von "Sat" oder "Tas". Dies ist für die Entschlüsselung des Wortes bedeutsam und wird später noch genauer erklärt. Unser Unterbewußtsein vermittelt uns intuitiv die Bedeutung des Wortes: A-s-t. Wir hören zwischen s und t ein schwaches, stark verkürztes i, das beim Sprechen fast verschluckt wird. Dieses i schreiben wir zwischen s und t. Wir erhalten "a-sit(z)", auf schwäbisch "â-sitz", neuhochdeutsch "an-sitz". Im Herkunftswörterbuch des Duden lesen wir:
Ast: Das altgerm. Wort mhd., ahd. ast, got. asts, mniederl. ast beruht mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf idg: *ozdo-s "Ast, Zweig", vgl. z.B. griech. ózos "Ast, Zweig" und armen. ost "Ast, Zweig". Das idg. Wort ist eine alte Zusammensetzung und bedeutet eigentlich "was (am Stamm) ansitzt" ...
Wir lesen hier, daß das Wort Ast aus einer älteren, heute nicht mehr gesprochenen Sprache stammt. Es stammt von dem indogermanischen "Ozdo-s" ab. Gleichzeitig aber läßt sich die Bedeutung und der Ursprung des Wortes aus dem heutigen Deutschen mit der zweiten Methode der Etymologie, der Erklärung aus dem Wort selbst, eindeutig herleiten. Dies führt uns zu folgender Frage: Ast ist aus den Wörtern "an" und "sitzen" gebildet. Es bedeutet "was am Stamm ansitzt". An und sitzen sind zwei Wörter aus dem heutigen Deutschen. Warum soll das Wort Ast dann indogermanischen Ursprungs sein?
Kapitel 2

Wie entsteht Sprache?
Die Buchstaben
Kompliziertere Laute, wie es die Wörter sind, werden aus einzelnen Lauten des Alphabets zusammengesetzt. Das Alphabet besteht aus einer Hintereinanderreihung (Aufzählung) von Lauten. Diese Laute werden im Alphabet als Zeichen dargestellt. Diese Zeichen nennt man heute noch Buchstaben, weil sie früher hauptsächlich in die Rinde von Buchen geschnitzt wurden. Das heutige lateinische Alphabet hat 26 Zeichen. Wie bereits im vorigen Kapitel bei der Erklärung des Wortes Ast erwähnt, gibt es im Alphabet Selbstlaute und Mitlaute. Ich erkläre diese beiden Bezeichnungen kurz: Der Selbstlaut tönt allein (selbst). Es handelt sich hierbei um A, E, I, O und U. Der Mitlaut tönt nur zusammen mit einem Selbstlaut oder Vokal. Bei den Mitlauten ist zuerst das B zu nennen. Der Konsonant B wird im Alphabet zusammen mit dem Vokal E gesprochen, also Be. C wird Tse gesprochen, D als De, F als Ef und andere mehr.
Das moderne lateinische Alphabet entbehrt gegenüber der frühen Zeichenschrift zwei Merkmale: Das Ideogramm und den Begriff. Das Ideogramm ist ein stilisiertes Bild und kann aus dem Zeichen des Buchstabens entnommen werden. Der Buchstabe stellt also bildhaft etwas dar, was mit seiner Bedeutung zu tun hat. Der zu dem Buchstaben gehörende Begriff vermittelt eine Idee oder Vorstellung, die dem stilisierten Bild in etwa entspricht. Um ein Wort aus den Buchstaben des lateinischen Alphabets zu schaffen, haben wir die Möglichkeit, willkürlich aus den die Laute darstellenden Buchstaben ein Wort zu bilden. Wenn hingegen Buchstaben neben dem Zeichen und dem Laut eine begriffliche Bedeutung haben, muß man bei der Wortbildung die begriffliche Bedeutung der Zeichen mit berücksichtigen. Bei der Ausübung der etymologischen Wissenschaft müssen wir beachten, daß das lateinische Alphabet ein modernes Alphabet ist, die Wörter, die wir untersuchen, unter Umständen aber schon uralt sind. Da die frühen Buchstaben, aus denen diese alten Wörter gebildet wurden, eine begriffliche Bedeutung gehabt haben, müssen wir uns beim Ausüben der etymologischen Wissenschaft also zunächst mit dieser begrifflichen Bedeutung der frühen Buchstaben befassen.
Mythologischer Exkurs über die Runen
Wir machen einen mythologischen Exkurs in die vorgeschichtliche Zeit Germaniens und befassen uns mit den Runen. Runen sind frühe Buchstaben, die von den Germanen für verschiedene Zwecke, für Mitteilungen, Widmungen, aber auch zur Magie, für Zauber und Weissagung benutzt wurden. Runen wurden am Anfang in Rinde geschnitzt oder auf Steine geritzt. Deshalb sind Runen eckig, während es im heutigen Alphabet auch runde Zeichen gibt. Die Runen sind ein Beispiel für ein frühes Alphabet. Jede Rune besteht aus einem Zeichen, einem Ideogramm, einem Lautwert und einem Begriff. Alle vier, das Zeichen, das Ideogramm, der Lautwert und der Begriff entsprechen sich in ihrer Bedeutung. Rune kommt von Raunen. Die Runen wurde nach der Überlieferung von dem germanischen Gott Wotan (Odin) gefunden.
Wir lesen den in der isländischen Edda überlieferten Runenbericht Odins1:
"Wohl weiß ich,
daß ich am Windbaum hing
neun ganze Nächte,
speerverwundet,
dem Odin geopfert,
ich selber mir selbst -
an jenem Holz,
von dem niemand weiß,
aus welchen Wurzeln es aufwächst.
Sie reichten mir
weder Brot noch ein Trinkhorn;
da spähte ich nieder
erraffte die Runen,
schreiend erraffte ich sie
und fiel dann vom Holze ab."
Um Näheres über die Entstehung oder das Auffinden der Runen herauszufinden, schauen wir uns die vorliegende Edda-Strophe genauer an. Den Lautwert der Runen erfaßte Odin, indem er schrie. Vermutlich hing er an einem Bein kopfüber vom Baum und litt schreckliche Qualen. Er schrie vor Schmerz, er seufzte oder stöhnte. Er stieß Laute aus, hörte den Klang, begriff im selben Moment, wie der Klang erzeugt wurde, erkannte dabei das dazugehörige Zeichen, die Bedeutung des Zeichens als stilisiertes Abbild und wurde sich gleichzeitig über die begriffliche Bedeutung der Rune klar. Wie oben erwähnt, hat eine Rune nicht nur drei, sondern genau genommen vier Merkmale: Zeichen, Ideogramm, Laut und begriffliche Bedeutung.
Nachdem Odin die Runen vollständig gefunden hatte, gab er sie den Menschen. Mit den Runen gab er ihnen das Sprachvermögen und vor allem die M...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Kapitel 1: Methoden der Etymologie
- Kapitel 2: Wie entsteht Sprache
- Kapitel 3: Die Bedeutung der Buchstaben in der Etymologie
- Kapitel 4: Grundsätzliches zur Etymologie der deutschen Sprache
- Kapitel 5: Untersuchung neuhochdeutscher Wörter
- Kapitel 6: Alphabetisches Wörterverzeichnis
- Kapitel 7: Die Entwicklung der deutschen Grammatik
- Kapitel 8: Das Rätsel der Zahlen
- Kapitel 9: Der Zusammenhang von Sprache und Schrift
- Kapitel 10: Altägyptischer Exkurs
- Abkürzungen
- Bibliographie
- Bildquellennachweis
- Impressum