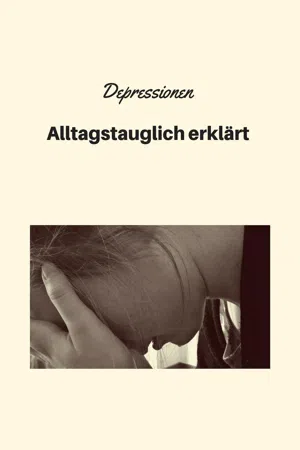![]()
Tagesablauf eines Depressiven in der Fachklinik
Um die Angst vor der Psychiatrie oder - etwas weniger beängstigend gesagt - stationären Behandlung zu nehmen, soll ein typischer Tagesablauf für einen depressiven Patienten geschildert werden.
Bevor überhaupt das Programm in der Stationären Behandlung beginnen kann, findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Man hat in der Regel ein paar spezifische Unterlagen dabei, die das individuelle Krankheitsbild sowie die aktuelle Medikation beschreiben. Das Erstgespräch dient zur Einsortierung des Patienten in den Klinikalltag.
Steckt man ihn eher in die „Angst-Abteilung“ oder doch besser in die „Depressions-Gruppe“? Welchem behandelnden Arzt oder welcher Ärztin übergibt man ihn? Ist er privat versichert und findet deshalb noch ein Gespräch mit dem Chefarzt statt? Welche begleitenden Anwendungen wie Massagen, Krankengymnastik oder Arbeitstherapie werden noch verordnet? Da ausreichende Bewegung gegen Depressionen eine grosse Rolle spielt, gibt es hier zahlreiche Angebote von Nordic Walking über Fahrradfahren bis Wandern. Müssen zusätzliche internistische Untersuchungen das weitere Krankheitsbild abklären? Dann folgt auf jeden Fall obligatorisch eine Blutentnahme, um den aktuellen Gesundheitszustand zu bestimmen. Der Patient wird sodann körperlich auf seine Reflexe hin untersucht. Magen, Galle, Leber und Nieren werden abgetastet.
Es findet also eine medizinische Grunduntersuchung statt. Klagt der Patient über Herzbeschwerden oder Rückenschmerzen, folgen in der Regel zusätzliche Röntgen-, Ultraschall oder MRT-Untersuchungen – insbesondere des Kopfes, wenn Schwindel, Migräne oder neurologische Beschwerden eine Rolle spielen. Am Ende steht auf jeden Fall der Behandlungsplan, den jeder Patient als seinen persönlichen Tages-, Wochen- oder Monatsplan in die Hand gedrückt bekommt – sozusagen der Stundenplan. Dieser Plan ist bei allen Anwendungen und Terminen mitzunehmen. Die einzelnen erbrachten Leistungen werden später vom Klinikpersonal abgezeichnet und dienen am Ende als Beleg über die Gesamtheit der Therapie.
In der Regel sind Patienten in Zwei-Bett-Zimmern untergebracht (Privatpatienten in Einzelzimmern). Ähnlich wie im Krankenhaus werden sie morgens gegen sieben Uhr geweckt. Eine Frühgymnastik vor dem Frühstück kann ärztlicherseits angeordnet sein, aber auch auf freiwilliger Basis wahrgenommen werden. An manchen Tagen einmal pro Woche steht vor dem Frühstück die Gewichtskontrolle auf dem Programm. Dazu begibt man sich ins Schwestern- oder Untersuchungszimmer. In der Regel gehört die Blutdruckkontrolle auch mit dazu.
Wer Diabetes hat, für den kommt ein Blutzuckertest hinzu und manchmal auch ein Blutzucker-Tagesprofil. Zum Frühstück begibt man sich in einen Gemeinschaftsraum, wo sich meistens in Büffetform die Patienten selber versorgen. Übergewichtige bekommen ihre Rationen zugeteilt, denn eine Diätküche gehört in solchen Krankenhäusern mit zum Programm. Für solche Patienten, die zudem auf ihr Gewicht achten müssen, werden auch eigens Kochkurse angeboten.
Depressive sollen während eines stationären Aufenthalts auch den Zugang zur eigenen Kreativität wiederentdecken, indem über die Ergotherapie zahlreiche Möglichkeiten angeboten werden: Seidenmalerei, Aquarelle, Ölbilder, Töpferarbeiten, Figuren aus Speckstein, Holz-Mobile oder Pin- und Schlüsselwände aus Kork oder Holz. Erfahrene Therapeuten vermitteln die Techniken und helfen bei der Umsetzung. Zu manchen Jahreszeiten wird Plätzchenbacken oder die Herstellung von Pralinen angeboten. Autorenlesungen, Konzerte und Fachvorträge runden das Programm ab. Viele Angebote basieren auf Freiwilligkeit, und es kommt ganz entscheidend auf Motivation und Antrieb des Patienten an, was er während seines Klinikaufenthalts mitnimmt.
Dann beginnt das Programm, das von Patient zu Patient recht unterschiedlich aussehen kann. Der eine fängt in einer Sportgruppe oder Seniorengymnastik vormittags an. Ein anderer startet mit Fango und Massage oder Krankengymnastik. Dazu werden Bäder wie in einer ganz normalen Kur auch verordnet: zur Entspannung, Vitalisierung oder Ölbäder bei trockener Haut. Wichtig im Tages- und Wochenplan sind die Therapiegespräche in Gruppen und beim zugeteilten Therapeuten. Sie dauern in der Regel 45 Minuten und finden mindestens zweimal pro Woche statt.
Wer aufgrund aktueller Krisen einen zusätzlichen Gesprächsbedarf hat, kann die Notfallsprechstunde aufsuchen. Mindestens einmal pro Woche trifft man seinen behandelnden Assistenz- oder Oberarzt, und mindestens einmal pro Woche findet die Arztvisite statt, in der sich der Ober- oder Chefarzt über den augenblicklichen Zustand des Patienten und über die Entwicklung in der Klinik im Kreis der behandelnden Ärzte, Therapeuten und des Pflegepersonals informiert. Das Ganze dient einem runden, verlässlichen Bild über den Patienten.
Ziel ist es, dass der Depressive nicht an unterschiedlichen Stellen verschiedene Krankheitsverläufe und Therapieziele abgibt. Deshalb findet auch die wöchentliche Supervision im Kreis aller Therapierenden einschliesslich Masseuren und Arbeitstherapeuten statt. Nur so ist ein verlässliches Gesamtbild über den Patienten möglich und daraus resultierend ein erfolgreicher Therapieansatz.
Auf dem Programm von Kliniken stehen zunehmend auch Bewerbungstraining und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Eigene Werkstätten sollen Arbeitslose und Langzeitarbeitslose wieder an einen normalen Arbeitsrhythmus und Arbeitsalltag heranführen. Aber auch der Erhalt von Restarbeitsfähigkeit etwa bei Schwerbehinderten steht neben dem Wecken von Kreativität in den ergotherapeutischen Einrichtungen der Kliniken auf dem Programm. Da werden Körbe gebastelt, mit Holz und Speckstein allerlei Nützliches fabriziert, Vogelhäuschen gebaut, um vielleicht auch bei dem einen oder anderen Patienten ganz neue Fähigkeiten zu wecken.
Vor allem aber ist die Ergotherapie auch ein sehr nützliches Mittel für Depressive und psychisch Kranke überhaupt, sich mit ihren Problemen zu öffnen. So manche misshandelte Frau ist erst über den Weg der Ergotherapie aus sich herausgekommen. Kinder, die beispielsweise nur dunkle Bilder malen oder Gitter, Gefängnisse oder monströse Gestalten, sind in der Regel Opfer von Misshandlungen oder Vergewaltigungen gewesen, über die sie nicht reden können.
Der weitaus wichtigste Punkt eines stationären Aufenthalts in einer Fachklinik sind die Therapiegespräche mit Ärzten und Psychologen. Hier bestimmt der Patient weitgehend selbst, wie schnell er seine Depression angehen will. Wer sich hier verschliesst, gilt manchmal auch als nicht therapiefähig. Solche Fälle gibt es leider auch. Aber in der Regel sind die Therapeuten erfahren genug, Vorbehalte abzubauen oder gemeinsam mit dem Betroffenen über Brücken zu gehen. Manchmal stimmt auch die Chemie zwischen Patient und Therapeut nicht. Dann wird man gemeinsam Wege finden, entweder einen anderen Betreuer zu suchen oder den Patienten in eine andere Gruppe zu geben oder aber die Therapie vom Psychologen auf den Arzt zu verlagern. Eine Therapie ist immer auch eine Entwicklung, die je nach Fall an Fahrt und Dynamik gewinnt oder abflacht. Eine Therapie ist manchmal auch das Spiegelbild der Depression selbst: mit Auf und Ab, Durchbrüchen und Stillstand, Niedergeschlagenheit und Unzufriedenheit wie auch Hochgefühl und Lösungsstimmung. Erst wenn sich die Festigung verdichtet, dann steuert man auf das Ende des stationären Aufenthalts zu.
Es gibt selbstverständlich auch Patienten, die schnell einen Klinikaufenthalt abbrechen und nach einer Woche wieder die Einrichtung verlassen. In der Regel basiert die Behandlung von Depression auf Freiwilligkeit, es sei denn, der Patient leidet unter so starken Depressionen, dass er bereits eine Gefahr für die Allgemeinheit d...