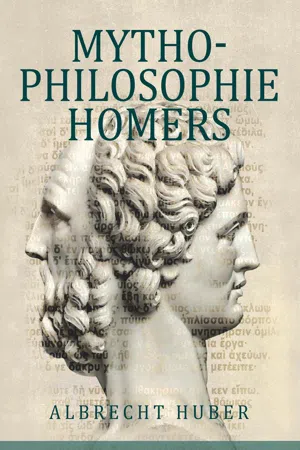![]()
DRITTER TEIL
Der Chiasmus von Theorie und Sinnlichkeit
A. Theorie als Sinnlichkeit
Sinnlichkeit wird im homerischen Epos als Verbrämung mythophilosophischer ,Theorie' zur lebendigen Maske, zur phýsis. So zuvorderst in den intelligiblen Namen des Odysseus, des Achilleus, im Namen Helenas und Penelopeias. Im ,Schnürboden' des Denkens, in der Erkenntnis, d.i. der ,Epiphanie' des Punkts, sind die lebendig-blutvollen Kulissen verankert, sind die personae dramaticae gleichsam wie an Marionettenfäden aufgehangen.817 Ansetzend aus einem realsymbolischen Ausgangsgrund, vermag es die homerische Poetik Sinnlichkeit zu deduzieren, sie aus ihrer theoretischen, d.h. aus ihrer ,geschauten' Wurzel herauszuheben, ein ums andere Mal sich am Wirklichen sättigend, wobei theoria als ,Schau' im ideîn, dem Gesehenen, ihren Sitz hat.818 Homerische Sinnlichkeit, an der unmittelbaren Idee ermessen, wird dabei eigentümlich dichterisch erschaffen und verlebendigt. Die urbildliche archē substruiert, bewohnt und sichert das Ganze.819 Sie mag als der von Platon inaugurierte anamnēsis-Grund der Ideenlehre voraufzugehen. „Die Nachahmung hat nur einen Wert unter der Bedingung, dass das Modell dem ersten Erkenntniswert angehört. Dient die Idee als Beispiel, dann hat das Produkt einen Wert, der zählt. Im Gegensatz dazu führt die Nachahmung des Sichtbaren durch das Sichtbare nur zu dem untersten Wert der eikasia (Staat 597 E)."820 Was H. Perls unter Bezug auf Platon ausführt, lässt sich als Äquivokation von dichterischer Oberfläche und Grundbezug auf Homer zurück projizieren.821 Denn sofern das idein nicht gegriffen ist, bleibt die gedichtete Sinnlichkeit ohne Verankerung, wird sie eigentümlich wertlos und leer. Im homerischen Epos ist die theoria in dem Maße zu sinnlicher Realität verdichtet und in statu nascendi vollkommen in die Kongruenz und die Sichselbstgleichheit gehoben, dass keinerlei Zwischenraum, keinerlei Differenz statthat. Seine unteilbare phýsis ist vielmehr aus-sich-selbst-scheinend. So ist das sogenannte „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" diesem Grundentscheid im Entwurf sehr nahe gekommen. Nach den Vorstellungen seiner Verfasser sind, um einer Remythologisierung willen, die Ideen sinnlich zu machen, die Mythologie umgekehrt aber philosophisch aufzuladen.822 Erst nach diesem Aufeinanderzugehen, ja in der Verschmelzung beider Seiten, sei der sich überlappende Bereich, der Mythologie und Philosophie in Kongruenz brächte, erschlossen. Dann erst wären Philosophen zugleich Mythologen und umgekehrt, wäre die Sinnlichkeit der Theorie unteilbar und sichselbstgleich. Solch antimetaphysisches Fundament, das die sogenannte ,Neue Mythologie' des Systemprogramm-Manifests anamnetisch-proleptisch anvisiert, findet sich im homerischen Epos in ganzer originaler Ursprünglichkeit eingelöst.823
Die mythologische Methode
Die mythologische Methode sucht den ,denksinnlich' erwachsenen Mythos in seiner intelligiblen Sichselbstgleichheit aufzuschließen, ihn entmythologisierend in die Transparenz zu heben und zu versuchen, ihn in eine theoretisch-begriffliche Präsenz zu übertragen. Um nichts weniger handelt es sich darin, als seine Unverborgenheit (aletheia) – seine Wahrheit – zu enthüllen.824 Nachdem wir die begriffliche Innen- wie Außenseite sinnlich und intelligibel als Verbund praktischer Theorie – als einen dem X-(Chi)-Zeichen entsprechenden Chiasmus – offengelegt haben, folgt, daraus hervorwachsend, die rein mytho-logische, d.h. die mythophilosophischtautegorische Deutung. So wäre hier ein methodologischer Markstein zu setzen: Das ,Dipylon', das ,Doppeltor' der Methode ist erreicht und eingenommen.825 Von nun an vermag aus dem Doppelschliff der Realsymbolik angesetzt zu werden. Dabei ist die Einnahme der Mauer-, d.h. der Zirkelschwelle der notwendig bedungene Schlüssel. Das hierin und dergestalt indizierte hysteron proteron (der Zusammenfall des Späteren im Früheren) und die damit erfolgende Aufsprengung des konsekutiven Hintereinanders wird sodann zum Monaden-Begriff der ,mythologischen Methode', die das Epos als Form anamnetischer Prolepsis (d.i. wiedererinnernde Vorwegnahme) an jeder Stelle seiner Ausfaltung bewohnt und von Innen und vom Ganzen her organisiert. Von Anfang an wurde dies anhand der Abbreviatur des Odysseus-Namens offengelegt: So entbarg sich in seiner etymomythologischen Erschlossenheit, der Ausdeutung von hodos nyssos, selbst der entelechische Latenz-Begriff der Heimkehr (nóstos), das Versprechen und namentliche Siegel, den Wendepunkt (nýssa) zu erreichen, dem der Zirkelkampf, die teichomachia der Ilias wie die poietischen Abschattungen des Zirkels in der Odyssee, hemmend vorgeschaltet sind. So verbirgt sich im Ilias-Namen in illó wälzen, herumdrehen, umwenden (bes. beim Pflug), sowie in illiggos das Drehen, der Schwindel, eine antizipierende Anspielung auf diese Wendekehre.826 Nimmt man hinzu, dass der Name Troia ebenso an das verwandte Motivfeld des Laufs (trochē / trochos der Lauf, die Laufbahn) – anklingt827, so ließe sich in diesen sich etymomythologisch abschattenden ,Wortmünzungen' eine allgemeine Grundbedeutung, der gemeinsame Nenner ,wenden', herausfiltern. Das Ilias-Epos instrumentiert diesen Vorkampf (promachia) in einem ausgebreiteten, ineinander gewirkten und poietisch verschliffenen, indessen durch die mythophilosophische Idee geeinten Tableau: Die sich stellende Aufgabe besteht nun darin, die im Mauerkampf sinnlich verhüllte Aufhebung des steinernen Zirkels des Verstehens, gesteuert durch die urbildliche Topologie Mykenes, seinem gleichsam institutionell geformten, ebenso hemmenden wie leitenden Bannkreis ein Tor zu brechen. So hat bereits Schelling im Hinblick auf diese Zirkelöffnung philosophischerseits die methodischen Konsequenzen eingefordert. Seine Feststellung, wonach der Mythos ab einem gewissen Punkte selbst Führung und Geleit übernähme, d.h. selbst kybernautēs wird und also selbst lenke, wird damit als ,philosophisches Propylon' bzw. als notwendige Propädeutik beherzigt. Es ist die dem Mythos selbst abgezogene Methode, die ihn indes ,νοn innen' erfasst, statt ihn von außen – gleichsam objektivistisch-allochthon – nur anzustreifen. Ab einer gewissen neuralgischen Schwelle sind wir gezwungen, uns unserem ,Objekt' in seiner autochthonen Steuerung selbst vertrauensvoll anheim zu stellen, haben wir, von ihm gelenkt, willig und demutsvoll seiner Direktive zu folgen. Damit verändert sich aber vor allem auch das Schreiben über ein Objekt hin zu einem ,inschriftlichen' Schreiben, einem Verfolg des mythisch-mythologischen Itinerars selbst, das der Gegenstand des Interesses, uns zu lenken sich anschickend, vor uns ausbreitet. „Das wahrhaft Geschichtliche", so Schelling, „besteht darin, daß man den in dem Gegenstand selbst liegenden, also innern, objektiven Entwicklungsgrund auffindet; sowie aber dieses Princip der Entwicklung im Gegenstand selbst gefunden ist, müssen dann alle vorgreifenden eignen Gedanken gleichsam verleugnet werden; von nun an muss man bloß dem Gegenstand in seiner Selbstentwicklung folgen. Von einer solchen zugleich philosophischen und empirischen, wissenschaftlichen und geschichtlichen – an und mit dem Gegenstand sich selbst entwickelnden Theorie ist [...] allein die Rede. Auf dem Standpunkt, von dem wir jetzt die Mythologie betrachten werden, haben nicht wir die Mythologie, sondern hat die Mythologie uns gestellt. Von nun an also ist der Inhalt dieses Vortrags nicht die von uns erklärte, sondern die sich selbst erklärende Mythologie. Bei dieser Selbsterklärung der Mythologie werden wir auch nicht genöthigt seyn die Ausdrücke der Mythologie selbst zu vermeiden, wir werden sie großentheils ihre eigne Sprache reden lassen, nachdem uns diese durch den jetzt gewonnenen Standpunkt verständlich geworden ist. [...] Wir werden die mythologischen Vorstellungen in ihrem eignen Sinn belassen, weil wir in den Stand gesetzt sind sie in ihrer Eigentlichkeit zu verstehen."828 Cassirer hat diese Forderung im theoretischen Palimpsest der symbolischen Form beherzigt und erneuert. Als ,theoretische Praxis' nimmt sie ,tautegorisches' Maß an der Immanenz ihres Gegenstands: „Um die Eigentümlichkeit irgendeiner geistigen Form sicher zu bestimmen, ist es vor allem notwendig, daß man sie mit ihren eigenen Maßen mißt. Die Gesichtspunkte, nach denen sie beurteilt und nach welchen ihre Leistung abgeschätzt wird, dürfen nicht von außen an sie herangebracht sondern sie müssen der eigenen Grundgesetzlichkeit der Formung selbst entnommen werden. Keine feststehende ,metaphysische' Kategorie, keine von andersher gegebene Bestimmung und Einteilung des Seins, so sicher und festgegründet sie immer erscheinen mag, kann uns der Notwendigkeit eines solchen rein immanenten Anfangs überheben."829
Die mythologische Methode entspringt daher ihrem gleichsam im Kentaur von Subjekt-Objekt vermittelten mythischen phainomenon selbst, im Zwischeninne des transitorischen Hiats als des ,Phasenübergangs' von Innen und Außen, der die Distanzsetzung des subjektiv-subjektivistischen Interpreten notwendig einzieht und ihn fortan in gleichsam mystischer Union dem in die Mitte vermittelten Gegenstand verbindet, ja ihn letztlich ihm gleichmacht.830 Diese Gleichsetzung oder, vorläufiger formuliert, diese innige Korrelation von Subjekt und Objekt, lässt sich (darauf wurde schon eingegangen) nach Cassirer mit ...